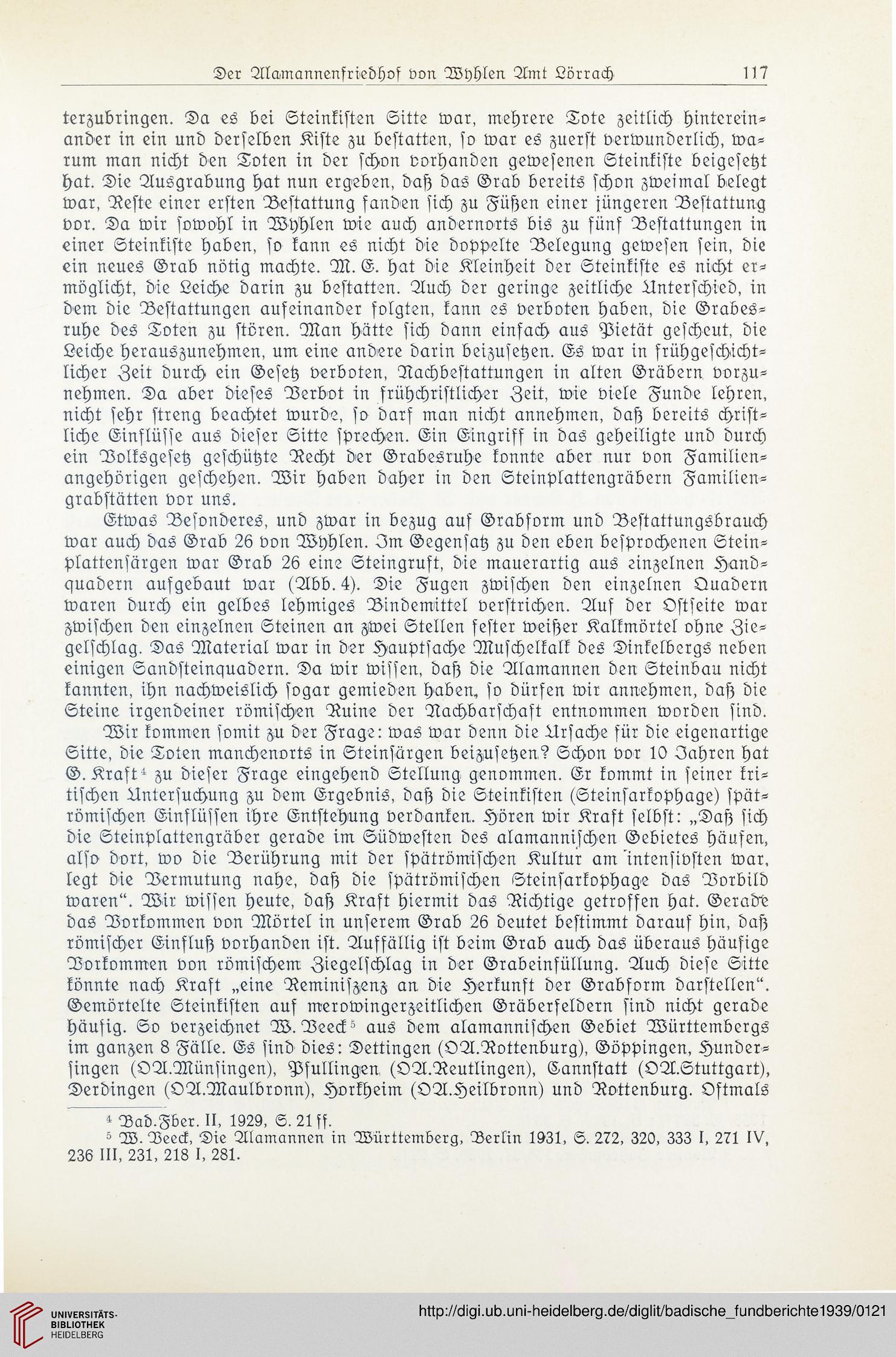Der Alamannenfrieöhof von Whhlen Amt Lörrach
117
terzubringen. Da es bei Steinkisten Sitte war, mehrere Tote zeitlich hinterein-
ander in ein und derselben Kiste zu bestatten, so war es zuerst verwunderlich, wa-
rum man nicht den Toten in der schon vorhanden gewesenen Steinkiste beigesetzt
hat. Die Ausgrabung hat nun ergeben, daß das Grab bereits schon zweimal belegt
war, Reste einer ersten Bestattung sanden sich zu Füßen einer jüngeren Bestattung
vor. Da wir sowohl in Whhlen wie auch andernorts bis zu süns Bestattungen in
einer Steinkiste haben, so kann es nicht die doppelte Belegung gewesen sein, die
ein neues Grab nötig machte. M. E. hat die Kleinheit der Steinkiste es nicht er-
möglicht, die Leiche darin zu bestatten. Auch der geringe zeitliche Anterschied, in
dem die Bestattungen auseinander folgten, kann es verboten haben, die Grabes-
ruhe des Toten zu stören. Man hätte sich dann einfach aus Pietät gefcheut, die
Leiche herauszunehmen, um eine andere darin beizusetzen. Cs war in frühgeschicht-
licher Zeit durch ein Gesetz verboten, Nachbestattungen in alten Gräbern vorzu-
nehmen. Da aber dieses Verbot in frühchristlicher Zeit, wie viele Funde lehren,
nicht sehr streng beachtet wurde, so darf man nicht annehmen, daß bereits christ-
liche Einflüsse aus dieser Sitte sprechen. Ein Eingriff in das geheiligte und durch
ein Bolksgesetz geschützte Recht der Grabesruhe konnte aber nur von Familien-
angehörigen geschehen. Wir haben daher in den Steinplattengräbern Familien-
grabstätten vor uns.
Etwas Besonderes, und zwar in bezug auf Grabsorm und Bestattungsbrauch
war auch das Grab 26 von Whhlen. Zm Gegensatz zu den eben besprochenen Stein-
plattensärgen war Grab 26 eine Steingruft, die mauerartig aus einzelnen Hand-
guadern aufgebaut war (Abb. 4). Die Fugen zwischen den einzelnen Quadern
waren durch ein gelbes lehmiges Bindemittel verstrichen. Auf der Ostseite war
zwischen den einzelnen Steinen an zwei Stellen fester Weiher Kalkmörtel ohne Zie-
gelschlag. Das Material war in der Hauptsache Muschelkalk des Dinkelbergs neben
einigen Sandsteinquadern. Da wir wissen, daß die Alamannen den Steinbau nicht
kannten, ihn nachweislich sogar gemieden haben, so dürfen wir annehmen, daß die
Steine irgendeiner römischen Ruine der Nachbarschaft entnommen worden sind.
Wir kommen somit zu der Frage: was war denn die Arsache für die eigenartige
Sitte, die Toten manchenorts in Steinsärgen beizusehen? Schon vor IO Fahren hat
G. Kraft^ zu dieser Frage eingehend Stellung genommen. Er kommt in seiner kri-
tischen Untersuchung zu dem Ergebnis, daß die Steinkisten (Steinsarkophage) spät-
römischen Einflüssen ihre Entstehung verdanken. Hören wir Kraft felbst: „Daß sich
die Steinplattengräber gerade im Südwesten des alamannischen Gebietes häusen,
also dort, wo die Berührung mit der spätrömischen Kultur am intensivsten war,
legt die Vermutung nahe, daß die spätrömischen Steinsarkophage das Vorbild
waren". Wir wissen heute, daß Kraft hiermit das Richtige getroffen hat. Gerade
das Vorkommen von Mörtel in unserem Grab 26 deutet bestimmt darauf hin, daß
römischer Einfluß vorhanden ist. Auffällig ist beim Grab auch das überaus häufige
Vorkommen von römischem Ziegelschlag in der Grabeinfüllung. Auch diese Sitte
könnte nach Kraft „eine Reminiszenz an die Herkunft der Grabform darstellen".
Gemörtelte Steinkisten auf merowingerzeitlichen Gräberfeldern sind nicht gerade
häufig. So verzeichnet W. Veeck^ aus dem alamannischen Gebiet Württembergs
im ganzen 8 Fälle. Es sind dies: Dettingen (OA.Rottenburg), Göppingen, Hunder-
singen (OA.Münsingen), Pfullingen. (OA.Reutlingen), Cannstatt (OA.Stuttgart),
Derdingen (OA.Maulbronn), Horkheim (OA.Heilbronn) und Rottenburg. Oftmals
Dad.Fber. II, 1929, S. 21ff.
5 W. Beeck, Die Alamannen in Württemberg, Berlin 1931, S. 272, 320, 333 l, 271 IV,
236 III, 231, 218 I, 281.
117
terzubringen. Da es bei Steinkisten Sitte war, mehrere Tote zeitlich hinterein-
ander in ein und derselben Kiste zu bestatten, so war es zuerst verwunderlich, wa-
rum man nicht den Toten in der schon vorhanden gewesenen Steinkiste beigesetzt
hat. Die Ausgrabung hat nun ergeben, daß das Grab bereits schon zweimal belegt
war, Reste einer ersten Bestattung sanden sich zu Füßen einer jüngeren Bestattung
vor. Da wir sowohl in Whhlen wie auch andernorts bis zu süns Bestattungen in
einer Steinkiste haben, so kann es nicht die doppelte Belegung gewesen sein, die
ein neues Grab nötig machte. M. E. hat die Kleinheit der Steinkiste es nicht er-
möglicht, die Leiche darin zu bestatten. Auch der geringe zeitliche Anterschied, in
dem die Bestattungen auseinander folgten, kann es verboten haben, die Grabes-
ruhe des Toten zu stören. Man hätte sich dann einfach aus Pietät gefcheut, die
Leiche herauszunehmen, um eine andere darin beizusetzen. Cs war in frühgeschicht-
licher Zeit durch ein Gesetz verboten, Nachbestattungen in alten Gräbern vorzu-
nehmen. Da aber dieses Verbot in frühchristlicher Zeit, wie viele Funde lehren,
nicht sehr streng beachtet wurde, so darf man nicht annehmen, daß bereits christ-
liche Einflüsse aus dieser Sitte sprechen. Ein Eingriff in das geheiligte und durch
ein Bolksgesetz geschützte Recht der Grabesruhe konnte aber nur von Familien-
angehörigen geschehen. Wir haben daher in den Steinplattengräbern Familien-
grabstätten vor uns.
Etwas Besonderes, und zwar in bezug auf Grabsorm und Bestattungsbrauch
war auch das Grab 26 von Whhlen. Zm Gegensatz zu den eben besprochenen Stein-
plattensärgen war Grab 26 eine Steingruft, die mauerartig aus einzelnen Hand-
guadern aufgebaut war (Abb. 4). Die Fugen zwischen den einzelnen Quadern
waren durch ein gelbes lehmiges Bindemittel verstrichen. Auf der Ostseite war
zwischen den einzelnen Steinen an zwei Stellen fester Weiher Kalkmörtel ohne Zie-
gelschlag. Das Material war in der Hauptsache Muschelkalk des Dinkelbergs neben
einigen Sandsteinquadern. Da wir wissen, daß die Alamannen den Steinbau nicht
kannten, ihn nachweislich sogar gemieden haben, so dürfen wir annehmen, daß die
Steine irgendeiner römischen Ruine der Nachbarschaft entnommen worden sind.
Wir kommen somit zu der Frage: was war denn die Arsache für die eigenartige
Sitte, die Toten manchenorts in Steinsärgen beizusehen? Schon vor IO Fahren hat
G. Kraft^ zu dieser Frage eingehend Stellung genommen. Er kommt in seiner kri-
tischen Untersuchung zu dem Ergebnis, daß die Steinkisten (Steinsarkophage) spät-
römischen Einflüssen ihre Entstehung verdanken. Hören wir Kraft felbst: „Daß sich
die Steinplattengräber gerade im Südwesten des alamannischen Gebietes häusen,
also dort, wo die Berührung mit der spätrömischen Kultur am intensivsten war,
legt die Vermutung nahe, daß die spätrömischen Steinsarkophage das Vorbild
waren". Wir wissen heute, daß Kraft hiermit das Richtige getroffen hat. Gerade
das Vorkommen von Mörtel in unserem Grab 26 deutet bestimmt darauf hin, daß
römischer Einfluß vorhanden ist. Auffällig ist beim Grab auch das überaus häufige
Vorkommen von römischem Ziegelschlag in der Grabeinfüllung. Auch diese Sitte
könnte nach Kraft „eine Reminiszenz an die Herkunft der Grabform darstellen".
Gemörtelte Steinkisten auf merowingerzeitlichen Gräberfeldern sind nicht gerade
häufig. So verzeichnet W. Veeck^ aus dem alamannischen Gebiet Württembergs
im ganzen 8 Fälle. Es sind dies: Dettingen (OA.Rottenburg), Göppingen, Hunder-
singen (OA.Münsingen), Pfullingen. (OA.Reutlingen), Cannstatt (OA.Stuttgart),
Derdingen (OA.Maulbronn), Horkheim (OA.Heilbronn) und Rottenburg. Oftmals
Dad.Fber. II, 1929, S. 21ff.
5 W. Beeck, Die Alamannen in Württemberg, Berlin 1931, S. 272, 320, 333 l, 271 IV,
236 III, 231, 218 I, 281.