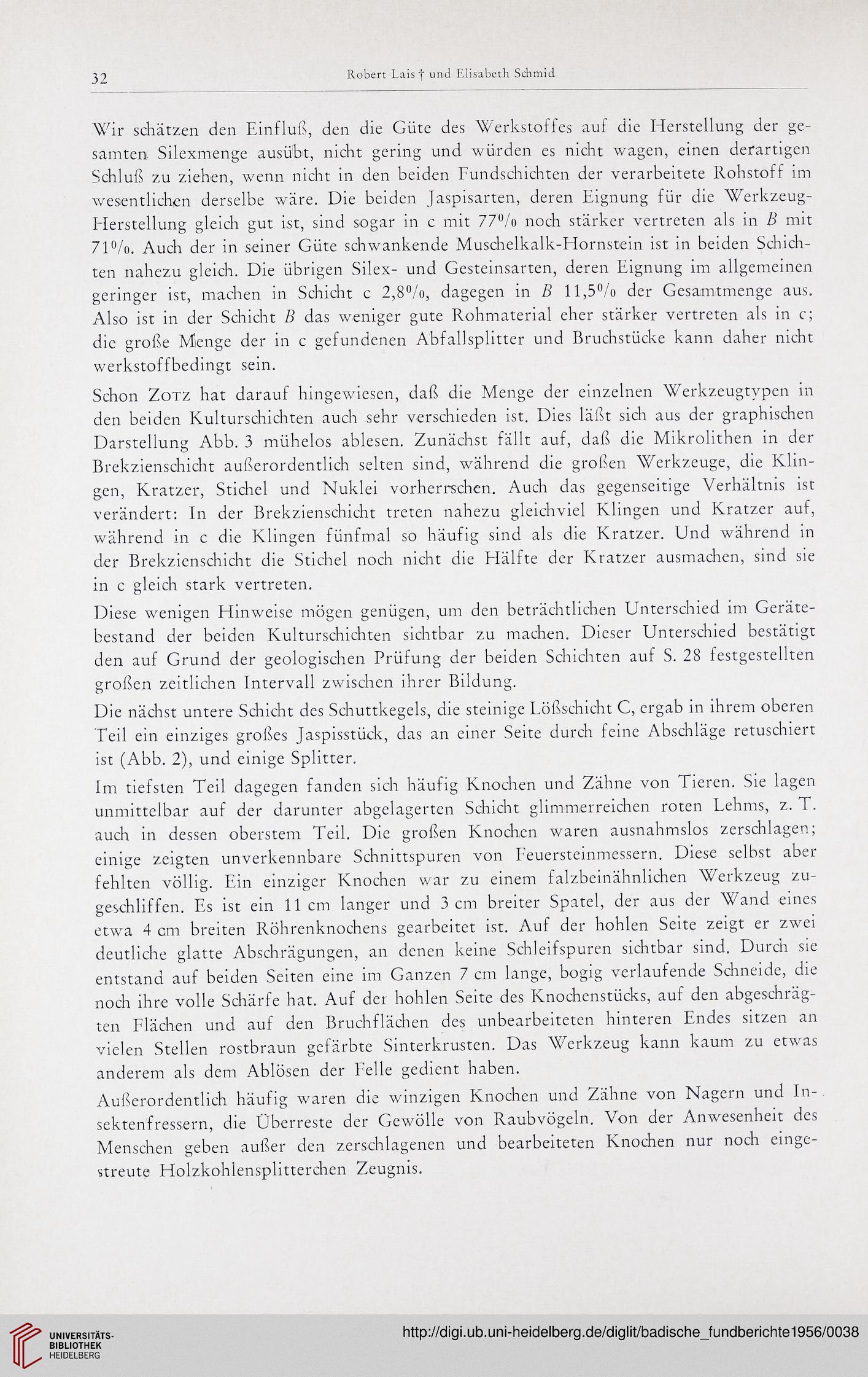32
Robert Laisf und Elisabeth Schmid
Wir schätzen den Einfluß, den die Güte des Werkstoffes auf die Herstellung der ge-
samten Silexmenge ausübt, nicht gering und würden es nicht wagen, einen derartigen
Schluß zu ziehen, wenn nicht in den beiden Fundschichten der verarbeitete Rohstoff im
wesentlichen derselbe wäre. Die beiden Jaspisarten, deren Eignung für die Werkzeug-
Flerstellung gleich gut ist, sind sogar in c mit 77°/o noch stärker vertreten als in B mit
71%. Auch der in seiner Güte schwankende Muschelkalk-Hornstein ist in beiden Schich-
ten nahezu gleich. Die übrigen Silex- und Gesteinsarten, deren Eignung im allgemeinen
geringer ist, machen in Schicht c 2,8%, dagegen in B 11,5% der Gesamtmenge aus.
Also ist in der Schicht B das weniger gute Rohmaterial eher stärker vertreten als in c;
die große Menge der in c gefundenen Abfallsplitter und Bruchstücke kann daher nicht
werkstoffbedingt sein.
Schon Zotz hat darauf hingewiesen, daß die Menge der einzelnen Werkzeugtypen in
den beiden Kulturschichten auch sehr verschieden ist. Dies läßt sich aus der graphischen
Darstellung Abb. 3 mühelos ablesen. Zunächst fällt auf, daß die Mikrolithen in der
Brekzienschicht außerordentlich selten sind, während die großen Werkzeuge, die Klin-
gen, Kratzer, Stichel und Nuklei vorherrschen. Auch das gegenseitige Verhältnis ist
verändert: In der Brekzienschicht treten nahezu gleichviel Klingen und Kratzer auf,
während in c die Klingen fünfmal so häufig sind als die Kratzer. Und während in
der Brekzienschicht die Stichel noch nicht die Hälfte der Kratzer ausmachen, sind sie
in c gleich stark vertreten.
Diese wenigen Hinweise mögen genügen, um den beträchtlichen Unterschied im Geräte-
bestand der beiden Kulturschichten sichtbar zu machen. Dieser Unterschied bestätigt
den auf Grund der geologischen Prüfung der beiden Schichten auf S. 28 festgestellten
großen zeitlichen Intervall zwischen ihrer Bildung.
Die nächst untere Schicht des Schuttkegels, die steinige Lößschicht C, ergab in ihrem oberen
Teil ein einziges großes Jaspisstück, das an einer Seite durch feine Abschläge retuschiert
ist (Abb. 2), und einige Splitter.
Im tiefsten Teil dagegen fanden sich häufig Knochen und Zähne von Tieren. Sie lagen
unmittelbar auf der darunter abgelagerten Schicht glimmerreichen roten Lehms, z. T.
auch in dessen oberstem Teil. Die großen Knochen waren ausnahmslos zerschlagen;
einige zeigten unverkennbare Schnittspuren von Feuersteinmessern. Diese selbst aber
fehlten völlig. Ein einziger Knochen war zu einem falzbeinähnlichen Werkzeug zu-
geschliffen. Es ist ein 11 cm langer und 3 cm breiter Spatel, der aus der Wand eines
etwa 4 cm breiten Röhrenknochens gearbeitet ist. Auf der hohlen Seite zeigt er zwei
deutliche glatte Abschrägungen, an denen keine Schleifspuren sichtbar sind. Durch sie
entstand auf beiden Seiten eine im Ganzen 7 cm lange, bogig verlaufende Schneide, die
noch ihre volle Schärfe hat. Auf det hohlen Seite des Knochenstücks, auf den abgeschräg-
ten Flächen und auf den Bruchflächen des unbearbeiteten hinteren Endes sitzen an
vielen Stellen rostbraun gefärbte Sinterkrusten. Das Werkzeug kann kaum zu etwas
anderem als dem Ablösen der Felle gedient haben.
Außerordentlich häufig waren die winzigen Knochen und Zähne von Nagern und In-
sektenfressern, die Überreste der Gewölle von Raubvögeln. Von der Anwesenheit des
Menschen geben außer den zerschlagenen und bearbeiteten Knochen nur noch einge-
streute Holzkohlensplitterchen Zeugnis.
Robert Laisf und Elisabeth Schmid
Wir schätzen den Einfluß, den die Güte des Werkstoffes auf die Herstellung der ge-
samten Silexmenge ausübt, nicht gering und würden es nicht wagen, einen derartigen
Schluß zu ziehen, wenn nicht in den beiden Fundschichten der verarbeitete Rohstoff im
wesentlichen derselbe wäre. Die beiden Jaspisarten, deren Eignung für die Werkzeug-
Flerstellung gleich gut ist, sind sogar in c mit 77°/o noch stärker vertreten als in B mit
71%. Auch der in seiner Güte schwankende Muschelkalk-Hornstein ist in beiden Schich-
ten nahezu gleich. Die übrigen Silex- und Gesteinsarten, deren Eignung im allgemeinen
geringer ist, machen in Schicht c 2,8%, dagegen in B 11,5% der Gesamtmenge aus.
Also ist in der Schicht B das weniger gute Rohmaterial eher stärker vertreten als in c;
die große Menge der in c gefundenen Abfallsplitter und Bruchstücke kann daher nicht
werkstoffbedingt sein.
Schon Zotz hat darauf hingewiesen, daß die Menge der einzelnen Werkzeugtypen in
den beiden Kulturschichten auch sehr verschieden ist. Dies läßt sich aus der graphischen
Darstellung Abb. 3 mühelos ablesen. Zunächst fällt auf, daß die Mikrolithen in der
Brekzienschicht außerordentlich selten sind, während die großen Werkzeuge, die Klin-
gen, Kratzer, Stichel und Nuklei vorherrschen. Auch das gegenseitige Verhältnis ist
verändert: In der Brekzienschicht treten nahezu gleichviel Klingen und Kratzer auf,
während in c die Klingen fünfmal so häufig sind als die Kratzer. Und während in
der Brekzienschicht die Stichel noch nicht die Hälfte der Kratzer ausmachen, sind sie
in c gleich stark vertreten.
Diese wenigen Hinweise mögen genügen, um den beträchtlichen Unterschied im Geräte-
bestand der beiden Kulturschichten sichtbar zu machen. Dieser Unterschied bestätigt
den auf Grund der geologischen Prüfung der beiden Schichten auf S. 28 festgestellten
großen zeitlichen Intervall zwischen ihrer Bildung.
Die nächst untere Schicht des Schuttkegels, die steinige Lößschicht C, ergab in ihrem oberen
Teil ein einziges großes Jaspisstück, das an einer Seite durch feine Abschläge retuschiert
ist (Abb. 2), und einige Splitter.
Im tiefsten Teil dagegen fanden sich häufig Knochen und Zähne von Tieren. Sie lagen
unmittelbar auf der darunter abgelagerten Schicht glimmerreichen roten Lehms, z. T.
auch in dessen oberstem Teil. Die großen Knochen waren ausnahmslos zerschlagen;
einige zeigten unverkennbare Schnittspuren von Feuersteinmessern. Diese selbst aber
fehlten völlig. Ein einziger Knochen war zu einem falzbeinähnlichen Werkzeug zu-
geschliffen. Es ist ein 11 cm langer und 3 cm breiter Spatel, der aus der Wand eines
etwa 4 cm breiten Röhrenknochens gearbeitet ist. Auf der hohlen Seite zeigt er zwei
deutliche glatte Abschrägungen, an denen keine Schleifspuren sichtbar sind. Durch sie
entstand auf beiden Seiten eine im Ganzen 7 cm lange, bogig verlaufende Schneide, die
noch ihre volle Schärfe hat. Auf det hohlen Seite des Knochenstücks, auf den abgeschräg-
ten Flächen und auf den Bruchflächen des unbearbeiteten hinteren Endes sitzen an
vielen Stellen rostbraun gefärbte Sinterkrusten. Das Werkzeug kann kaum zu etwas
anderem als dem Ablösen der Felle gedient haben.
Außerordentlich häufig waren die winzigen Knochen und Zähne von Nagern und In-
sektenfressern, die Überreste der Gewölle von Raubvögeln. Von der Anwesenheit des
Menschen geben außer den zerschlagenen und bearbeiteten Knochen nur noch einge-
streute Holzkohlensplitterchen Zeugnis.