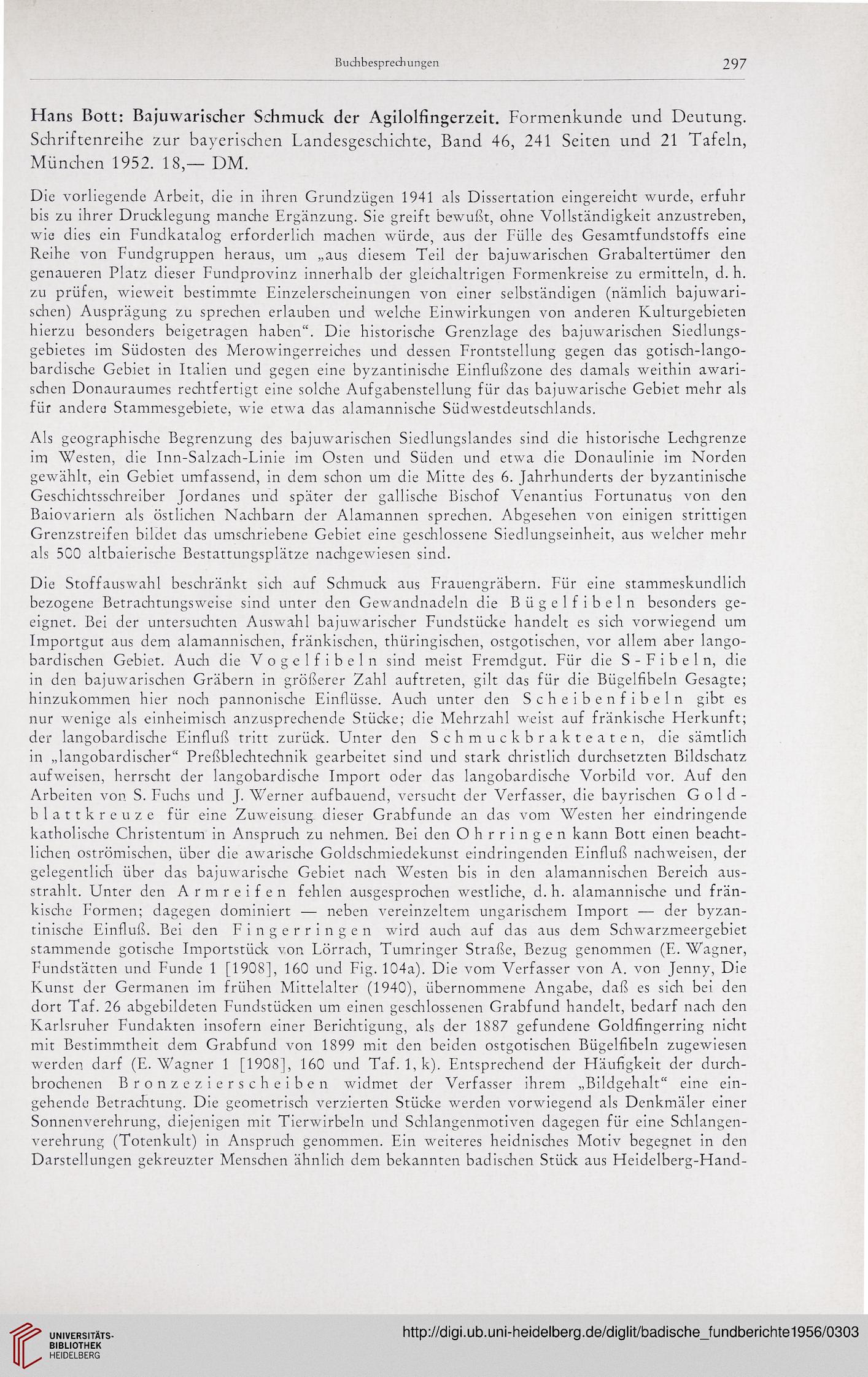Buchbesprechungen
297
Hans Bott: Bajuwarischer Schmuck der Agilolfingerzeit. Formenkunde und Deutung.
Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte, Band 46, 241 Seiten und 21 Tafeln,
München 1952. 18,— DM.
Die vorliegende Arbeit, die in ihren Grundziigen 1941 als Dissertation eingereicht wurde, erfuhr
bis zu ihrer Drucklegung manche Ergänzung. Sie greift bewußt, ohne Vollständigkeit anzustreben,
wie dies ein Fundkatalog erforderlich machen würde, aus der Fülle des Gesamtfundstoffs eine
Reihe von Fundgruppen heraus, um „aus diesem Teil der bajuwarischen Grabaltertümer den
genaueren Platz dieser Fundprovinz innerhalb der gleichaltrigen Formenkreise zu ermitteln, d. h.
zu prüfen, wieweit bestimmte Einzelerscheinungen von einer selbständigen (nämlich bajuwari-
schen) Ausprägung zu sprechen erlauben und welche Einwirkungen von anderen Kulturgebieten
hierzu besonders beigetragen haben“. Die historische Grenzlage des bajuwarischen Siedlungs-
gebietes im Südosten des Merowingerreiches und dessen Frontstellung gegen das gotisch-lango-
bardische Gebiet in Italien und gegen eine byzantinische Einflußzone des damals weithin awari-
schen Donauraumes rechtfertigt eine solche Aufgabenstellung für das bajuwarische Gebiet mehr als
für andere Stammesgöbiete, wie etwa das alamannische Südwestdeutschlands.
Als geographische Begrenzung des bajuwarischen Siedlungslandes sind die historische Lechgrenze
im ''Vesten, die Inn-Salzach-Linie im Osten und Süden und etwa die Donaulinie im Norden
gewählt, ein Gebiet umfassend, in dem schon um die Mitte des 6. Jahrhunderts der byzantinische
Geschichtsschreiber Jordanes und später der gallische Bischof Venantius Fortunatus von den
Baiovariern als östlichen Nachbarn der Alamannen sprechen. Abgesehen von einigen strittigen
Grenzstreifen bildet das umschriebene Gebiet eine geschlossene Siedlungseinheit, aus welcher mehr
als 5C0 altbaierische Bestattungsplätze nachgewiesen sind.
Die Stoffauswahl beschränkt sich auf Schmuck aus Frauengräbern. Für eine stammeskundlich
bezogene Betrachtungsweise sind unter den Gewandnadeln die Bügelfibeln besonders ge-
eignet. Bei der untersuchten Auswahl bajuwarischer Fundstücke handelt es sich vorwiegend um
Importgut aus dem alamannischen, fränkischen, thüringischen, ostgotischen, vor allem aber lango-
bardischen Gebiet. Auch die V ogelfibeln sind meist Fremdgut. Für die S - F i b e 1 n, die
in den bajuwarischen Gräbern in größerer Zahl auftreten, gilt das für die Bügelfibeln Gesagte;
hinzukommen hier noch pannonische Einflüsse. Auch unter den Scheibenfibeln gibt es
nur wenige als einheimisch anzusprechende Stücke; die Mehrzahl weist auf fränkische Herkunft;
der langobardische Einfluß tritt zurück. Unter den Schmuckbrakteaten, die sämtlich
in „langobardischer“ Preßblechtechnik gearbeitet sind und stark christlich durchsetzten Bildschatz
aufweisen, herrscht der langobardische Import oder das langobardische Vorbild vor. Auf den
Arbeiten von. S. Fuchs und J. Werner aufbauend, versucht der Verfasser, die bayrischen Gold-
blattkreuze für eine Zuweisung, dieser Grabfunde an das vom Westen her eindringende
katholische Christentum in Anspruch zu nehmen. Bei den Ohrringen kann Bott einen beacht-
lichen oströmischen, über die awarische Goldschmiedekunst eindringenden Einfluß nachweisen, der
gelegentlich über das bajuwarische Gebiet nach Westen bis in den alamannischen Bereich aus-
strahlt. Unter den Armreifen fehlen ausgesprochen westliche, d. h. alamannische und frän-
kische Formen; dagegen dominiert — neben vereinzeltem ungarischem Import — der byzan-
tinische Einfluß. Bei den Fingerringen wird auch auf das aus dem Schwarzmeergebiet
stammende gotische Importstück von Lörrach, Tumringer Straße, Bezug genommen (E. Wagner,
Fundstätten und Funde 1 [1908], 160 und Fig. 104a). Die vom Verfasser von A. von Jenny, Die
Kunst der Germanen im frühen Mittelalter (1940), übernommene Angabe, daß es sich bei den
dort Taf. 26 abgebildeten Fundstücken um einen geschlossenen Grabfund handelt, bedarf nach den
Karlsruher Fundakten insofern einer Berichtigung, als der 1887 gefundene Goldfingerring nicht
mit Bestimmtheit dem Grabfund von 1899 mit den beiden ostgotischen Bügelfibeln zugewiesen
werden darf (E. Wagner 1 [1908], 160 und Taf. 1, k). Entsprechend der Häufigkeit der durch-
brochenen Bronzezierscheiben widmet der Verfasser ihrem „Bildgehalt“ eine ein-
gehende Betrachtung. Die geometrisch verzierten Stücke werden vorwiegend als Denkmäler einer
Sonnenverehrung, diejenigen mit Tierwirbeln und Schlangenmotiven dagegen für eine Schlangen-
verehrung (Totenkult) in Anspruch genommen. Ein weiteres heidnisches Motiv begegnet in den
Darstellungen gekreuzter Menschen ähnlich dem bekannten badischen Stück aus Heidelberg-Hand-
297
Hans Bott: Bajuwarischer Schmuck der Agilolfingerzeit. Formenkunde und Deutung.
Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte, Band 46, 241 Seiten und 21 Tafeln,
München 1952. 18,— DM.
Die vorliegende Arbeit, die in ihren Grundziigen 1941 als Dissertation eingereicht wurde, erfuhr
bis zu ihrer Drucklegung manche Ergänzung. Sie greift bewußt, ohne Vollständigkeit anzustreben,
wie dies ein Fundkatalog erforderlich machen würde, aus der Fülle des Gesamtfundstoffs eine
Reihe von Fundgruppen heraus, um „aus diesem Teil der bajuwarischen Grabaltertümer den
genaueren Platz dieser Fundprovinz innerhalb der gleichaltrigen Formenkreise zu ermitteln, d. h.
zu prüfen, wieweit bestimmte Einzelerscheinungen von einer selbständigen (nämlich bajuwari-
schen) Ausprägung zu sprechen erlauben und welche Einwirkungen von anderen Kulturgebieten
hierzu besonders beigetragen haben“. Die historische Grenzlage des bajuwarischen Siedlungs-
gebietes im Südosten des Merowingerreiches und dessen Frontstellung gegen das gotisch-lango-
bardische Gebiet in Italien und gegen eine byzantinische Einflußzone des damals weithin awari-
schen Donauraumes rechtfertigt eine solche Aufgabenstellung für das bajuwarische Gebiet mehr als
für andere Stammesgöbiete, wie etwa das alamannische Südwestdeutschlands.
Als geographische Begrenzung des bajuwarischen Siedlungslandes sind die historische Lechgrenze
im ''Vesten, die Inn-Salzach-Linie im Osten und Süden und etwa die Donaulinie im Norden
gewählt, ein Gebiet umfassend, in dem schon um die Mitte des 6. Jahrhunderts der byzantinische
Geschichtsschreiber Jordanes und später der gallische Bischof Venantius Fortunatus von den
Baiovariern als östlichen Nachbarn der Alamannen sprechen. Abgesehen von einigen strittigen
Grenzstreifen bildet das umschriebene Gebiet eine geschlossene Siedlungseinheit, aus welcher mehr
als 5C0 altbaierische Bestattungsplätze nachgewiesen sind.
Die Stoffauswahl beschränkt sich auf Schmuck aus Frauengräbern. Für eine stammeskundlich
bezogene Betrachtungsweise sind unter den Gewandnadeln die Bügelfibeln besonders ge-
eignet. Bei der untersuchten Auswahl bajuwarischer Fundstücke handelt es sich vorwiegend um
Importgut aus dem alamannischen, fränkischen, thüringischen, ostgotischen, vor allem aber lango-
bardischen Gebiet. Auch die V ogelfibeln sind meist Fremdgut. Für die S - F i b e 1 n, die
in den bajuwarischen Gräbern in größerer Zahl auftreten, gilt das für die Bügelfibeln Gesagte;
hinzukommen hier noch pannonische Einflüsse. Auch unter den Scheibenfibeln gibt es
nur wenige als einheimisch anzusprechende Stücke; die Mehrzahl weist auf fränkische Herkunft;
der langobardische Einfluß tritt zurück. Unter den Schmuckbrakteaten, die sämtlich
in „langobardischer“ Preßblechtechnik gearbeitet sind und stark christlich durchsetzten Bildschatz
aufweisen, herrscht der langobardische Import oder das langobardische Vorbild vor. Auf den
Arbeiten von. S. Fuchs und J. Werner aufbauend, versucht der Verfasser, die bayrischen Gold-
blattkreuze für eine Zuweisung, dieser Grabfunde an das vom Westen her eindringende
katholische Christentum in Anspruch zu nehmen. Bei den Ohrringen kann Bott einen beacht-
lichen oströmischen, über die awarische Goldschmiedekunst eindringenden Einfluß nachweisen, der
gelegentlich über das bajuwarische Gebiet nach Westen bis in den alamannischen Bereich aus-
strahlt. Unter den Armreifen fehlen ausgesprochen westliche, d. h. alamannische und frän-
kische Formen; dagegen dominiert — neben vereinzeltem ungarischem Import — der byzan-
tinische Einfluß. Bei den Fingerringen wird auch auf das aus dem Schwarzmeergebiet
stammende gotische Importstück von Lörrach, Tumringer Straße, Bezug genommen (E. Wagner,
Fundstätten und Funde 1 [1908], 160 und Fig. 104a). Die vom Verfasser von A. von Jenny, Die
Kunst der Germanen im frühen Mittelalter (1940), übernommene Angabe, daß es sich bei den
dort Taf. 26 abgebildeten Fundstücken um einen geschlossenen Grabfund handelt, bedarf nach den
Karlsruher Fundakten insofern einer Berichtigung, als der 1887 gefundene Goldfingerring nicht
mit Bestimmtheit dem Grabfund von 1899 mit den beiden ostgotischen Bügelfibeln zugewiesen
werden darf (E. Wagner 1 [1908], 160 und Taf. 1, k). Entsprechend der Häufigkeit der durch-
brochenen Bronzezierscheiben widmet der Verfasser ihrem „Bildgehalt“ eine ein-
gehende Betrachtung. Die geometrisch verzierten Stücke werden vorwiegend als Denkmäler einer
Sonnenverehrung, diejenigen mit Tierwirbeln und Schlangenmotiven dagegen für eine Schlangen-
verehrung (Totenkult) in Anspruch genommen. Ein weiteres heidnisches Motiv begegnet in den
Darstellungen gekreuzter Menschen ähnlich dem bekannten badischen Stück aus Heidelberg-Hand-