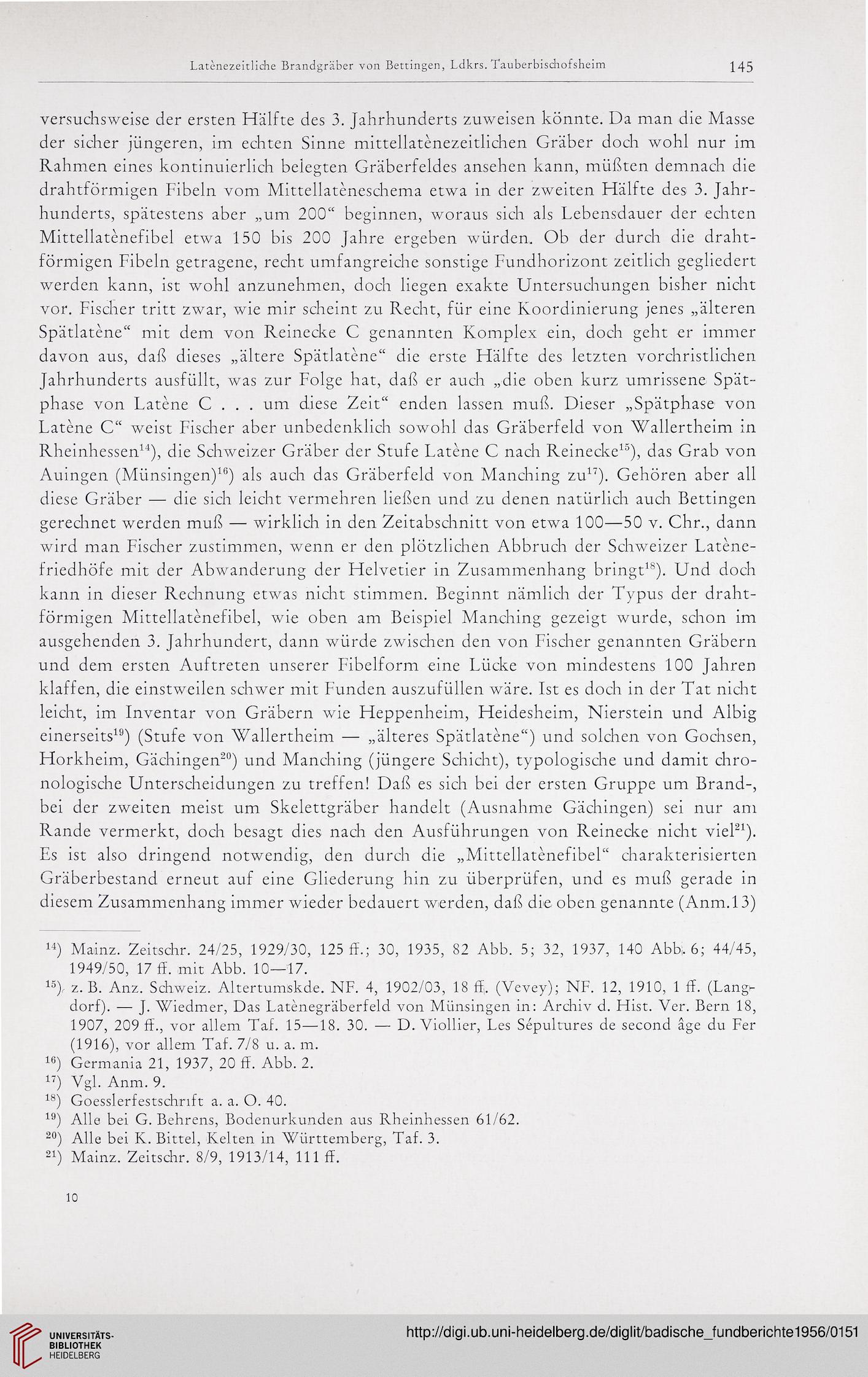Latenezeitliche Brandgräber von Bettingen, Ldkrs. Tauberbischofsheim
145
versuchsweise der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts zuweisen könnte. Da man die Masse
der sicher jüngeren, im echten Sinne mittellatenezeitlichen Gräber doch wohl nur im
Rahmen eines kontinuierlich belegten Gräberfeldes ansehen kann, müßten demnach die
drahtförmigen Fibeln vom Mittellateneschema etwa in der zweiten Hälfte des 3. Jahr-
hunderts, spätestens aber „um 200“ beginnen, woraus sich als Lebensdauer der echten
Mittellatenefibel etwa 150 bis 200 Jahre ergeben würden. Ob der durch die draht-
förmigen Fibeln getragene, recht umfangreiche sonstige Fundhorizont zeitlich gegliedert
werden kann, ist wohl anzunehmen, doch liegen exakte Untersuchungen bisher nicht
vor. Fischer tritt zwar, wie mir scheint zu Recht, für eine Koordinierung jenes „älteren
Spätlatene“ mit dem von Reinecke C genannten Komplex ein, doch geht er immer
davon aus, daß dieses „ältere Spätlatene“ die erste Hälfte des letzten vorchristlichen
Jahrhunderts ausfüllt, was zur Folge hat, daß er auch „die oben kurz umrissene Spät-
phase von Latene C . . . um diese Zeit“ enden lassen muß. Dieser „Spätphase von
Latene C“ weist Fischer aber unbedenklich sowohl das Gräberfeld von Wallertheim in
Rheinhessen14), die Schweizer Gräber der Stufe Latene C nach Reinecke15), das Grab von
Auingen (Münsingen)16) als auch das Gräberfeld von Manching zu17). Gehören aber all
diese Gräber — die sich leicht vermehren ließen und zu denen natürlich auch Bettingen
gerechnet werden muß — wirklich in den Zeitabschnitt von etwa 100—50 v. Chr., dann
wird man Fischer zustimmen, wenn er den plötzlichen Abbruch der Schweizer Latene-
friedhöfe mit der Abwanderung der Helvetier in Zusammenhang bringt18). Und doch
kann in dieser Rechnung etwas nicht stimmen. Beginnt nämlich der Typus der draht-
förmigen Mittellatenefibel, wie oben am Beispiel Manching gezeigt wurde, schon im
ausgehenden 3. Jahrhundert, dann würde zwischen den von Fischer genannten Gräbern
und dem ersten Auftreten unserer Fibelform eine Lücke von mindestens 100 Jahren
klaffen, die einstweilen schwer mit Funden auszufüllen wäre. Ist es doch in der Tat nicht
leicht, im Inventar von Gräbern wie Heppenheim, Heidesheim, Nierstein und Albig
einerseits19) (Stufe von Wallertheim — „älteres Spätlatene“) und solchen von Gochsen,
Horkheim, Gächingen20) und Manching (jüngere Schicht), typologische und damit chro-
nologische Unterscheidungen zu treffen! Daß es sich bei der ersten Gruppe um Brand-,
bei der zweiten meist um Skelettgräber handelt (Ausnahme Gächingen) sei nur am
Rande vermerkt, doch besagt dies nach den Ausführungen von Reinecke nicht viel21).
Es ist also dringend notwendig, den durch die „Mittellatenefibel“ charakterisierten
Gräberbestand erneut auf eine Gliederung hin zu überprüfen, und es muß gerade in
diesem Zusammenhang immer wieder bedauert werden, daß die oben genannte (Anm.l 3)
14) Mainz. Zeitschr. 24/25, 1929/30, 125 ff.; 30, 1935, 82 Abb. 5; 32, 1937, 140 Abb,. 6; 44/45,
1949/50, 17 ff. mit Abb. 10—17.
15) r z. B. Anz. Schweiz. Altertumskde. NF. 4, 1902/03, 18 ff„ (Vevey); NF. 12, 1910, 1 ff. (Langn
dorf). — J. Wiedmer, Das Latenegräberfeld von Münsingen in: Archiv d. Hist. Ver. Bern 18,
1907, 209 ff., vor allem Taf. 15 —18. 30. — D. Viollier, Les Sepultures de second äge du Fer
(1916), vor allem Taf. 7/8 u. a. m.
16) Germania 21, 1937, 20 ff. Abb. 2.
17) Vgl. Anm. 9.
18) Goesslerfestschrift a. a. O. 40.
19) Alle bei G. Behrens, Bodenurkunden aus Rheinhessen 61/62.
20) Alle bei K. Bittel, Kelten in Württemberg, Taf. 3.
21) Mainz. Zeitschr. 8/9, 1913/14, 111 ff.
10
145
versuchsweise der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts zuweisen könnte. Da man die Masse
der sicher jüngeren, im echten Sinne mittellatenezeitlichen Gräber doch wohl nur im
Rahmen eines kontinuierlich belegten Gräberfeldes ansehen kann, müßten demnach die
drahtförmigen Fibeln vom Mittellateneschema etwa in der zweiten Hälfte des 3. Jahr-
hunderts, spätestens aber „um 200“ beginnen, woraus sich als Lebensdauer der echten
Mittellatenefibel etwa 150 bis 200 Jahre ergeben würden. Ob der durch die draht-
förmigen Fibeln getragene, recht umfangreiche sonstige Fundhorizont zeitlich gegliedert
werden kann, ist wohl anzunehmen, doch liegen exakte Untersuchungen bisher nicht
vor. Fischer tritt zwar, wie mir scheint zu Recht, für eine Koordinierung jenes „älteren
Spätlatene“ mit dem von Reinecke C genannten Komplex ein, doch geht er immer
davon aus, daß dieses „ältere Spätlatene“ die erste Hälfte des letzten vorchristlichen
Jahrhunderts ausfüllt, was zur Folge hat, daß er auch „die oben kurz umrissene Spät-
phase von Latene C . . . um diese Zeit“ enden lassen muß. Dieser „Spätphase von
Latene C“ weist Fischer aber unbedenklich sowohl das Gräberfeld von Wallertheim in
Rheinhessen14), die Schweizer Gräber der Stufe Latene C nach Reinecke15), das Grab von
Auingen (Münsingen)16) als auch das Gräberfeld von Manching zu17). Gehören aber all
diese Gräber — die sich leicht vermehren ließen und zu denen natürlich auch Bettingen
gerechnet werden muß — wirklich in den Zeitabschnitt von etwa 100—50 v. Chr., dann
wird man Fischer zustimmen, wenn er den plötzlichen Abbruch der Schweizer Latene-
friedhöfe mit der Abwanderung der Helvetier in Zusammenhang bringt18). Und doch
kann in dieser Rechnung etwas nicht stimmen. Beginnt nämlich der Typus der draht-
förmigen Mittellatenefibel, wie oben am Beispiel Manching gezeigt wurde, schon im
ausgehenden 3. Jahrhundert, dann würde zwischen den von Fischer genannten Gräbern
und dem ersten Auftreten unserer Fibelform eine Lücke von mindestens 100 Jahren
klaffen, die einstweilen schwer mit Funden auszufüllen wäre. Ist es doch in der Tat nicht
leicht, im Inventar von Gräbern wie Heppenheim, Heidesheim, Nierstein und Albig
einerseits19) (Stufe von Wallertheim — „älteres Spätlatene“) und solchen von Gochsen,
Horkheim, Gächingen20) und Manching (jüngere Schicht), typologische und damit chro-
nologische Unterscheidungen zu treffen! Daß es sich bei der ersten Gruppe um Brand-,
bei der zweiten meist um Skelettgräber handelt (Ausnahme Gächingen) sei nur am
Rande vermerkt, doch besagt dies nach den Ausführungen von Reinecke nicht viel21).
Es ist also dringend notwendig, den durch die „Mittellatenefibel“ charakterisierten
Gräberbestand erneut auf eine Gliederung hin zu überprüfen, und es muß gerade in
diesem Zusammenhang immer wieder bedauert werden, daß die oben genannte (Anm.l 3)
14) Mainz. Zeitschr. 24/25, 1929/30, 125 ff.; 30, 1935, 82 Abb. 5; 32, 1937, 140 Abb,. 6; 44/45,
1949/50, 17 ff. mit Abb. 10—17.
15) r z. B. Anz. Schweiz. Altertumskde. NF. 4, 1902/03, 18 ff„ (Vevey); NF. 12, 1910, 1 ff. (Langn
dorf). — J. Wiedmer, Das Latenegräberfeld von Münsingen in: Archiv d. Hist. Ver. Bern 18,
1907, 209 ff., vor allem Taf. 15 —18. 30. — D. Viollier, Les Sepultures de second äge du Fer
(1916), vor allem Taf. 7/8 u. a. m.
16) Germania 21, 1937, 20 ff. Abb. 2.
17) Vgl. Anm. 9.
18) Goesslerfestschrift a. a. O. 40.
19) Alle bei G. Behrens, Bodenurkunden aus Rheinhessen 61/62.
20) Alle bei K. Bittel, Kelten in Württemberg, Taf. 3.
21) Mainz. Zeitschr. 8/9, 1913/14, 111 ff.
10