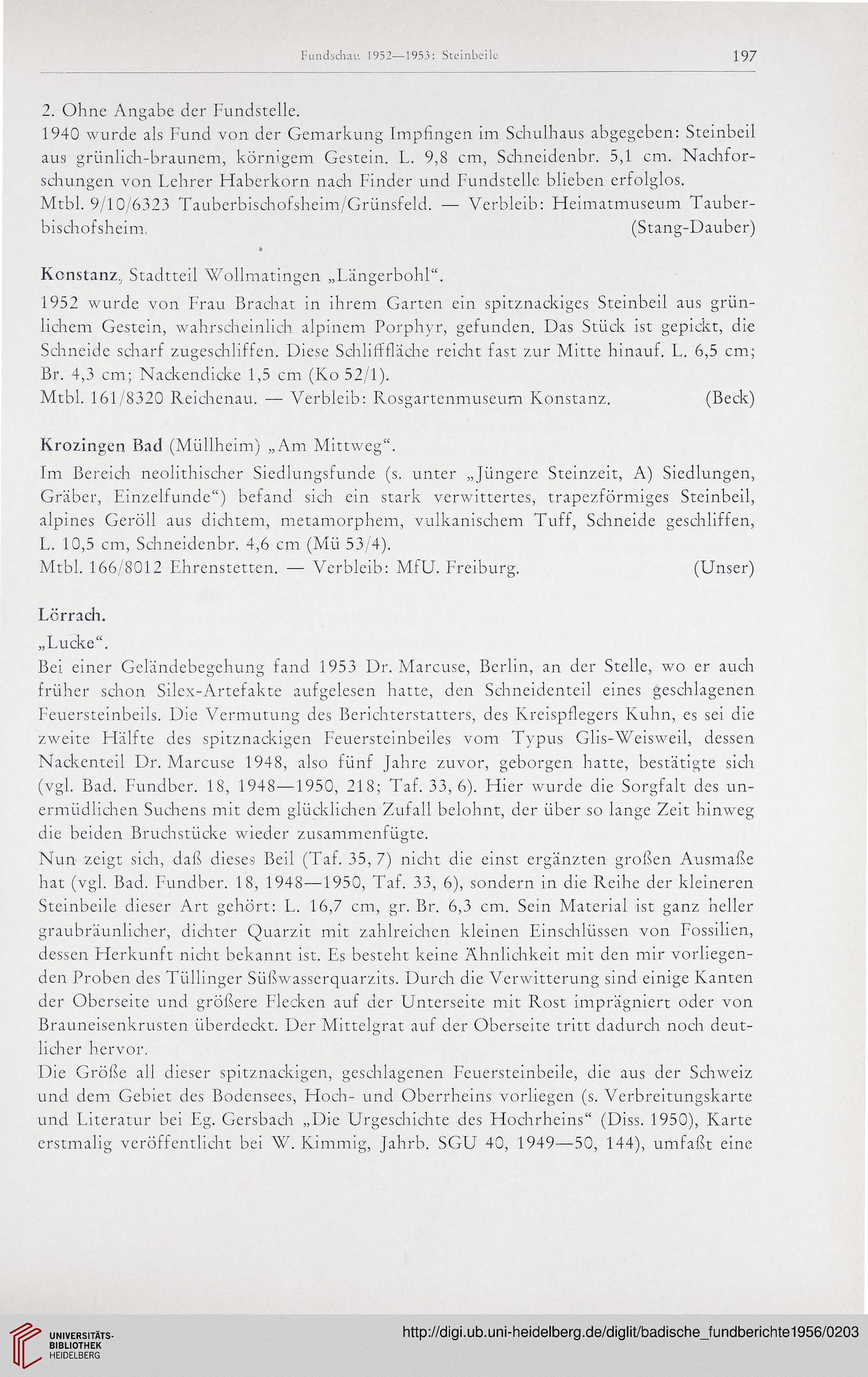Fundschau 1952—1953: Steinbeile
197
2. Ohne Angabe der Fundstelle.
1940 wurde als Fund von der Gemarkung Impfingen im Schulhaus abgegeben: Steinbeil
aus grünlich-braunem, körnigem Gestein. L. 9,8 cm, Schneidenbr. 5,1 cm. Nachfor-
schungen von Lehrer Haberkorn nach Finder und Fundstelle blieben erfolglos.
Mtbl. 9/10/6323 Tauberbischofsheim/Grünsfeld. — Verbleib: Heimatmuseum Tauber-
bischofsheim, (Stang-Dauber)
Konstanz., Stadtteil Wollmatingen „Längerbohl“.
1952 wurde von Frau Brachat in ihrem Garten ein spitznackiges Steinbeil aus grün-
lichem Gestein, wahrscheinlich alpinem Porphyr, gefunden. Das Stück ist gepickt, die
Schneide scharf zugeschliffen. Diese Schlifffläche reicht fast zur Mitte hinauf. L. 6,5 cm;
Br. 4,3 cm; Nackendicke 1,5 cm (Ko 52/1).
Mtbl. 161/8320 Reichenau. — Verbleib: Rosgartenmuseum Konstanz. (Beck)
Krozingen Bad (Müllheim) „Am Mittweg“.
Im Bereich neolithischer Siedlungsfunde (s. unter „Jüngere Steinzeit, A) Siedlungen,
Gräber, Einzelfunde“) befand sich ein stark verwittertes, trapezförmiges Steinbeil,
alpines Geröll aus dichtem, metamorphem, vulkanischem Tuff, Schneide geschliffen,
L. 10,5 cm, Schneidenbr. 4,6 cm (Mü 53/4).
Mtbl. 166/8012 Ehrenstetten. — Verbleib: MfU. Freiburg. (Unser)
Lörrach.
„Lucke“.
Bei einer Geländebegehung fand 1953 Dr. Marcuse, Berlin, an der Stelle, wo er auch
früher schon Silex-Artefakte aufgelesen hatte, den Schneidenteil eines geschlagenen
Feuersteinbeils. Die Vermutung des Berichterstatters, des Kreispflegers Kuhn, es sei die
zweite Hälfte des spitznackigen Feuersteinbeiles vom Typus Glis-Weisweil, dessen
Nackenteil Dr. Marcuse 1948, also fünf Jahre zuvor, geborgen hatte, bestätigte sich
(vgl. Bad. Fundber. 18, 1948—1950, 218; Taf. 33, 6). Hier wurde die Sorgfalt des un-
ermüdlichen Suchens mit dem glücklichen Zufall belohnt, der über so lange Zeit hinweg
die beiden Bruchstücke wieder zusammenfügte.
Nun zeigt sich, daß dieses Beil (Taf. 35, 7) nicht die einst ergänzten großen Ausmaße
hat (vgl. Bad. Fundber. 18, 1948—1950, Taf. 33, 6), sondern in die Reihe der kleineren
Steinbeile dieser Art gehört: L. 16,7 cm, gr. Br. 6,3 cm. Sein Material ist ganz heller
graubräunlicher, dichter Quarzit mit zahlreichen kleinen Einschlüssen von Fossilien,
dessen Herkunft nicht bekannt ist. Es besteht keine Ähnlichkeit mit den mir vorliegen-
den Proben des Tüllinger Süßwasserquarzits. Durch die Verwitterung sind einige Kanten
der Oberseite und größere Flecken auf der Unterseite mit Rost imprägniert oder von
Brauneisenkrusten überdeckt. Der Mittelgrat auf der Oberseite tritt dadurch noch deut-
licher hervor.
Die Größe all dieser spitznackigen, geschlagenen Feuersteinbeile, die aus der Schweiz
und dem Gebiet des Bodensees, Hoch- und Oberrheins vorliegen (s. Verbreitungskarte
und Literatur bei Eg. Gersbach „Die Urgeschichte des Hochrheins“ (Diss. 1950), Karte
erstmalig veröffentlicht bei W. Kimmig, Jahrb. SGU 40, 1949—50, 144), umfaßt eine
197
2. Ohne Angabe der Fundstelle.
1940 wurde als Fund von der Gemarkung Impfingen im Schulhaus abgegeben: Steinbeil
aus grünlich-braunem, körnigem Gestein. L. 9,8 cm, Schneidenbr. 5,1 cm. Nachfor-
schungen von Lehrer Haberkorn nach Finder und Fundstelle blieben erfolglos.
Mtbl. 9/10/6323 Tauberbischofsheim/Grünsfeld. — Verbleib: Heimatmuseum Tauber-
bischofsheim, (Stang-Dauber)
Konstanz., Stadtteil Wollmatingen „Längerbohl“.
1952 wurde von Frau Brachat in ihrem Garten ein spitznackiges Steinbeil aus grün-
lichem Gestein, wahrscheinlich alpinem Porphyr, gefunden. Das Stück ist gepickt, die
Schneide scharf zugeschliffen. Diese Schlifffläche reicht fast zur Mitte hinauf. L. 6,5 cm;
Br. 4,3 cm; Nackendicke 1,5 cm (Ko 52/1).
Mtbl. 161/8320 Reichenau. — Verbleib: Rosgartenmuseum Konstanz. (Beck)
Krozingen Bad (Müllheim) „Am Mittweg“.
Im Bereich neolithischer Siedlungsfunde (s. unter „Jüngere Steinzeit, A) Siedlungen,
Gräber, Einzelfunde“) befand sich ein stark verwittertes, trapezförmiges Steinbeil,
alpines Geröll aus dichtem, metamorphem, vulkanischem Tuff, Schneide geschliffen,
L. 10,5 cm, Schneidenbr. 4,6 cm (Mü 53/4).
Mtbl. 166/8012 Ehrenstetten. — Verbleib: MfU. Freiburg. (Unser)
Lörrach.
„Lucke“.
Bei einer Geländebegehung fand 1953 Dr. Marcuse, Berlin, an der Stelle, wo er auch
früher schon Silex-Artefakte aufgelesen hatte, den Schneidenteil eines geschlagenen
Feuersteinbeils. Die Vermutung des Berichterstatters, des Kreispflegers Kuhn, es sei die
zweite Hälfte des spitznackigen Feuersteinbeiles vom Typus Glis-Weisweil, dessen
Nackenteil Dr. Marcuse 1948, also fünf Jahre zuvor, geborgen hatte, bestätigte sich
(vgl. Bad. Fundber. 18, 1948—1950, 218; Taf. 33, 6). Hier wurde die Sorgfalt des un-
ermüdlichen Suchens mit dem glücklichen Zufall belohnt, der über so lange Zeit hinweg
die beiden Bruchstücke wieder zusammenfügte.
Nun zeigt sich, daß dieses Beil (Taf. 35, 7) nicht die einst ergänzten großen Ausmaße
hat (vgl. Bad. Fundber. 18, 1948—1950, Taf. 33, 6), sondern in die Reihe der kleineren
Steinbeile dieser Art gehört: L. 16,7 cm, gr. Br. 6,3 cm. Sein Material ist ganz heller
graubräunlicher, dichter Quarzit mit zahlreichen kleinen Einschlüssen von Fossilien,
dessen Herkunft nicht bekannt ist. Es besteht keine Ähnlichkeit mit den mir vorliegen-
den Proben des Tüllinger Süßwasserquarzits. Durch die Verwitterung sind einige Kanten
der Oberseite und größere Flecken auf der Unterseite mit Rost imprägniert oder von
Brauneisenkrusten überdeckt. Der Mittelgrat auf der Oberseite tritt dadurch noch deut-
licher hervor.
Die Größe all dieser spitznackigen, geschlagenen Feuersteinbeile, die aus der Schweiz
und dem Gebiet des Bodensees, Hoch- und Oberrheins vorliegen (s. Verbreitungskarte
und Literatur bei Eg. Gersbach „Die Urgeschichte des Hochrheins“ (Diss. 1950), Karte
erstmalig veröffentlicht bei W. Kimmig, Jahrb. SGU 40, 1949—50, 144), umfaßt eine