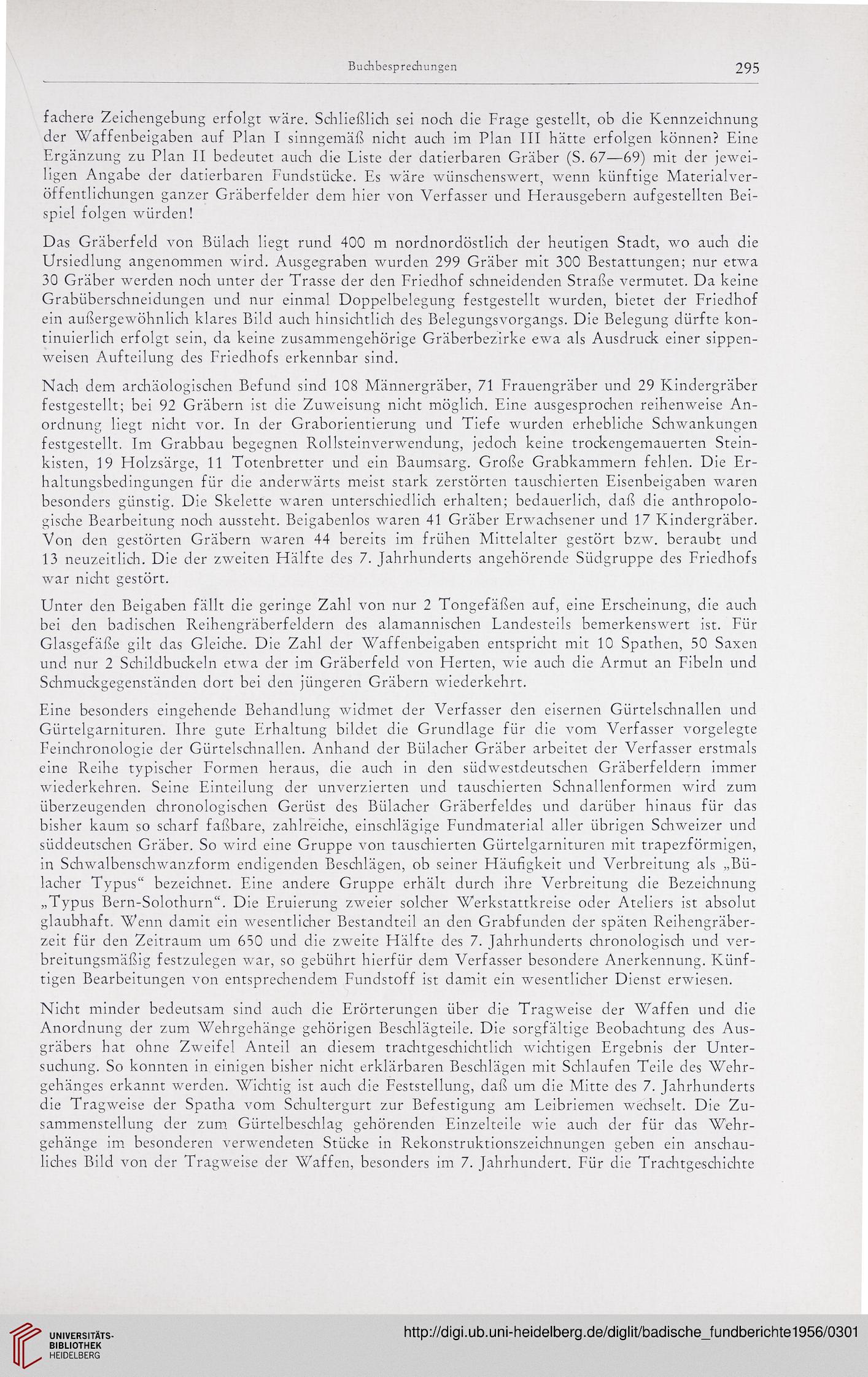Buchbesprechungen
295
fächere Zeichengebung erfolgt wäre. Schließlich sei noch die Frage gestellt, ob die Kennzeichnung
der Waffenbeigaben auf Plan I sinngemäß nicht auch im Plan III hätte erfolgen können? Eine
Ergänzung zu Plan II bedeutet auch die Liste der datierbaren Gräber (S. 67—69) mit der jewei-
ligen Angabe der datierbaren Fundstücke. Es wäre wünschenswert, wenn künftige Materialver-
öffentlichungen ganzer Gräberfelder dem hier von Verfasser und Herausgebern aufgestellten Bei-
spiel folgen würden!
Das Gräberfeld von Bülach liegt rund 400 m nordnordöstlich der heutigen Stadt, wo auch die
Ursiedlung angenommen wird. Ausgegraben wurden 299 Gräber mit 300 Bestattungen; nur etwa
30 Gräber werden noch unter der Trasse der den Friedhof schneidenden Straße vermutet. Da keine
Grabüberschneidungen und nur einmal Doppelbelegung festgestellt wurden, bietet der Friedhof
ein außergewöhnlich klares Bild auch hinsichtlich des Belegungsvorgangs. Die Belegung dürfte kon-
tinuierlich erfolgt sein, da keine zusammengehörige Gräberbezirke ewa als Ausdruck einer sippen-
weisen Aufteilung des Friedhofs erkennbar sind.
Nach dem archäologischen Befund sind 108 Männergräber, 71 Frauengräber und 29 Kindergräber
festgestellt; bei 92 Gräbern ist die Zuweisung nicht möglich. Eine ausgesprochen reihenweise An-
ordnung liegt nicht vor. In der Graborientierung und Tiefe wurden erhebliche Schwankungen
festgestellt. Im Grabbau begegnen Rollsteinverwendung, jedoch keine trockengemauerten Stein-
kisten, 19 Holzsärge, 11 Totenbretter und ein Baumsarg. Große Grabkammern fehlen. Die Er-
haltungsbedingungen für die anderwärts meist stark zerstörten tauschierten Eisenbeigaben waren
besonders günstig. Die Skelette waren unterschiedlich erhalten; bedauerlich, daß die anthropolo-
gische Bearbeitung noch aussteht. Beigabenlos waren 41 Gräber Erwachsener und 17 Kindergräber.
Von den gestörten Gräbern waren 44 bereits im frühen Mittelalter gestört bzw. beraubt und
13 neuzeitlich. Die der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts angehörende Südgruppe des Friedhofs
war nicht gestört.
Unter den Beigaben fällt die geringe Zahl von nur 2 Tongefäßen auf, eine Erscheinung, die auch
bei den badischen Reihengräberfeldern des alamannischen Landesteils bemerkenswert ist. Für
Glasgefäße gilt das Gleiche. Die Zahl der Waffenbeigaben entspricht mit 10 Spathen, 50 Saxen
und nur 2 Schildbuckeln etwa der im Gräberfeld von Herten, wie auch die Armut an Fibeln und
Schmuckgegenständen dort bei den jüngeren Gräbern wiederkehrt.
Eine besonders eingehende Behandlung widmet der Verfasser den eisernen Gürtelschnallen und
Gürtelgarnituren. Ihre gute Erhaltung bildet die Grundlage für die vom Verfasser vorgelegte
Feinchronologie der Gürtelschnallen. Anhand der Bülacher Gräber arbeitet der Verfasser erstmals
eine Reihe typischer Formen heraus, die auch in den südwestdeutschen Gräberfeldern immer
wiederkehren. Seine Einteilung der unverzierten und tauschierten Schnallenformen wird zum
überzeugenden chronologischen Gerüst des Bülacher Gräberfeldes und darüber hinaus für das
bisher kaum so scharf faßbare, zahlreiche, einschlägige Fundmaterial aller übrigen Schweizer und
süddeutschen Gräber. So wird eine Gruppe von tauschierten Gürtelgarnituren mit trapezförmigen,
in Schwalbenschwanzform endigenden Beschlägen, ob seiner Häufigkeit und Verbreitung als „Bü-
lacher Typus“ bezeichnet. Eine andere Gruppe erhält durch ihre Verbreitung die Bezeichnung
„Typus Bern-Solothurn“. Die Eruierung zweier solcher Werkstattkreise oder Ateliers ist absolut
glaubhaft. Wenn damit ein wesentlicher Bestandteil an den Grabfunden der späten Reihengräber-
zeit für den Zeitraum um 650 und die zweite Hälfte des 7. Jahrhunderts chronologisch und ver-
breitungsmäßig festzulegen war, so gebührt hierfür dem Verfasser besondere Anerkennung. Künf-
tigen Bearbeitungen von entsprechendem Fundstoff ist damit ein wesentlicher Dienst erwiesen.
Nicht minder bedeutsam sind auch die Erörterungen über die Tragweise der Waffen und die
Anordnung der zum Wehrgehänge gehörigen Beschlägteile. Die sorgfältige Beobachtung des Aus-
gräbers hat ohne Zweifel Anteil an diesem trachtgeschichtlich wichtigen Ergebnis der Unter-
suchung. So konnten in einigen bisher nicht erklärbaren Beschlägen mit Schlaufen Teile des Wehr-
gehänges erkannt werden. Wichtig ist auch die Feststellung, daß um die Mitte des 7. Jahrhunderts
die Tragweise der Spatha vom Schultergurt zur Befestigung am Leibriemen wechselt. Die Zu-
sammenstellung der zum. Gürtelbeschlag gehörenden Einzelteile wie auch der für das Wehr-
gehänge im besonderen verwendeten Stücke in Rekonstruktionszeichnungen geben ein anschau-
liches Bild von der Tragweise der Waffen, besonders im 7. Jahrhundert. Für die Trachtgeschichte
295
fächere Zeichengebung erfolgt wäre. Schließlich sei noch die Frage gestellt, ob die Kennzeichnung
der Waffenbeigaben auf Plan I sinngemäß nicht auch im Plan III hätte erfolgen können? Eine
Ergänzung zu Plan II bedeutet auch die Liste der datierbaren Gräber (S. 67—69) mit der jewei-
ligen Angabe der datierbaren Fundstücke. Es wäre wünschenswert, wenn künftige Materialver-
öffentlichungen ganzer Gräberfelder dem hier von Verfasser und Herausgebern aufgestellten Bei-
spiel folgen würden!
Das Gräberfeld von Bülach liegt rund 400 m nordnordöstlich der heutigen Stadt, wo auch die
Ursiedlung angenommen wird. Ausgegraben wurden 299 Gräber mit 300 Bestattungen; nur etwa
30 Gräber werden noch unter der Trasse der den Friedhof schneidenden Straße vermutet. Da keine
Grabüberschneidungen und nur einmal Doppelbelegung festgestellt wurden, bietet der Friedhof
ein außergewöhnlich klares Bild auch hinsichtlich des Belegungsvorgangs. Die Belegung dürfte kon-
tinuierlich erfolgt sein, da keine zusammengehörige Gräberbezirke ewa als Ausdruck einer sippen-
weisen Aufteilung des Friedhofs erkennbar sind.
Nach dem archäologischen Befund sind 108 Männergräber, 71 Frauengräber und 29 Kindergräber
festgestellt; bei 92 Gräbern ist die Zuweisung nicht möglich. Eine ausgesprochen reihenweise An-
ordnung liegt nicht vor. In der Graborientierung und Tiefe wurden erhebliche Schwankungen
festgestellt. Im Grabbau begegnen Rollsteinverwendung, jedoch keine trockengemauerten Stein-
kisten, 19 Holzsärge, 11 Totenbretter und ein Baumsarg. Große Grabkammern fehlen. Die Er-
haltungsbedingungen für die anderwärts meist stark zerstörten tauschierten Eisenbeigaben waren
besonders günstig. Die Skelette waren unterschiedlich erhalten; bedauerlich, daß die anthropolo-
gische Bearbeitung noch aussteht. Beigabenlos waren 41 Gräber Erwachsener und 17 Kindergräber.
Von den gestörten Gräbern waren 44 bereits im frühen Mittelalter gestört bzw. beraubt und
13 neuzeitlich. Die der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts angehörende Südgruppe des Friedhofs
war nicht gestört.
Unter den Beigaben fällt die geringe Zahl von nur 2 Tongefäßen auf, eine Erscheinung, die auch
bei den badischen Reihengräberfeldern des alamannischen Landesteils bemerkenswert ist. Für
Glasgefäße gilt das Gleiche. Die Zahl der Waffenbeigaben entspricht mit 10 Spathen, 50 Saxen
und nur 2 Schildbuckeln etwa der im Gräberfeld von Herten, wie auch die Armut an Fibeln und
Schmuckgegenständen dort bei den jüngeren Gräbern wiederkehrt.
Eine besonders eingehende Behandlung widmet der Verfasser den eisernen Gürtelschnallen und
Gürtelgarnituren. Ihre gute Erhaltung bildet die Grundlage für die vom Verfasser vorgelegte
Feinchronologie der Gürtelschnallen. Anhand der Bülacher Gräber arbeitet der Verfasser erstmals
eine Reihe typischer Formen heraus, die auch in den südwestdeutschen Gräberfeldern immer
wiederkehren. Seine Einteilung der unverzierten und tauschierten Schnallenformen wird zum
überzeugenden chronologischen Gerüst des Bülacher Gräberfeldes und darüber hinaus für das
bisher kaum so scharf faßbare, zahlreiche, einschlägige Fundmaterial aller übrigen Schweizer und
süddeutschen Gräber. So wird eine Gruppe von tauschierten Gürtelgarnituren mit trapezförmigen,
in Schwalbenschwanzform endigenden Beschlägen, ob seiner Häufigkeit und Verbreitung als „Bü-
lacher Typus“ bezeichnet. Eine andere Gruppe erhält durch ihre Verbreitung die Bezeichnung
„Typus Bern-Solothurn“. Die Eruierung zweier solcher Werkstattkreise oder Ateliers ist absolut
glaubhaft. Wenn damit ein wesentlicher Bestandteil an den Grabfunden der späten Reihengräber-
zeit für den Zeitraum um 650 und die zweite Hälfte des 7. Jahrhunderts chronologisch und ver-
breitungsmäßig festzulegen war, so gebührt hierfür dem Verfasser besondere Anerkennung. Künf-
tigen Bearbeitungen von entsprechendem Fundstoff ist damit ein wesentlicher Dienst erwiesen.
Nicht minder bedeutsam sind auch die Erörterungen über die Tragweise der Waffen und die
Anordnung der zum Wehrgehänge gehörigen Beschlägteile. Die sorgfältige Beobachtung des Aus-
gräbers hat ohne Zweifel Anteil an diesem trachtgeschichtlich wichtigen Ergebnis der Unter-
suchung. So konnten in einigen bisher nicht erklärbaren Beschlägen mit Schlaufen Teile des Wehr-
gehänges erkannt werden. Wichtig ist auch die Feststellung, daß um die Mitte des 7. Jahrhunderts
die Tragweise der Spatha vom Schultergurt zur Befestigung am Leibriemen wechselt. Die Zu-
sammenstellung der zum. Gürtelbeschlag gehörenden Einzelteile wie auch der für das Wehr-
gehänge im besonderen verwendeten Stücke in Rekonstruktionszeichnungen geben ein anschau-
liches Bild von der Tragweise der Waffen, besonders im 7. Jahrhundert. Für die Trachtgeschichte