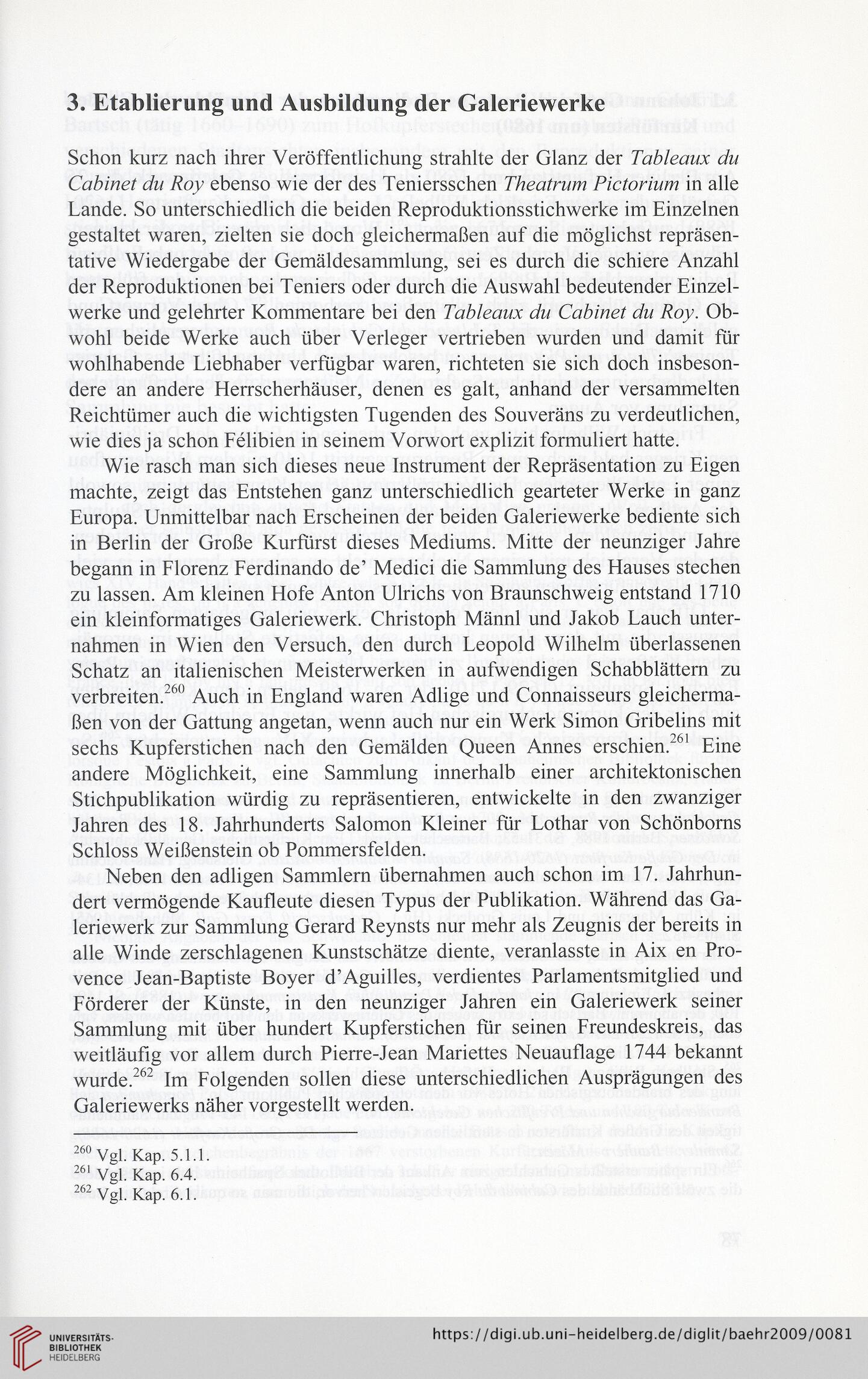3. Etablierung und Ausbildung der Galeriewerke
Schon kurz nach ihrer Veröffentlichung strahlte der Glanz der Tableaux du
Cabinet du Roy ebenso wie der des Teniersschen Theatrum Pictorium in alle
Lande. So unterschiedlich die beiden Reproduktionsstichwerke im Einzelnen
gestaltet waren, zielten sie doch gleichermaßen auf die möglichst repräsen-
tative Wiedergabe der Gemäldesammlung, sei es durch die schiere Anzahl
der Reproduktionen bei Teniers oder durch die Auswahl bedeutender Einzel-
werke und gelehrter Kommentare bei den Tableaux du Cabinet du Roy. Ob-
wohl beide Werke auch über Verleger vertrieben wurden und damit für
wohlhabende Liebhaber verfügbar waren, richteten sie sich doch insbeson-
dere an andere Herrscherhäuser, denen es galt, anhand der versammelten
Reichtümer auch die wichtigsten Tugenden des Souveräns zu verdeutlichen,
wie dies ja schon Felibien in seinem Vorwort explizit formuliert hatte.
Wie rasch man sich dieses neue Instrument der Repräsentation zu Eigen
machte, zeigt das Entstehen ganz unterschiedlich gearteter Werke in ganz
Europa. Unmittelbar nach Erscheinen der beiden Galeriewerke bediente sich
in Berlin der Große Kurfürst dieses Mediums. Mitte der neunziger Jahre
begann in Florenz Ferdinando de' Medici die Sammlung des Hauses stechen
zu lassen. Am kleinen Hofe Anton Ulrichs von Braunschweig entstand 1710
ein kleinformatiges Galeriewerk. Christoph Männl und Jakob Lauch unter-
nahmen in Wien den Versuch, den durch Leopold Wilhelm überlassenen
Schatz an italienischen Meisterwerken in aufwendigen Schabblättern zu
verbreiten.26" Auch in England waren Adlige und Connaisseurs gleicherma-
ßen von der Gattung angetan, wenn auch nur ein Werk Simon Gribelins mit
sechs Kupferstichen nach den Gemälden Queen Annes erschien.261 Eine
andere Möglichkeit, eine Sammlung innerhalb einer architektonischen
Stichpublikation würdig zu repräsentieren, entwickelte in den zwanziger
Jahren des 18. Jahrhunderts Salomon Kleiner für Lothar von Schönborns
Schloss Weißenstein ob Pommersfelden.
Neben den adligen Sammlern übernahmen auch schon im 17. Jahrhun-
dert vermögende Kaufleute diesen Typus der Publikation. Während das Ga-
leriewerk zur Sammlung Gerard Reynsts nur mehr als Zeugnis der bereits in
alle Winde zerschlagenen Kunstschätze diente, veranlasste in Aix en Pro-
vence Jean-Baptiste Boyer d'Aguilles, verdientes Parlamentsmitglied und
Förderer der Künste, in den neunziger Jahren ein Galeriewerk seiner
Sammlung mit über hundert Kupferstichen für seinen Freundeskreis, das
weitläufig vor allem durch Pierre-Jean Mariettes Neuauflage 1744 bekannt
wurde.262 Im Folgenden sollen diese unterschiedlichen Ausprägungen des
Galeriewerks näher vorgestellt werden.
260 Vgl. Kap. 5.1.1.
261 Vgl. Kap. 6.4.
262 Vgl. Kap. 6.1.
Schon kurz nach ihrer Veröffentlichung strahlte der Glanz der Tableaux du
Cabinet du Roy ebenso wie der des Teniersschen Theatrum Pictorium in alle
Lande. So unterschiedlich die beiden Reproduktionsstichwerke im Einzelnen
gestaltet waren, zielten sie doch gleichermaßen auf die möglichst repräsen-
tative Wiedergabe der Gemäldesammlung, sei es durch die schiere Anzahl
der Reproduktionen bei Teniers oder durch die Auswahl bedeutender Einzel-
werke und gelehrter Kommentare bei den Tableaux du Cabinet du Roy. Ob-
wohl beide Werke auch über Verleger vertrieben wurden und damit für
wohlhabende Liebhaber verfügbar waren, richteten sie sich doch insbeson-
dere an andere Herrscherhäuser, denen es galt, anhand der versammelten
Reichtümer auch die wichtigsten Tugenden des Souveräns zu verdeutlichen,
wie dies ja schon Felibien in seinem Vorwort explizit formuliert hatte.
Wie rasch man sich dieses neue Instrument der Repräsentation zu Eigen
machte, zeigt das Entstehen ganz unterschiedlich gearteter Werke in ganz
Europa. Unmittelbar nach Erscheinen der beiden Galeriewerke bediente sich
in Berlin der Große Kurfürst dieses Mediums. Mitte der neunziger Jahre
begann in Florenz Ferdinando de' Medici die Sammlung des Hauses stechen
zu lassen. Am kleinen Hofe Anton Ulrichs von Braunschweig entstand 1710
ein kleinformatiges Galeriewerk. Christoph Männl und Jakob Lauch unter-
nahmen in Wien den Versuch, den durch Leopold Wilhelm überlassenen
Schatz an italienischen Meisterwerken in aufwendigen Schabblättern zu
verbreiten.26" Auch in England waren Adlige und Connaisseurs gleicherma-
ßen von der Gattung angetan, wenn auch nur ein Werk Simon Gribelins mit
sechs Kupferstichen nach den Gemälden Queen Annes erschien.261 Eine
andere Möglichkeit, eine Sammlung innerhalb einer architektonischen
Stichpublikation würdig zu repräsentieren, entwickelte in den zwanziger
Jahren des 18. Jahrhunderts Salomon Kleiner für Lothar von Schönborns
Schloss Weißenstein ob Pommersfelden.
Neben den adligen Sammlern übernahmen auch schon im 17. Jahrhun-
dert vermögende Kaufleute diesen Typus der Publikation. Während das Ga-
leriewerk zur Sammlung Gerard Reynsts nur mehr als Zeugnis der bereits in
alle Winde zerschlagenen Kunstschätze diente, veranlasste in Aix en Pro-
vence Jean-Baptiste Boyer d'Aguilles, verdientes Parlamentsmitglied und
Förderer der Künste, in den neunziger Jahren ein Galeriewerk seiner
Sammlung mit über hundert Kupferstichen für seinen Freundeskreis, das
weitläufig vor allem durch Pierre-Jean Mariettes Neuauflage 1744 bekannt
wurde.262 Im Folgenden sollen diese unterschiedlichen Ausprägungen des
Galeriewerks näher vorgestellt werden.
260 Vgl. Kap. 5.1.1.
261 Vgl. Kap. 6.4.
262 Vgl. Kap. 6.1.