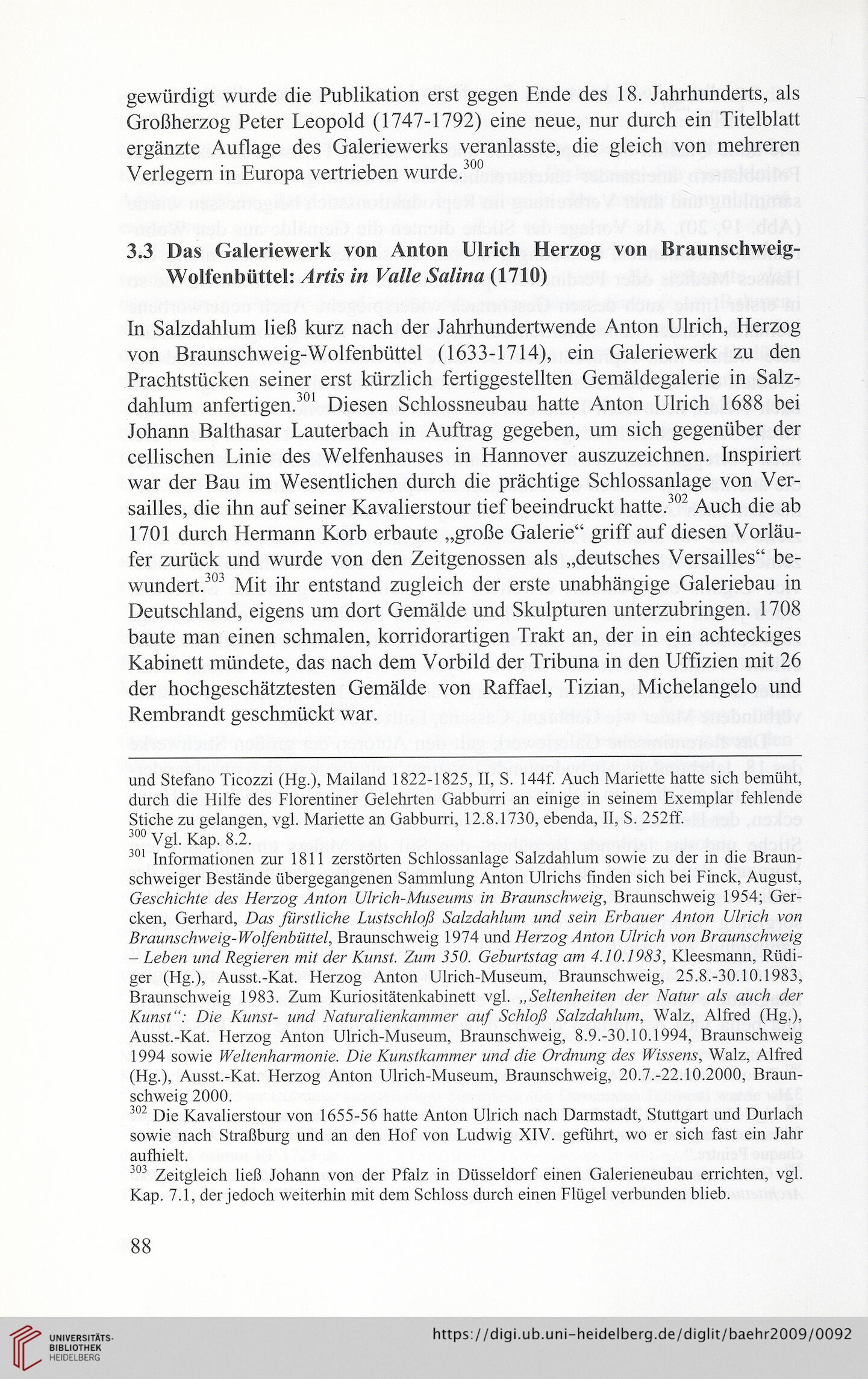gewürdigt wurde die Publikation erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts, als
Großherzog Peter Leopold (1747-1792) eine neue, nur durch ein Titelblatt
ergänzte Auflage des Galeriewerks veranlasste, die gleich von mehreren
Verlegern in Europa vertrieben wurde.3()()
3.3 Das Galeriewerk von Anton Ulrich Herzog von Braunschweig-
Wolfenbüttel: Artis in Valle Salina (1710)
In Salzdahlum ließ kurz nach der Jahrhundertwende Anton Ulrich, Herzog
von Braunschweig-Wolfenbüttel (1633-1714), ein Galeriewerk zu den
Prachtstücken seiner erst kürzlich fertiggestellten Gemäldegalerie in Salz-
dahlum anfertigen.3'" Diesen Schlossneubau hatte Anton Ulrich 1688 bei
Johann Balthasar Lauterbach in Auftrag gegeben, um sich gegenüber der
cellischen Linie des Weifenhauses in Hannover auszuzeichnen. Inspiriert
war der Bau im Wesentlichen durch die prächtige Schlossanlage von Ver-
sailles, die ihn auf seiner Kavalierstour tief beeindruckt hatte.3"2 Auch die ab
1701 durch Hermann Korb erbaute „große Galerie" griff auf diesen Vorläu-
fer zurück und wurde von den Zeitgenossen als „deutsches Versailles" be-
wundert.303 Mit ihr entstand zugleich der erste unabhängige Galeriebau in
Deutschland, eigens um dort Gemälde und Skulpturen unterzubringen. 1708
baute man einen schmalen, korridorartigen Trakt an, der in ein achteckiges
Kabinett mündete, das nach dem Vorbild der Tribuna in den Uffizien mit 26
der hochgeschätztesten Gemälde von Raffael, Tizian, Michelangelo und
Rembrandt geschmückt war.
und Stefano Ticozzi (Hg.), Mailand 1822-1825, II, S. 144f. Auch Mariette hatte sich bemüht,
durch die Hilfe des Florentiner Gelehrten Gabburri an einige in seinem Exemplar fehlende
Stiche zu gelangen, vgl. Mariette an Gabburri, 12.8.1730, ebenda, II, S. 252ff.
300 Vgl. Kap. 8.2.
°°' Informationen zur 1811 zerstörten Schlossanlage Salzdahlum sowie zu der in die Braun-
schweiger Bestände übergegangenen Sammlung Anton Ulrichs finden sich bei Finck, August,
Geschichte des Herzog Anton Ulrich-Museums in Braunschweig, Braunschweig 1954; Ger-
cken, Gerhard, Das fürstliche Lustschloß Salzdahlum und sein Erbauer Anton Ulrich von
Braunschweig-Wolfenbüttel, Braunschweig 1974 und Herzog Anton Ulrich von Braunschweig
- Leben und Regieren mit der Kunst. Zum 350. Geburtstag am 4.10.1983, Kleesmann, Rüdi-
ger (Hg.), Ausst.-Kat. Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig, 25.8.-30.10.1983,
Braunschweig 1983. Zum Kuriositätenkabinett vgl. „Seltenheiten der Natur als auch der
Kunst": Die Kunst- und Naturalienkammer auf Schloß Salzdahlum, Walz, Alfred (Hg.),
Ausst.-Kat. Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig, 8.9.-30.10.1994, Braunschweig
1994 sowie Weltenharmonie. Die Kunstkammer und die Ordnung des Wissens, Walz, Alfred
(Hg.), Ausst.-Kat. Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig, 20.7.-22.10.2000, Braun-
schweig 2000.
'°2 Die Kavalierstour von 1655-56 hatte Anton Ulrich nach Darmstadt, Stuttgart und Durlach
sowie nach Straßburg und an den Hof von Ludwig XIV. geführt, wo er sich fast ein Jahr
aufhielt.
'°' Zeitgleich ließ Johann von der Pfalz in Düsseldorf einen Galerieneubau errichten, vgl.
Kap. 7.1, der jedoch weiterhin mit dem Schloss durch einen Flügel verbunden blieb.
88
Großherzog Peter Leopold (1747-1792) eine neue, nur durch ein Titelblatt
ergänzte Auflage des Galeriewerks veranlasste, die gleich von mehreren
Verlegern in Europa vertrieben wurde.3()()
3.3 Das Galeriewerk von Anton Ulrich Herzog von Braunschweig-
Wolfenbüttel: Artis in Valle Salina (1710)
In Salzdahlum ließ kurz nach der Jahrhundertwende Anton Ulrich, Herzog
von Braunschweig-Wolfenbüttel (1633-1714), ein Galeriewerk zu den
Prachtstücken seiner erst kürzlich fertiggestellten Gemäldegalerie in Salz-
dahlum anfertigen.3'" Diesen Schlossneubau hatte Anton Ulrich 1688 bei
Johann Balthasar Lauterbach in Auftrag gegeben, um sich gegenüber der
cellischen Linie des Weifenhauses in Hannover auszuzeichnen. Inspiriert
war der Bau im Wesentlichen durch die prächtige Schlossanlage von Ver-
sailles, die ihn auf seiner Kavalierstour tief beeindruckt hatte.3"2 Auch die ab
1701 durch Hermann Korb erbaute „große Galerie" griff auf diesen Vorläu-
fer zurück und wurde von den Zeitgenossen als „deutsches Versailles" be-
wundert.303 Mit ihr entstand zugleich der erste unabhängige Galeriebau in
Deutschland, eigens um dort Gemälde und Skulpturen unterzubringen. 1708
baute man einen schmalen, korridorartigen Trakt an, der in ein achteckiges
Kabinett mündete, das nach dem Vorbild der Tribuna in den Uffizien mit 26
der hochgeschätztesten Gemälde von Raffael, Tizian, Michelangelo und
Rembrandt geschmückt war.
und Stefano Ticozzi (Hg.), Mailand 1822-1825, II, S. 144f. Auch Mariette hatte sich bemüht,
durch die Hilfe des Florentiner Gelehrten Gabburri an einige in seinem Exemplar fehlende
Stiche zu gelangen, vgl. Mariette an Gabburri, 12.8.1730, ebenda, II, S. 252ff.
300 Vgl. Kap. 8.2.
°°' Informationen zur 1811 zerstörten Schlossanlage Salzdahlum sowie zu der in die Braun-
schweiger Bestände übergegangenen Sammlung Anton Ulrichs finden sich bei Finck, August,
Geschichte des Herzog Anton Ulrich-Museums in Braunschweig, Braunschweig 1954; Ger-
cken, Gerhard, Das fürstliche Lustschloß Salzdahlum und sein Erbauer Anton Ulrich von
Braunschweig-Wolfenbüttel, Braunschweig 1974 und Herzog Anton Ulrich von Braunschweig
- Leben und Regieren mit der Kunst. Zum 350. Geburtstag am 4.10.1983, Kleesmann, Rüdi-
ger (Hg.), Ausst.-Kat. Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig, 25.8.-30.10.1983,
Braunschweig 1983. Zum Kuriositätenkabinett vgl. „Seltenheiten der Natur als auch der
Kunst": Die Kunst- und Naturalienkammer auf Schloß Salzdahlum, Walz, Alfred (Hg.),
Ausst.-Kat. Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig, 8.9.-30.10.1994, Braunschweig
1994 sowie Weltenharmonie. Die Kunstkammer und die Ordnung des Wissens, Walz, Alfred
(Hg.), Ausst.-Kat. Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig, 20.7.-22.10.2000, Braun-
schweig 2000.
'°2 Die Kavalierstour von 1655-56 hatte Anton Ulrich nach Darmstadt, Stuttgart und Durlach
sowie nach Straßburg und an den Hof von Ludwig XIV. geführt, wo er sich fast ein Jahr
aufhielt.
'°' Zeitgleich ließ Johann von der Pfalz in Düsseldorf einen Galerieneubau errichten, vgl.
Kap. 7.1, der jedoch weiterhin mit dem Schloss durch einen Flügel verbunden blieb.
88