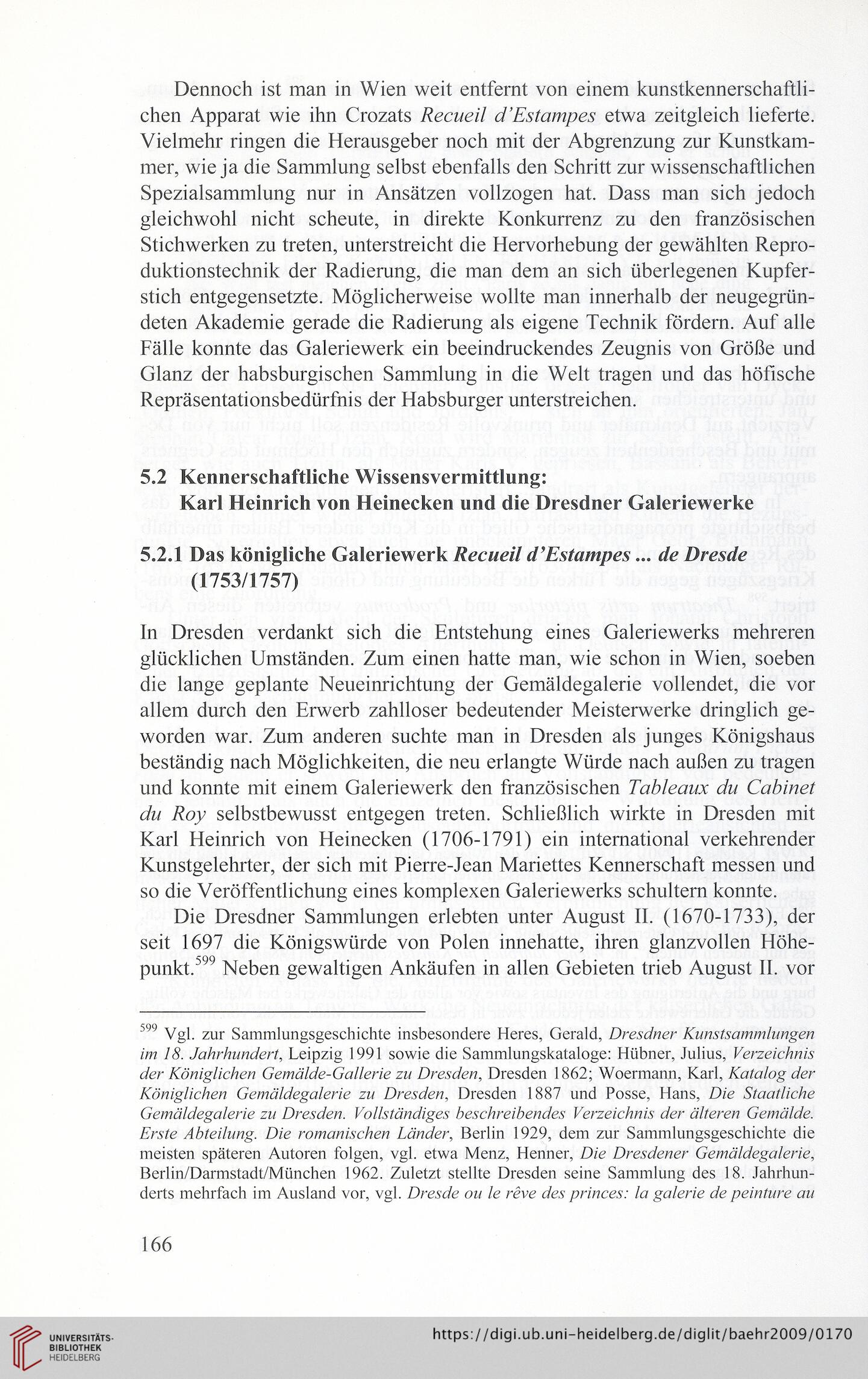Dennoch ist man in Wien weit entfernt von einem kunstkennerschaftli-
chen Apparat wie ihn Crozats Recueil d'Estampes etwa zeitgleich lieferte.
Vielmehr ringen die Herausgeber noch mit der Abgrenzung zur Kunstkam-
mer, wie ja die Sammlung selbst ebenfalls den Schritt zur wissenschaftlichen
Spezialsammlung nur in Ansätzen vollzogen hat. Dass man sich jedoch
gleichwohl nicht scheute, in direkte Konkurrenz zu den französischen
Stichwerken zu treten, unterstreicht die Hervorhebung der gewählten Repro-
duktionstechnik der Radierung, die man dem an sich überlegenen Kupfer-
stich entgegensetzte. Möglicherweise wollte man innerhalb der neugegrün-
deten Akademie gerade die Radierung als eigene Technik fördern. Auf alle
Fälle konnte das Galeriewerk ein beeindruckendes Zeugnis von Größe und
Glanz der habsburgischen Sammlung in die Welt tragen und das höfische
Repräsentationsbedürfnis der Habsburger unterstreichen.
5.2 Kennerschaftliche Wissensvermittlung:
Karl Heinrich von Heinecken und die Dresdner Galeriewerke
5 .2.1 Das königliche Galeriewerk Recueil d'Estampes ... de Dresde
(1753/1757)
In Dresden verdankt sich die Entstehung eines Galeriewerks mehreren
glücklichen Umständen. Zum einen hatte man, wie schon in Wien, soeben
die lange geplante Neueinrichtung der Gemäldegalerie vollendet, die vor
allem durch den Erwerb zahlloser bedeutender Meisterwerke dringlich ge-
worden war. Zum anderen suchte man in Dresden als junges Königshaus
beständig nach Möglichkeiten, die neu erlangte Würde nach außen zu tragen
und konnte mit einem Galeriewerk den französischen Tableaux du Cabinet
du Roy selbstbewusst entgegen treten. Schließlich wirkte in Dresden mit
Karl Heinrich von Heinecken (1706-1791) ein international verkehrender
Kunstgelehrter, der sich mit Pierre-Jean Mariettes Kennerschaft messen und
so die Veröffentlichung eines komplexen Galeriewerks schultern konnte.
Die Dresdner Sammlungen erlebten unter August 11. (1670-1733), der
seit 1697 die Königswürde von Polen innehatte, ihren glanzvollen Höhe-
punkt.'99 Neben gewaltigen Ankäufen in allen Gebieten trieb August II. vor
599 Vgl. zur Sammlungsgeschichte insbesondere Heres, Gerald, Dresdner Kunstsammlungen
im 18. Jahrhundert, Leipzig 1991 sowie die Sammlungskataloge: Hübner, Julius, Verzeichnis
der Königlichen Gemälde-Gallerie zu Dresden, Dresden 1862; Woermann, Karl, Katalog der
Königlichen Gemäldegalerie zu Dresden, Dresden 1887 und Posse, Hans, Die Staatliche
Gemäldegalerie zu Dresden. Vollständiges beschreibendes Verzeichnis der älteren Gemälde.
Erste Abteilung. Die romanischen Länder, Berlin 1929, dem zur Sammlungsgeschichte die
meisten späteren Autoren folgen, vgl. etwa Menz, Henner, Die Dresdener Gemäldegalerie,
Berlin/Darmstadt/München 1962. Zuletzt stellte Dresden seine Sammlung des 18. Jahrhun-
derts mehrfach im Ausland vor, vgl. Dresde ou le reve des princes: la galerie de peinture au
166
chen Apparat wie ihn Crozats Recueil d'Estampes etwa zeitgleich lieferte.
Vielmehr ringen die Herausgeber noch mit der Abgrenzung zur Kunstkam-
mer, wie ja die Sammlung selbst ebenfalls den Schritt zur wissenschaftlichen
Spezialsammlung nur in Ansätzen vollzogen hat. Dass man sich jedoch
gleichwohl nicht scheute, in direkte Konkurrenz zu den französischen
Stichwerken zu treten, unterstreicht die Hervorhebung der gewählten Repro-
duktionstechnik der Radierung, die man dem an sich überlegenen Kupfer-
stich entgegensetzte. Möglicherweise wollte man innerhalb der neugegrün-
deten Akademie gerade die Radierung als eigene Technik fördern. Auf alle
Fälle konnte das Galeriewerk ein beeindruckendes Zeugnis von Größe und
Glanz der habsburgischen Sammlung in die Welt tragen und das höfische
Repräsentationsbedürfnis der Habsburger unterstreichen.
5.2 Kennerschaftliche Wissensvermittlung:
Karl Heinrich von Heinecken und die Dresdner Galeriewerke
5 .2.1 Das königliche Galeriewerk Recueil d'Estampes ... de Dresde
(1753/1757)
In Dresden verdankt sich die Entstehung eines Galeriewerks mehreren
glücklichen Umständen. Zum einen hatte man, wie schon in Wien, soeben
die lange geplante Neueinrichtung der Gemäldegalerie vollendet, die vor
allem durch den Erwerb zahlloser bedeutender Meisterwerke dringlich ge-
worden war. Zum anderen suchte man in Dresden als junges Königshaus
beständig nach Möglichkeiten, die neu erlangte Würde nach außen zu tragen
und konnte mit einem Galeriewerk den französischen Tableaux du Cabinet
du Roy selbstbewusst entgegen treten. Schließlich wirkte in Dresden mit
Karl Heinrich von Heinecken (1706-1791) ein international verkehrender
Kunstgelehrter, der sich mit Pierre-Jean Mariettes Kennerschaft messen und
so die Veröffentlichung eines komplexen Galeriewerks schultern konnte.
Die Dresdner Sammlungen erlebten unter August 11. (1670-1733), der
seit 1697 die Königswürde von Polen innehatte, ihren glanzvollen Höhe-
punkt.'99 Neben gewaltigen Ankäufen in allen Gebieten trieb August II. vor
599 Vgl. zur Sammlungsgeschichte insbesondere Heres, Gerald, Dresdner Kunstsammlungen
im 18. Jahrhundert, Leipzig 1991 sowie die Sammlungskataloge: Hübner, Julius, Verzeichnis
der Königlichen Gemälde-Gallerie zu Dresden, Dresden 1862; Woermann, Karl, Katalog der
Königlichen Gemäldegalerie zu Dresden, Dresden 1887 und Posse, Hans, Die Staatliche
Gemäldegalerie zu Dresden. Vollständiges beschreibendes Verzeichnis der älteren Gemälde.
Erste Abteilung. Die romanischen Länder, Berlin 1929, dem zur Sammlungsgeschichte die
meisten späteren Autoren folgen, vgl. etwa Menz, Henner, Die Dresdener Gemäldegalerie,
Berlin/Darmstadt/München 1962. Zuletzt stellte Dresden seine Sammlung des 18. Jahrhun-
derts mehrfach im Ausland vor, vgl. Dresde ou le reve des princes: la galerie de peinture au
166