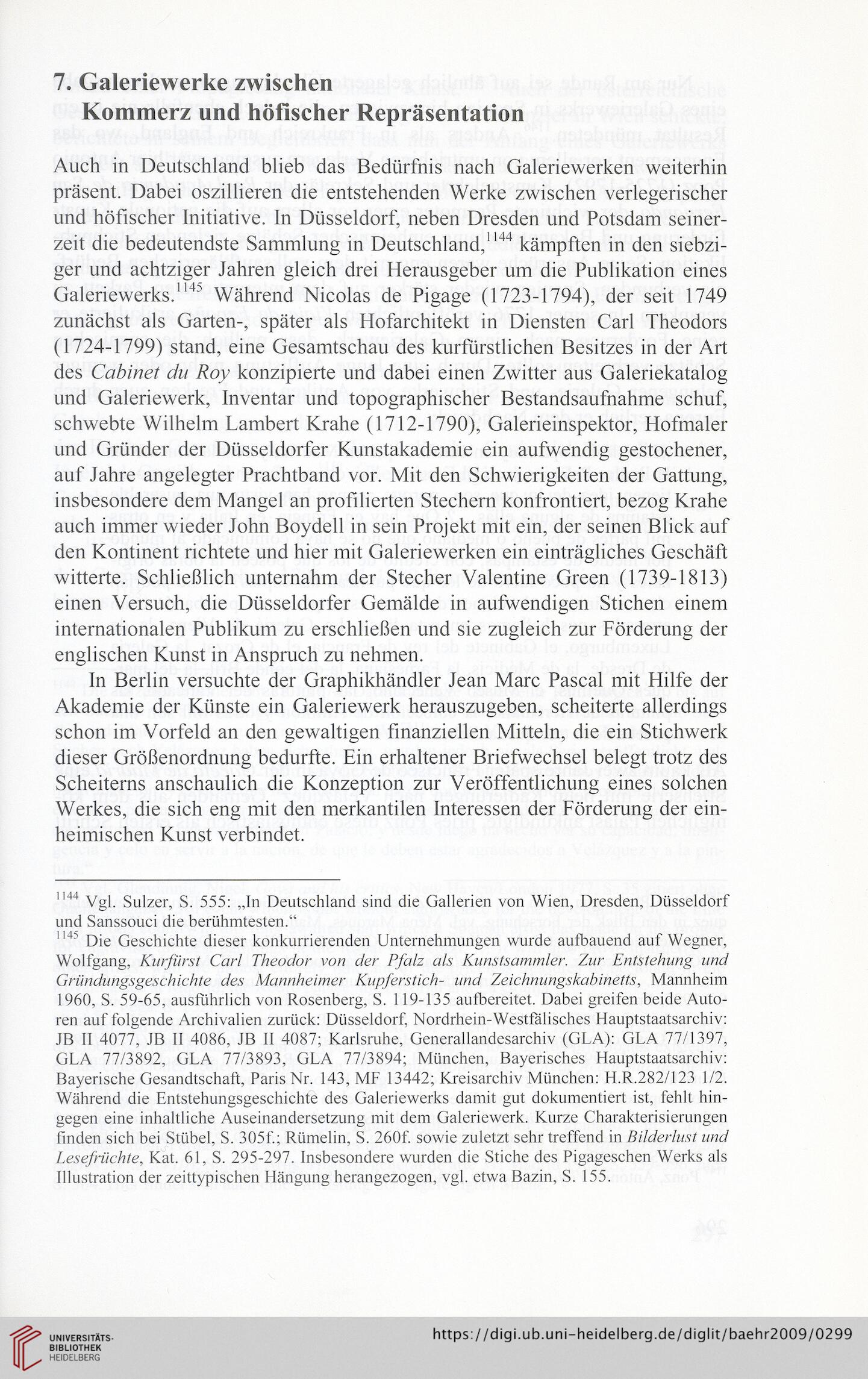7. Galeriewerke zwischen
Kommerz und höfischer Repräsentation
Auch in Deutschland blieb das Bedürfnis nach Galeriewerken weiterhin
präsent. Dabei oszillieren die entstehenden Werke zwischen verlegerischer
und höfischer Initiative. In Düsseldorf, neben Dresden und Potsdam seiner-
zeit die bedeutendste Sammlung in Deutschland,"44 kämpften in den siebzi-
ger und achtziger Jahren gleich drei Herausgeber um die Publikation eines
Galeriewerks."4' Während Nicolas de Pigage (1723-1794), der seit 1749
zunächst als Garten-, später als Hofarchitekt in Diensten Carl Theodors
(1724-1799) stand, eine Gesamtschau des kurfürstlichen Besitzes in der Art
des Cabinet du Roy konzipierte und dabei einen Zwitter aus Galeriekatalog
und Galeriewerk, Inventar und topographischer Bestandsaufnahme schuf,
schwebte Wilhelm Lambert Krahe (1712-1790), Galerieinspektor, Hofmaler
und Gründer der Düsseldorfer Kunstakademie ein aufwendig gestochener,
auf Jahre angelegter Prachtband vor. Mit den Schwierigkeiten der Gattung,
insbesondere dem Mangel an profilierten Stechern konfrontiert, bezog Krahe
auch immer wieder John Boydell in sein Projekt mit ein, der seinen Blick auf
den Kontinent richtete und hier mit Galeriewerken ein einträgliches Geschäft
witterte. Schließlich unternahm der Stecher Valentine Green (1739-1813)
einen Versuch, die Düsseldorfer Gemälde in aufwendigen Stichen einem
internationalen Publikum zu erschließen und sie zugleich zur Förderung der
englischen Kunst in Anspruch zu nehmen.
In Berlin versuchte der Graphikhändler Jean Marc Pascal mit Hilfe der
Akademie der Künste ein Galeriewerk herauszugeben, scheiterte allerdings
schon im Vorfeld an den gewaltigen finanziellen Mitteln, die ein Stichwerk
dieser Größenordnung bedurfte. Ein erhaltener Briefwechsel belegt trotz des
Scheiterns anschaulich die Konzeption zur Veröffentlichung eines solchen
Werkes, die sich eng mit den merkantilen Interessen der Förderung der ein-
heimischen Kunst verbindet.
1144 Vgl. Sulzer, S. 555: „In Deutschland sind die Gallerien von Wien, Dresden, Düsseldorf
und Sanssouci die berühmtesten."
1145 Die Geschichte dieser konkurrierenden Unternehmungen wurde aufbauend auf Wegner,
Wolfgang, Kurfürst Carl Theodor von der Pfalz als Kunstsammler. Zur Entstehung und
Gründungsgeschichte des Mannheimer Kupferstich- und Zeichnungskabinetts, Mannheim
1960, S. 59-65, ausführlich von Rosenberg, S. 119-135 aufbereitet. Dabei greifen beide Auto-
ren auf folgende Archivalien zurück: Düsseldorf, Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv:
JB II 4077, JB II 4086, JB II 4087; Karlsruhe, Generallandesarchiv (GLA): GLA 77/1397,
GLA 77/3892, GLA 77/3893, GLA 77/3894; München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv:
Bayerische Gesandtschaft, Paris Nr. 143, MF 13442; Kreisarchiv München: H.R.282/123 1/2.
Während die Entstehungsgeschichte des Galeriewerks damit gut dokumentiert ist, fehlt hin-
gegen eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Galeriewerk. Kurze Charakterisierungen
finden sich bei Stübel, S. 305f.; Rümelin, S. 260f. sowie zuletzt sehr treffend in Bilderlust und
Lesefrüchte, Kat. 61, S. 295-297. Insbesondere wurden die Stiche des Pigageschen Werks als
Illustration der zeittypischen Hängung herangezogen, vgl. etwa Bazin, S. 155.
Kommerz und höfischer Repräsentation
Auch in Deutschland blieb das Bedürfnis nach Galeriewerken weiterhin
präsent. Dabei oszillieren die entstehenden Werke zwischen verlegerischer
und höfischer Initiative. In Düsseldorf, neben Dresden und Potsdam seiner-
zeit die bedeutendste Sammlung in Deutschland,"44 kämpften in den siebzi-
ger und achtziger Jahren gleich drei Herausgeber um die Publikation eines
Galeriewerks."4' Während Nicolas de Pigage (1723-1794), der seit 1749
zunächst als Garten-, später als Hofarchitekt in Diensten Carl Theodors
(1724-1799) stand, eine Gesamtschau des kurfürstlichen Besitzes in der Art
des Cabinet du Roy konzipierte und dabei einen Zwitter aus Galeriekatalog
und Galeriewerk, Inventar und topographischer Bestandsaufnahme schuf,
schwebte Wilhelm Lambert Krahe (1712-1790), Galerieinspektor, Hofmaler
und Gründer der Düsseldorfer Kunstakademie ein aufwendig gestochener,
auf Jahre angelegter Prachtband vor. Mit den Schwierigkeiten der Gattung,
insbesondere dem Mangel an profilierten Stechern konfrontiert, bezog Krahe
auch immer wieder John Boydell in sein Projekt mit ein, der seinen Blick auf
den Kontinent richtete und hier mit Galeriewerken ein einträgliches Geschäft
witterte. Schließlich unternahm der Stecher Valentine Green (1739-1813)
einen Versuch, die Düsseldorfer Gemälde in aufwendigen Stichen einem
internationalen Publikum zu erschließen und sie zugleich zur Förderung der
englischen Kunst in Anspruch zu nehmen.
In Berlin versuchte der Graphikhändler Jean Marc Pascal mit Hilfe der
Akademie der Künste ein Galeriewerk herauszugeben, scheiterte allerdings
schon im Vorfeld an den gewaltigen finanziellen Mitteln, die ein Stichwerk
dieser Größenordnung bedurfte. Ein erhaltener Briefwechsel belegt trotz des
Scheiterns anschaulich die Konzeption zur Veröffentlichung eines solchen
Werkes, die sich eng mit den merkantilen Interessen der Förderung der ein-
heimischen Kunst verbindet.
1144 Vgl. Sulzer, S. 555: „In Deutschland sind die Gallerien von Wien, Dresden, Düsseldorf
und Sanssouci die berühmtesten."
1145 Die Geschichte dieser konkurrierenden Unternehmungen wurde aufbauend auf Wegner,
Wolfgang, Kurfürst Carl Theodor von der Pfalz als Kunstsammler. Zur Entstehung und
Gründungsgeschichte des Mannheimer Kupferstich- und Zeichnungskabinetts, Mannheim
1960, S. 59-65, ausführlich von Rosenberg, S. 119-135 aufbereitet. Dabei greifen beide Auto-
ren auf folgende Archivalien zurück: Düsseldorf, Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv:
JB II 4077, JB II 4086, JB II 4087; Karlsruhe, Generallandesarchiv (GLA): GLA 77/1397,
GLA 77/3892, GLA 77/3893, GLA 77/3894; München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv:
Bayerische Gesandtschaft, Paris Nr. 143, MF 13442; Kreisarchiv München: H.R.282/123 1/2.
Während die Entstehungsgeschichte des Galeriewerks damit gut dokumentiert ist, fehlt hin-
gegen eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Galeriewerk. Kurze Charakterisierungen
finden sich bei Stübel, S. 305f.; Rümelin, S. 260f. sowie zuletzt sehr treffend in Bilderlust und
Lesefrüchte, Kat. 61, S. 295-297. Insbesondere wurden die Stiche des Pigageschen Werks als
Illustration der zeittypischen Hängung herangezogen, vgl. etwa Bazin, S. 155.