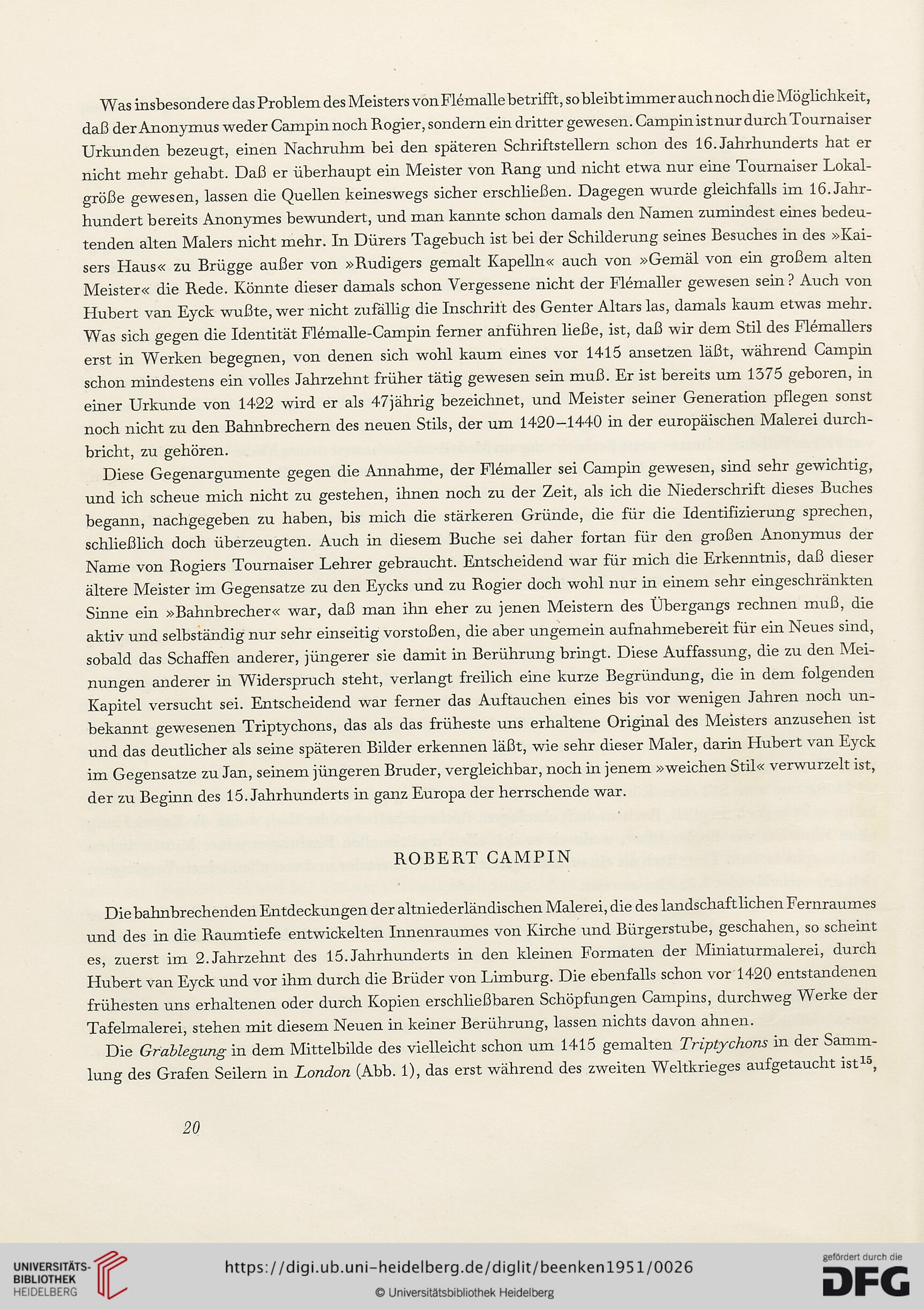W as insbesondere das Problem des Meisters von Flemalle betrifft, so bleibt immer auch noch die Möglichkeit,
daß der Anonymus weder Campinnoch Rogier, sondern ein dritter gewesen. Campinistnur durch Tournaiser
Urkunden bezeugt, einen Nachruhm bei den späteren Schriftstellern schon des 16. Jahrhunderts hat er
nicht mehr gehabt. Daß er überhaupt ein Meister von Rang und nicht etwa nur eine Tournaiser Lokal-
größe gewesen, lassen die Quellen keineswegs sicher erschließen. Dagegen wurde gleichfalls im 16. Jahr-
hundert bereits Anonymes bewundert, und man kannte schon damals den Namen zumindest eines bedeu-
tenden alten Malers nicht mehr. In Dürers Tagebuch ist bei der Schilderung seines Besuches in des »Kai-
sers Haus« zu Brügge außer von »Rüdigers gemalt Kapelln« auch von »Gemäl von ein großem alten
Meister« die Rede. Könnte dieser damals schon Vergessene nicht der Flemaller gewesen sein ? Auch von
Hubert van Eyck wußte, wer nicht zufällig die Inschrift des Genter Altars las, damals kaum etwas mehr.
Was sich gegen die Identität Flemalle-Campin ferner anführen ließe, ist, daß wir dem Stil des Flemallers
erst in Werken begegnen, von denen sich wohl kaum eines vor 1415 ansetzen läßt, während Campin
schon mindestens ein volles Jahrzehnt früher tätig gewesen sein muß. Er ist bereits um 1375 geboren, in
einer Urkunde von 1422 wird er als 47jährig bezeichnet, und Meister seiner Generation pflegen sonst
noch nicht zu den Bahnbrechern des neuen Stils, der um 1420-1440 in der europäischen Malerei durch-
bricht, zu gehören.
Diese Gegenargumente gegen die Annahme, der Flemaller sei Campin gewesen, sind sehr gewichtig,
und ich scheue mich nicht zu gestehen, ihnen noch zu der Zeit, als ich die Niederschrift dieses Buches
begann, nachgegeben zu haben, bis mich die stärkeren Gründe, die für die Identifizierung sprechen,
schließlich doch überzeugten. Auch in diesem Buche sei daher fortan für den großen Anonymus der
Name von Rogiers Tournaiser Lehrer gebraucht. Entscheidend war für mich die Erkenntnis, daß dieser
ältere Meister im Gegensätze zu den Eycks und zu Rogier doch wohl nur in einem sehr eingeschränkten
Sinne ein »Bahnbrecher« war, daß man ihn eher zu jenen Meistern des Übergangs rechnen muß, die
aktiv und selbständig nur sehr einseitig vorstoßen, die aber ungemein aufnahmebereit für ein Neues sind,
sobald das Schaffen anderer, jüngerer sie damit in Berührung bringt. Diese Auffassung, die zu den Mei-
nungen anderer in Widerspruch steht, verlangt freilich eine kurze Begründung, die in dem folgenden
Kapitel versucht sei. Entscheidend war ferner das Auftauchen eines bis vor wenigen Jahren noch un-
bekannt gewesenen Triptychons, das als das früheste uns erhaltene Original des Meisters anzusehen ist
und das deutlicher als seine späteren Bilder erkennen läßt, wie sehr dieser Maler, darin Hubert van Eyck
im Gegensätze zu Jan, seinem jüngeren Bruder, vergleichbar, noch in jenem »weichen Stil« verwurzelt ist,
der zu Beginn des 15. Jahrhunderts in ganz Europa der herrschende war.
ROBERT CAMPIN
Die bahnbrechenden Entdeckungen der altniederländischen Malerei, die des landschaftlichen Fernraumes
und des in die Raumtiefe entwickelten Innenraumes von Kirche und Bürgerstube, geschahen, so scheint
es, zuerst im 2. Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts in den kleinen Formaten der Miniaturmalerei, durch
Hubert van Eyck und vor ihm durch die Brüder von Limburg. Die ebenfalls schon vor 1420 entstandenen
frühesten uns erhaltenen oder durch Kopien erschließbaren Schöpfungen Campins, durchweg Werke der
Tafelmalerei, stehen mit diesem Neuen in keiner Berührung, lassen nichts davon ahnen.
Die Grablegung in dem Mittelbilde des vielleicht schon um 1415 gemalten Triptychons in der Samm-
lung des Grafen Seilern in London (Abb. 1), das erst während des zweiten Weltkrieges aufgetaucht ist15,
20
daß der Anonymus weder Campinnoch Rogier, sondern ein dritter gewesen. Campinistnur durch Tournaiser
Urkunden bezeugt, einen Nachruhm bei den späteren Schriftstellern schon des 16. Jahrhunderts hat er
nicht mehr gehabt. Daß er überhaupt ein Meister von Rang und nicht etwa nur eine Tournaiser Lokal-
größe gewesen, lassen die Quellen keineswegs sicher erschließen. Dagegen wurde gleichfalls im 16. Jahr-
hundert bereits Anonymes bewundert, und man kannte schon damals den Namen zumindest eines bedeu-
tenden alten Malers nicht mehr. In Dürers Tagebuch ist bei der Schilderung seines Besuches in des »Kai-
sers Haus« zu Brügge außer von »Rüdigers gemalt Kapelln« auch von »Gemäl von ein großem alten
Meister« die Rede. Könnte dieser damals schon Vergessene nicht der Flemaller gewesen sein ? Auch von
Hubert van Eyck wußte, wer nicht zufällig die Inschrift des Genter Altars las, damals kaum etwas mehr.
Was sich gegen die Identität Flemalle-Campin ferner anführen ließe, ist, daß wir dem Stil des Flemallers
erst in Werken begegnen, von denen sich wohl kaum eines vor 1415 ansetzen läßt, während Campin
schon mindestens ein volles Jahrzehnt früher tätig gewesen sein muß. Er ist bereits um 1375 geboren, in
einer Urkunde von 1422 wird er als 47jährig bezeichnet, und Meister seiner Generation pflegen sonst
noch nicht zu den Bahnbrechern des neuen Stils, der um 1420-1440 in der europäischen Malerei durch-
bricht, zu gehören.
Diese Gegenargumente gegen die Annahme, der Flemaller sei Campin gewesen, sind sehr gewichtig,
und ich scheue mich nicht zu gestehen, ihnen noch zu der Zeit, als ich die Niederschrift dieses Buches
begann, nachgegeben zu haben, bis mich die stärkeren Gründe, die für die Identifizierung sprechen,
schließlich doch überzeugten. Auch in diesem Buche sei daher fortan für den großen Anonymus der
Name von Rogiers Tournaiser Lehrer gebraucht. Entscheidend war für mich die Erkenntnis, daß dieser
ältere Meister im Gegensätze zu den Eycks und zu Rogier doch wohl nur in einem sehr eingeschränkten
Sinne ein »Bahnbrecher« war, daß man ihn eher zu jenen Meistern des Übergangs rechnen muß, die
aktiv und selbständig nur sehr einseitig vorstoßen, die aber ungemein aufnahmebereit für ein Neues sind,
sobald das Schaffen anderer, jüngerer sie damit in Berührung bringt. Diese Auffassung, die zu den Mei-
nungen anderer in Widerspruch steht, verlangt freilich eine kurze Begründung, die in dem folgenden
Kapitel versucht sei. Entscheidend war ferner das Auftauchen eines bis vor wenigen Jahren noch un-
bekannt gewesenen Triptychons, das als das früheste uns erhaltene Original des Meisters anzusehen ist
und das deutlicher als seine späteren Bilder erkennen läßt, wie sehr dieser Maler, darin Hubert van Eyck
im Gegensätze zu Jan, seinem jüngeren Bruder, vergleichbar, noch in jenem »weichen Stil« verwurzelt ist,
der zu Beginn des 15. Jahrhunderts in ganz Europa der herrschende war.
ROBERT CAMPIN
Die bahnbrechenden Entdeckungen der altniederländischen Malerei, die des landschaftlichen Fernraumes
und des in die Raumtiefe entwickelten Innenraumes von Kirche und Bürgerstube, geschahen, so scheint
es, zuerst im 2. Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts in den kleinen Formaten der Miniaturmalerei, durch
Hubert van Eyck und vor ihm durch die Brüder von Limburg. Die ebenfalls schon vor 1420 entstandenen
frühesten uns erhaltenen oder durch Kopien erschließbaren Schöpfungen Campins, durchweg Werke der
Tafelmalerei, stehen mit diesem Neuen in keiner Berührung, lassen nichts davon ahnen.
Die Grablegung in dem Mittelbilde des vielleicht schon um 1415 gemalten Triptychons in der Samm-
lung des Grafen Seilern in London (Abb. 1), das erst während des zweiten Weltkrieges aufgetaucht ist15,
20