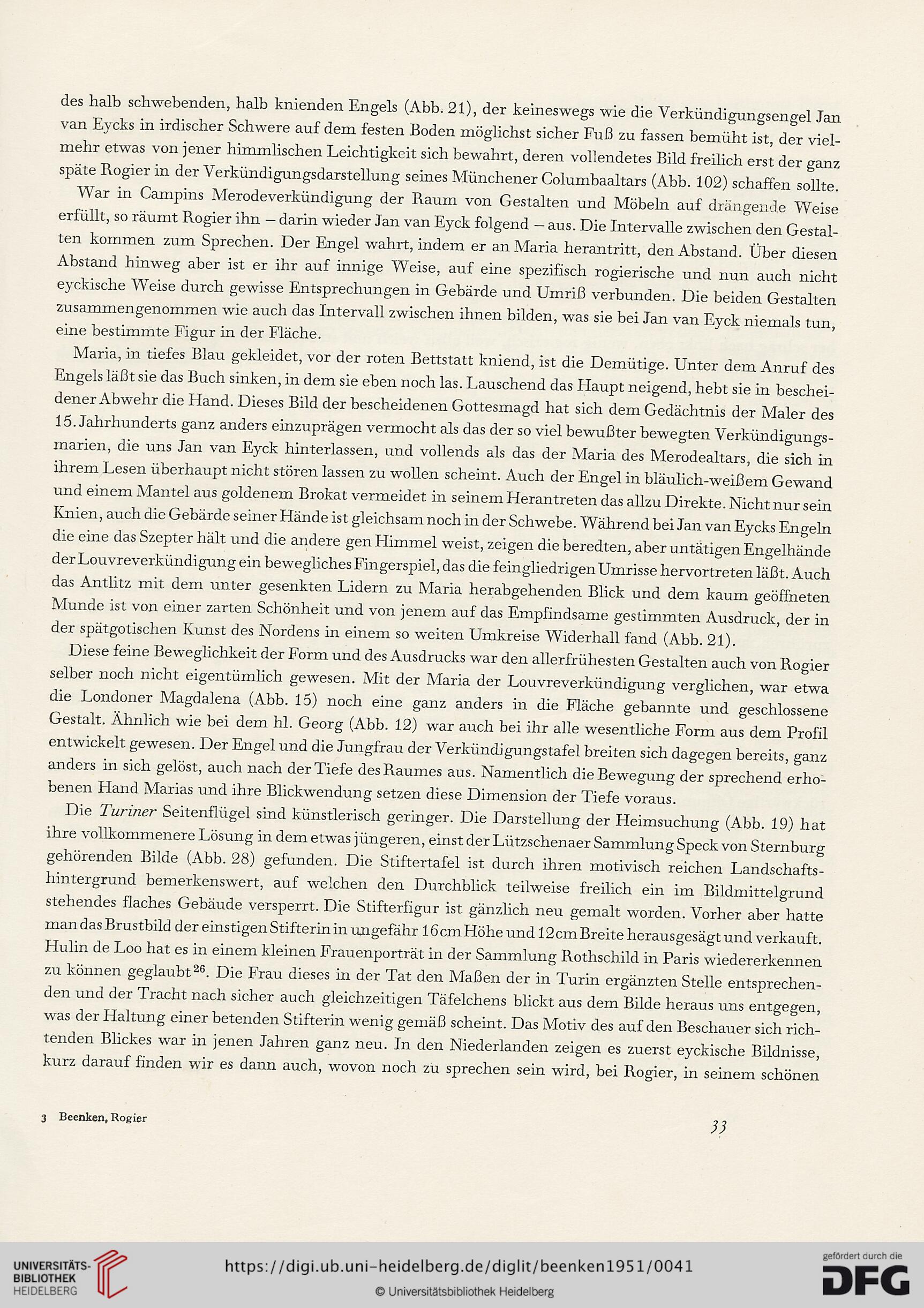des halb schwebenden, halb knienden Engels (Abb. 21), der keineswegs wie die Verkündigungsengel Jan
van Eycks in irdischer Schwere auf dem festen Boden möglichst sicher Fuß zu fassen bemüht ist, der viel-
mehr etwas von jener himmlischen Leichtigkeit sich bewahrt, deren vollendetes Bild freilich erst der ganz
späte Rogier in der Verkündigungsdarstellung seines Münchener Columbaaltars (Abb. 102) schaffen sollte.
War in Campins Merodeverkündigung der Raum von Gestalten und Möbeln auf drängende Weise
erfüllt, so räumt Rogier ihn — darin wieder Jan van Eyck folgend — aus. Die Intervalle zwischen den Gestal-
ten kommen zum Sprechen. Der Engel wahrt, indem er an Maria herantritt, den Abstand. Über diesen
Abstand hinweg aber ist er ihr auf innige Weise, auf eine spezifisch rogierische und nun auch nicht
eyckische Weise durch gewisse Entsprechungen in Gebärde und Umriß verbunden. Die beiden Gestalten
zusammengenommen wie auch das Intervall zwischen ihnen bilden, was sie bei Jan van Eyck niemals tun,
eine bestimmte Figur in der Fläche.
Maria, in tiefes Blau gekleidet, vor der roten Bettstatt kniend, ist die Demütige. Unter dem Anruf des
Engels läßt sie das Buch sinken, in dem sie eben noch las. Lauschend das Haupt neigend, hebt sie in beschei-
dener Abwehr die Hand. Dieses Bild der bescheidenen Gottesmagd hat sich dem Gedächtnis der Maler des
15. Jahrhunderts ganz anders einzuprägen vermocht als das der so viel bewußter bewegten Verkündigungs-
märien, die uns Jan van Eyck hinterlassen, und vollends als das der Maria des Merodealtars, die sich in
ihrem Lesen überhaupt nicht stören lassen zu wollen scheint. Auch der Engel in bläulich-weißem Gewand
und einem Mantel aus goldenem Brokat vermeidet in seinem Fierantreten das allzu Direkte. Nicht nur sein
Knien, auch die Gebärde seiner Hände ist gleichsam noch in der Schwebe. Während bei Jan van Eycks Engeln
die eine das Szepter hält und die andere gen Flimmel weist, zeigen die beredten, aber untätigen Engelhände
der Louvreverkündigung ein bewegliches Fingerspiel, das die feingliedrigen Umrisse hervortreten läßt. Auch
das Antlitz mit dem unter gesenkten Lidern zu Maria herabgehenden Blick und dem kaum geöffneten
Munde ist von einer zarten Schönheit und von jenem auf das Empfindsame gestimmten Ausdruck, der in
der spätgotischen Kunst des Nordens in einem so weiten Umkreise Widerhall fand (Abb. 21).
Diese feine Beweglichkeit der Form und des Ausdrucks war den allerfrühesten Gestalten auch von Rogier
selber noch nicht eigentümlich gewesen. Mit der Maria der Louvreverkündigung verglichen, war etwa
die Londoner Magdalena (Abb. 15) noch eine ganz anders in die Fläche gebannte und geschlossene
Gestalt. Ähnlich wie bei dem hl. Georg (Abb. 12) war auch bei ihr alle wesentliche Form aus dem Profil
entwickelt gewesen. Der Engel und die Jungfrau der Verkündigungstafel breiten sich dagegen bereits, ganz
anders in sich gelöst, auch nach der Tiefe des Raumes aus. Namentlich die Bewegung der sprechend erho-
benen Hand Marias und ihre Blickwendung setzen diese Dimension der Tiefe voraus.
Die Turiner Seitenflügel sind künstlerisch geringer. Die Darstellung der Heimsuchung (Abb. 19) hat
ihre vollkommenere Lösung in dem etwas jüngeren, einst der Lützschenaer Sammlung Speck von Sternburg
gehörenden Bilde (Abb. 28) gefunden. Die Stiftertafel ist durch ihren motivisch reichen Landschafts-
hintergrund bemerkenswert, auf welchen den Durchblick teilweise freilich ein im Bildmittelgrund
stehendes flaches Gebäude versperrt. Die Stifterfigur ist gänzlich neu gemalt worden. Vorher aber hatte
man das Brustbild der einstigen Stifterin in ungefähr 16 cm Höhe und 12 cm Breite herausgesägt und verkauft.
Hulin de Loo hat es in einem kleinen Frauenporträt in der Sammlung Rothschild in Paris wiedererkennen
zu können geglaubt26. Die Frau dieses in der Tat den Maßen der in Turin ergänzten Stelle entsprechen-
den und der Tracht nach sicher auch gleichzeitigen Täfelchens blickt aus dem Bilde heraus uns entgegen,
was der Haltung einer betenden Stifterin wenig gemäß scheint. Das Motiv des auf den Beschauer sich rich-
tenden Blickes war in jenen Jahren ganz neu. In den Niederlanden zeigen es zuerst eyckische Bildnisse,
kurz darauf finden wir es dann auch, wovon noch zu sprechen sein wird, bei Rogier, in seinem schönen
3 Beenken, Rogier
van Eycks in irdischer Schwere auf dem festen Boden möglichst sicher Fuß zu fassen bemüht ist, der viel-
mehr etwas von jener himmlischen Leichtigkeit sich bewahrt, deren vollendetes Bild freilich erst der ganz
späte Rogier in der Verkündigungsdarstellung seines Münchener Columbaaltars (Abb. 102) schaffen sollte.
War in Campins Merodeverkündigung der Raum von Gestalten und Möbeln auf drängende Weise
erfüllt, so räumt Rogier ihn — darin wieder Jan van Eyck folgend — aus. Die Intervalle zwischen den Gestal-
ten kommen zum Sprechen. Der Engel wahrt, indem er an Maria herantritt, den Abstand. Über diesen
Abstand hinweg aber ist er ihr auf innige Weise, auf eine spezifisch rogierische und nun auch nicht
eyckische Weise durch gewisse Entsprechungen in Gebärde und Umriß verbunden. Die beiden Gestalten
zusammengenommen wie auch das Intervall zwischen ihnen bilden, was sie bei Jan van Eyck niemals tun,
eine bestimmte Figur in der Fläche.
Maria, in tiefes Blau gekleidet, vor der roten Bettstatt kniend, ist die Demütige. Unter dem Anruf des
Engels läßt sie das Buch sinken, in dem sie eben noch las. Lauschend das Haupt neigend, hebt sie in beschei-
dener Abwehr die Hand. Dieses Bild der bescheidenen Gottesmagd hat sich dem Gedächtnis der Maler des
15. Jahrhunderts ganz anders einzuprägen vermocht als das der so viel bewußter bewegten Verkündigungs-
märien, die uns Jan van Eyck hinterlassen, und vollends als das der Maria des Merodealtars, die sich in
ihrem Lesen überhaupt nicht stören lassen zu wollen scheint. Auch der Engel in bläulich-weißem Gewand
und einem Mantel aus goldenem Brokat vermeidet in seinem Fierantreten das allzu Direkte. Nicht nur sein
Knien, auch die Gebärde seiner Hände ist gleichsam noch in der Schwebe. Während bei Jan van Eycks Engeln
die eine das Szepter hält und die andere gen Flimmel weist, zeigen die beredten, aber untätigen Engelhände
der Louvreverkündigung ein bewegliches Fingerspiel, das die feingliedrigen Umrisse hervortreten läßt. Auch
das Antlitz mit dem unter gesenkten Lidern zu Maria herabgehenden Blick und dem kaum geöffneten
Munde ist von einer zarten Schönheit und von jenem auf das Empfindsame gestimmten Ausdruck, der in
der spätgotischen Kunst des Nordens in einem so weiten Umkreise Widerhall fand (Abb. 21).
Diese feine Beweglichkeit der Form und des Ausdrucks war den allerfrühesten Gestalten auch von Rogier
selber noch nicht eigentümlich gewesen. Mit der Maria der Louvreverkündigung verglichen, war etwa
die Londoner Magdalena (Abb. 15) noch eine ganz anders in die Fläche gebannte und geschlossene
Gestalt. Ähnlich wie bei dem hl. Georg (Abb. 12) war auch bei ihr alle wesentliche Form aus dem Profil
entwickelt gewesen. Der Engel und die Jungfrau der Verkündigungstafel breiten sich dagegen bereits, ganz
anders in sich gelöst, auch nach der Tiefe des Raumes aus. Namentlich die Bewegung der sprechend erho-
benen Hand Marias und ihre Blickwendung setzen diese Dimension der Tiefe voraus.
Die Turiner Seitenflügel sind künstlerisch geringer. Die Darstellung der Heimsuchung (Abb. 19) hat
ihre vollkommenere Lösung in dem etwas jüngeren, einst der Lützschenaer Sammlung Speck von Sternburg
gehörenden Bilde (Abb. 28) gefunden. Die Stiftertafel ist durch ihren motivisch reichen Landschafts-
hintergrund bemerkenswert, auf welchen den Durchblick teilweise freilich ein im Bildmittelgrund
stehendes flaches Gebäude versperrt. Die Stifterfigur ist gänzlich neu gemalt worden. Vorher aber hatte
man das Brustbild der einstigen Stifterin in ungefähr 16 cm Höhe und 12 cm Breite herausgesägt und verkauft.
Hulin de Loo hat es in einem kleinen Frauenporträt in der Sammlung Rothschild in Paris wiedererkennen
zu können geglaubt26. Die Frau dieses in der Tat den Maßen der in Turin ergänzten Stelle entsprechen-
den und der Tracht nach sicher auch gleichzeitigen Täfelchens blickt aus dem Bilde heraus uns entgegen,
was der Haltung einer betenden Stifterin wenig gemäß scheint. Das Motiv des auf den Beschauer sich rich-
tenden Blickes war in jenen Jahren ganz neu. In den Niederlanden zeigen es zuerst eyckische Bildnisse,
kurz darauf finden wir es dann auch, wovon noch zu sprechen sein wird, bei Rogier, in seinem schönen
3 Beenken, Rogier