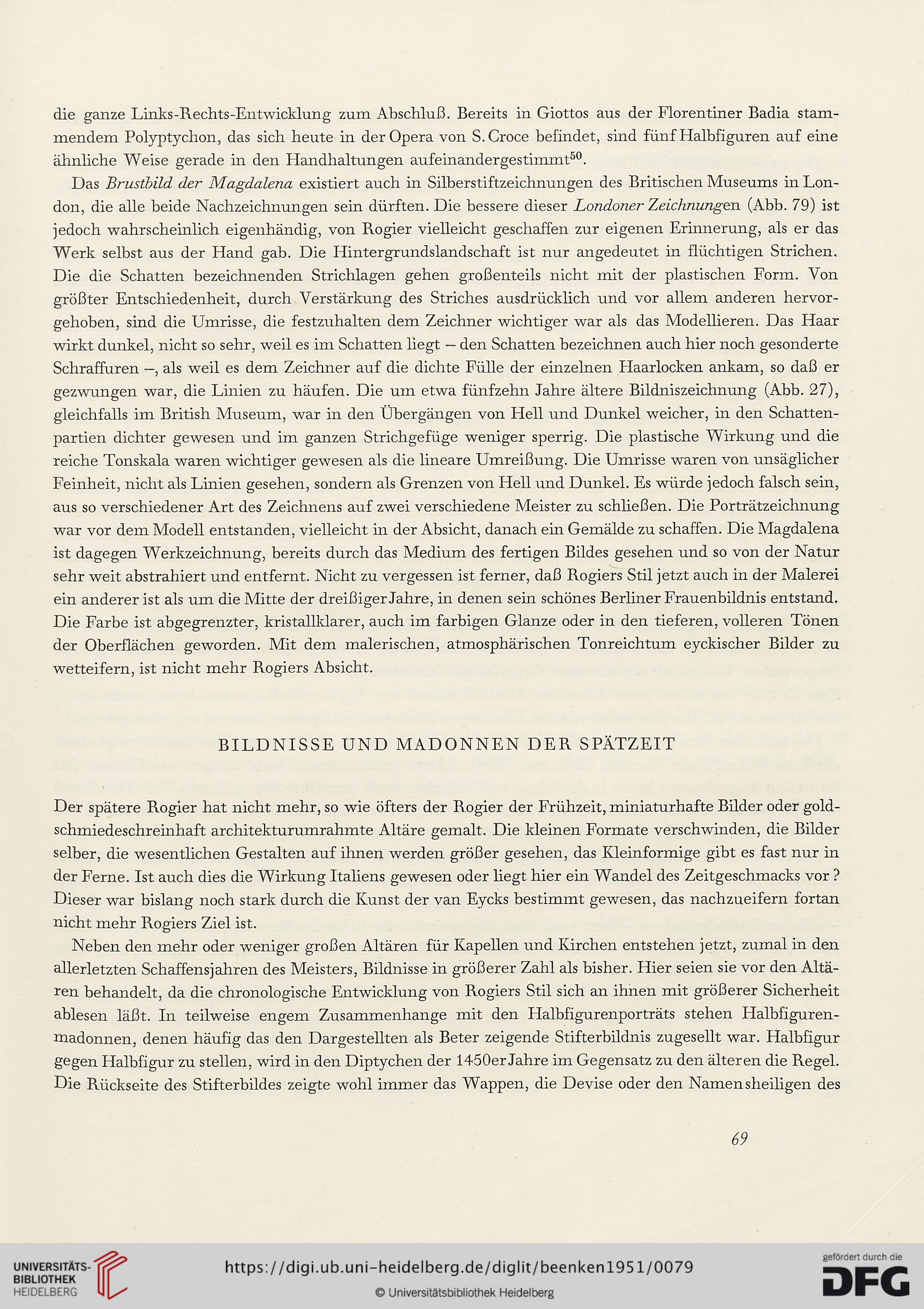die ganze Links-Rechts-Entwicklung zum Abschluß. Bereits in Giottos aus der Florentiner Badia stam-
mendem Polyptychon, das sich heute in der Opera von S.Croce befindet, sind fünf Halbfiguren auf eine
ähnliche Weise gerade in den Handhaltungen aufeinandergestimmt60.
Das Brustbild der Magdalena existiert auch in Silberstiftzeichnungen des Britischen Museums in Lon-
don, die alle beide Nachzeichnungen sein dürften. Die bessere dieser Londoner Zeichnungen (Abb. 79) ist
jedoch wahrscheinlich eigenhändig, von Rogier vielleicht geschaffen zur eigenen Erinnerung, als er das
Werk selbst aus der Hand gab. Die Hintergrundslandschaft ist nur angedeutet in flüchtigen Strichen.
Die die Schatten bezeichnenden Strichlagen gehen großenteils nicht mit der plastischen Form. Von
größter Entschiedenheit, durch Verstärkung des Striches ausdrücklich und vor allem anderen hervor-
gehoben, sind die Umrisse, die festzuhalten dem Zeichner wichtiger war als das Modellieren. Das Haar
wirkt dunkel, nicht so sehr, weil es im Schatten liegt — den Schatten bezeichnen auch hier noch gesonderte
Schraffuren —, als weil es dem Zeichner auf die dichte Fülle der einzelnen Haarlocken ankam, so daß er
gezwungen war, die Linien zu häufen. Die um etwa fünfzehn Jahre ältere Bildniszeichnung (Abb. 27),
gleichfalls im British Museum, war in den Übergängen von Hell und Dunkel weicher, in den Schatten-
partien dichter gewesen und im ganzen Strichgefüge weniger sperrig. Die plastische Wirkung und die
reiche Tonskala waren wichtiger gewesen als die lineare Umreißung. Die Umrisse waren von unsäglicher
Feinheit, nicht als Linien gesehen, sondern als Grenzen von Hell und Dunkel. Es würde jedoch falsch sein,
aus so verschiedener Art des Zeichnens auf zwei verschiedene Meister zu schließen. Die Porträtzeichnung
war vor dem Modell entstanden, vielleicht in der Absicht, danach ein Gemälde zu schaffen. Die Magdalena
ist dagegen Werkzeichnung, bereits durch das Medium des fertigen Bildes gesehen und so von der Natur
sehr weit abstrahiert und entfernt. Nicht zu vergessen ist ferner, daß Rogiers Stil jetzt auch in der Malerei
ein anderer ist als um die Mitte der dreißiger Jahre, in denen sein schönes Berliner Frauenbildnis entstand.
Die Farbe ist abgegrenzter, kristallklarer, auch im farbigen Glanze oder in den tieferen, volleren Tönen
der Oberflächen geworden. Mit dem malerischen, atmosphärischen Tonreichtum eyckischer Bilder zu
wetteifern, ist nicht mehr Rogiers Absicht.
BILDNISSE UND MADONNEN DER SPÄTZEIT
Der spätere Rogier hat nicht mehr, so wie öfters der Rogier der Frühzeit, miniaturhafte Bilder oder gold-
schmiedeschreinhaft architekturumrahmte Altäre gemalt. Die kleinen Formate verschwinden, die Bilder
selber, die wesentlichen Gestalten auf ihnen werden größer gesehen, das Kleinformige gibt es fast nur in
der Ferne. Ist auch dies die Wirkung Italiens gewesen oder liegt hier ein Wandel des Zeitgeschmacks vor ?
Dieser war bislang noch stark durch die Kunst der van Eycks bestimmt gewesen, das nachzueifern fortan
nicht mehr Rogiers Ziel ist.
Neben den mehr oder weniger großen Altären für Kapellen und Kirchen entstehen jetzt, zumal in den
allerletzten Schaffensjahren des Meisters, Bildnisse in größerer Zahl als bisher. Hier seien sie vor den Altä-
ren behandelt, da die chronologische Entwicklung von Rogiers Stil sich an ihnen mit größerer Sicherheit
ablesen läßt. In teilweise engem Zusammenhänge mit den Halbfigurenporträts stehen Halbfiguren-
tnadonnen, denen häufig das den Dargestellten als Beter zeigende Stifterbildnis zugesellt war. Halbfigur
gegen Halbfigur zu stellen, wird in den Diptychen der 1450er Jahre im Gegensatz zu den älteren die Regel.
Die Rückseite des Stifterbildes zeigte wohl immer das Wappen, die Devise oder den Namensheiligen des
69
mendem Polyptychon, das sich heute in der Opera von S.Croce befindet, sind fünf Halbfiguren auf eine
ähnliche Weise gerade in den Handhaltungen aufeinandergestimmt60.
Das Brustbild der Magdalena existiert auch in Silberstiftzeichnungen des Britischen Museums in Lon-
don, die alle beide Nachzeichnungen sein dürften. Die bessere dieser Londoner Zeichnungen (Abb. 79) ist
jedoch wahrscheinlich eigenhändig, von Rogier vielleicht geschaffen zur eigenen Erinnerung, als er das
Werk selbst aus der Hand gab. Die Hintergrundslandschaft ist nur angedeutet in flüchtigen Strichen.
Die die Schatten bezeichnenden Strichlagen gehen großenteils nicht mit der plastischen Form. Von
größter Entschiedenheit, durch Verstärkung des Striches ausdrücklich und vor allem anderen hervor-
gehoben, sind die Umrisse, die festzuhalten dem Zeichner wichtiger war als das Modellieren. Das Haar
wirkt dunkel, nicht so sehr, weil es im Schatten liegt — den Schatten bezeichnen auch hier noch gesonderte
Schraffuren —, als weil es dem Zeichner auf die dichte Fülle der einzelnen Haarlocken ankam, so daß er
gezwungen war, die Linien zu häufen. Die um etwa fünfzehn Jahre ältere Bildniszeichnung (Abb. 27),
gleichfalls im British Museum, war in den Übergängen von Hell und Dunkel weicher, in den Schatten-
partien dichter gewesen und im ganzen Strichgefüge weniger sperrig. Die plastische Wirkung und die
reiche Tonskala waren wichtiger gewesen als die lineare Umreißung. Die Umrisse waren von unsäglicher
Feinheit, nicht als Linien gesehen, sondern als Grenzen von Hell und Dunkel. Es würde jedoch falsch sein,
aus so verschiedener Art des Zeichnens auf zwei verschiedene Meister zu schließen. Die Porträtzeichnung
war vor dem Modell entstanden, vielleicht in der Absicht, danach ein Gemälde zu schaffen. Die Magdalena
ist dagegen Werkzeichnung, bereits durch das Medium des fertigen Bildes gesehen und so von der Natur
sehr weit abstrahiert und entfernt. Nicht zu vergessen ist ferner, daß Rogiers Stil jetzt auch in der Malerei
ein anderer ist als um die Mitte der dreißiger Jahre, in denen sein schönes Berliner Frauenbildnis entstand.
Die Farbe ist abgegrenzter, kristallklarer, auch im farbigen Glanze oder in den tieferen, volleren Tönen
der Oberflächen geworden. Mit dem malerischen, atmosphärischen Tonreichtum eyckischer Bilder zu
wetteifern, ist nicht mehr Rogiers Absicht.
BILDNISSE UND MADONNEN DER SPÄTZEIT
Der spätere Rogier hat nicht mehr, so wie öfters der Rogier der Frühzeit, miniaturhafte Bilder oder gold-
schmiedeschreinhaft architekturumrahmte Altäre gemalt. Die kleinen Formate verschwinden, die Bilder
selber, die wesentlichen Gestalten auf ihnen werden größer gesehen, das Kleinformige gibt es fast nur in
der Ferne. Ist auch dies die Wirkung Italiens gewesen oder liegt hier ein Wandel des Zeitgeschmacks vor ?
Dieser war bislang noch stark durch die Kunst der van Eycks bestimmt gewesen, das nachzueifern fortan
nicht mehr Rogiers Ziel ist.
Neben den mehr oder weniger großen Altären für Kapellen und Kirchen entstehen jetzt, zumal in den
allerletzten Schaffensjahren des Meisters, Bildnisse in größerer Zahl als bisher. Hier seien sie vor den Altä-
ren behandelt, da die chronologische Entwicklung von Rogiers Stil sich an ihnen mit größerer Sicherheit
ablesen läßt. In teilweise engem Zusammenhänge mit den Halbfigurenporträts stehen Halbfiguren-
tnadonnen, denen häufig das den Dargestellten als Beter zeigende Stifterbildnis zugesellt war. Halbfigur
gegen Halbfigur zu stellen, wird in den Diptychen der 1450er Jahre im Gegensatz zu den älteren die Regel.
Die Rückseite des Stifterbildes zeigte wohl immer das Wappen, die Devise oder den Namensheiligen des
69