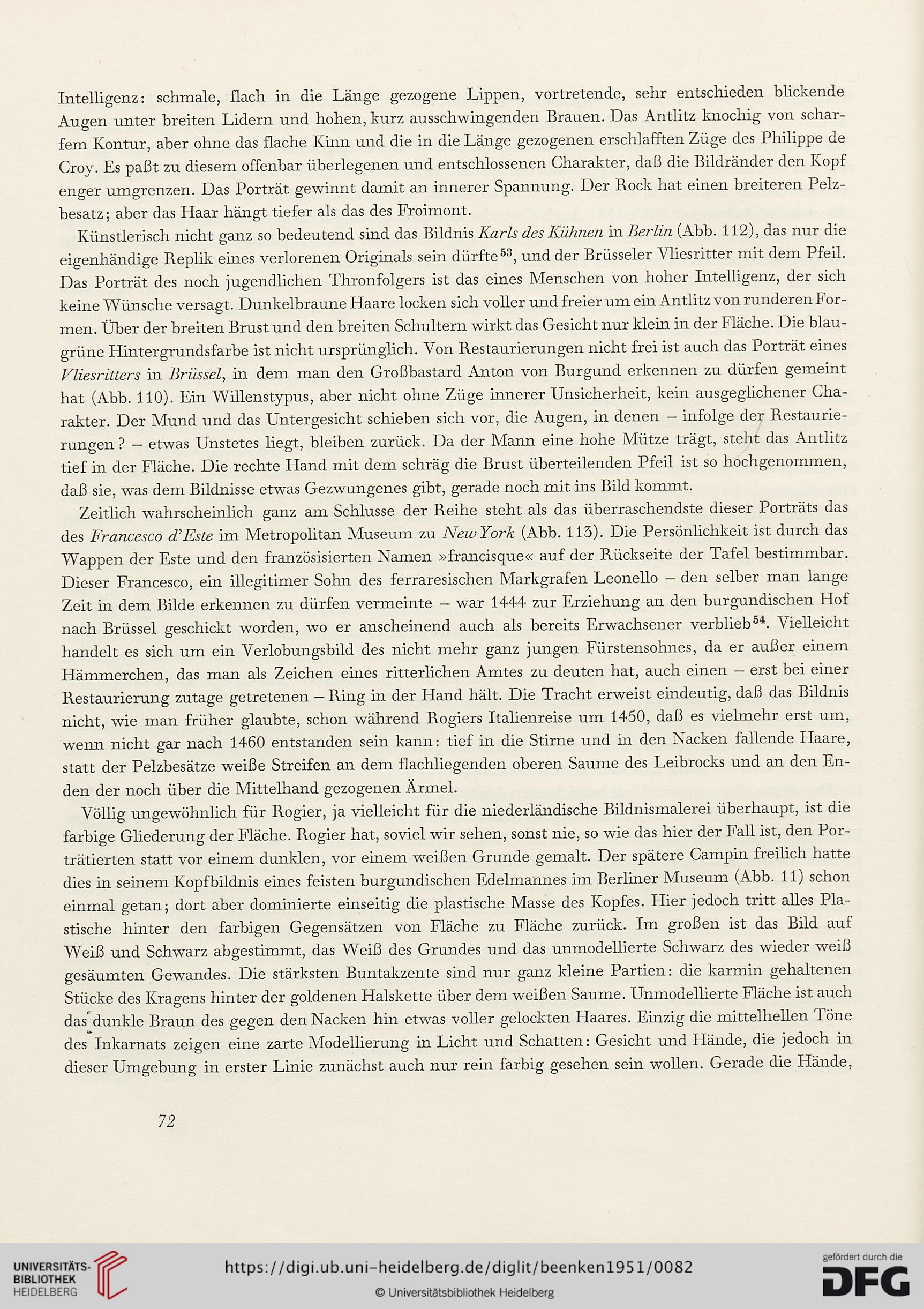Intelligenz: schmale, flach in die Länge gezogene Lippen, vortretende, sehr entschieden blickende
Augen unter breiten Lidern und hohen, kurz ausschwingenden Brauen. Das Antlitz knochig von schar-
fem Kontur, aber ohne das flache Kinn und die in die Länge gezogenen erschlafften Züge des Philippe de
Croy. Es paßt zu diesem offenbar überlegenen und entschlossenen Charakter, daß die Bildränder den Kopf
enger umgrenzen. Das Porträt gewinnt damit an innerer Spannung. Der Rock hat einen breiteren Pelz-
besatz ; aber das Haar hängt tiefer als das des Froimont.
Künstlerisch nicht ganz so bedeutend sind das Bildnis Karls des Kühnen in Berlin (Abb. 112), das nur die
eigenhändige Replik eines verlorenen Originals sein dürfte53, und der Brüsseler Vliesritter mit dem Pfeil.
Das Porträt des noch jugendlichen Thronfolgers ist das eines Menschen von hoher Intelligenz, der sich
keine Wünsche versagt. Dunkelbraune Haare locken sich voller und freier um ein Antlitz von runderen For-
men. Über der breiten Brust und den breiten Schultern wirkt das Gesicht nur klein in der Fläche. Die blau-
grüne Hintergrundsfarbe ist nicht ursprünglich. Von Restaurierungen nicht frei ist auch das Porträt eines
Vliesritters in Brüssel, in dem man den Großbastard Anton von Burgund erkennen zu dürfen gemeint
hat (Abb. 110). Ein Willenstypus, aber nicht ohne Züge innerer Unsicherheit, kein ausgeglichener Cha-
rakter. Der Mund und das Untergesicht schieben sich vor, die Augen, in denen — infolge der Restaurie-
rungen ? — etwas Unstetes liegt, bleiben zurück. Da der Mann eine hohe Mütze trägt, steht das Antlitz
tief in der Fläche. Die rechte Hand mit dem schräg die Brust überteilenden Pfeil ist so hochgenommen,
daß sie, was dem Bildnisse etwas Gezwungenes gibt, gerade noch mit ins Bild kommt.
Zeitlich wahrscheinlich ganz am Schlüsse der Reihe steht als das überraschendste dieser Porträts das
des Francesco d'Este im Metropolitan Museum zu NewYork (Abb. 113). Die Persönlichkeit ist durch das
Wappen der Este und den französisierten Namen »francisque« auf der Rückseite der Tafel bestimmbar.
Dieser Francesco, ein illegitimer Sohn des ferraresischen Markgrafen Leonello — den selber man lange
Zeit in dem Bilde erkennen zu dürfen vermeinte — war 1444 zur Erziehung an den burgundischen Hof
nach Brüssel geschickt worden, wo er anscheinend auch als bereits Erwachsener verblieb54. Vielleicht
handelt es sich um ein Verlobungsbild des nicht mehr ganz jungen Fürstensohnes, da er außer einem
Hämmerchen, das man als Zeichen eines ritterlichen Amtes zu deuten hat, auch einen — erst bei einer
Restaurierung zutage getretenen — Ring in der Hand hält. Die Tracht erweist eindeutig, daß das Bildnis
nicht, wie man früher glaubte, schon während Rogiers Italienreise um 1450, daß es vielmehr erst um,
wenn nicht gar nach 1460 entstanden sein kann: tief in die Stirne und in den Nacken fallende Haare,
statt der Pelzbesätze weiße Streifen an dem flachliegenden oberen Saume des Leibrocks und an den En-
den der noch über die Mittelhand gezogenen Ärmel.
Völlig ungewöhnlich für Rogier, ja vielleicht für die niederländische Bildnismalerei überhaupt, ist die
farbige Gliederung der Fläche. Rogier hat, soviel wir sehen, sonst nie, so wie das hier der Fall ist, den Por-
trätierten statt vor einem dunklen, vor einem weißen Grunde gemalt. Der spätere Campin freilich hatte
dies in seinem Kopfbildnis eines feisten burgundischen Edelmannes im Berliner Museum (Abb. 11) schon
einmal getan; dort aber dominierte einseitig die plastische Masse des Kopfes. Hier jedoch tritt alles Pla-
stische hinter den farbigen Gegensätzen von Fläche zu Fläche zurück. Im großen ist das Bild auf
Weiß und Schwarz abgestimmt, das Weiß des Grundes und das unmodellierte Schwarz des wieder weiß
gesäumten Gewandes. Die stärksten Buntakzente sind nur ganz kleine Partien: die karmin gehaltenen
Stücke des Kragens hinter der goldenen Halskette über dem weißen Saume. Unmodellierte Fläche ist auch
das dunkle Braun des gegen den Nacken hin etwas voller gelockten Haares. Einzig die mittelhellen Töne
des Inkarnats zeigen eine zarte Modellierung in Licht und Schatten: Gesicht und Hände, die jedoch in
dieser Umgebung in erster Linie zunächst auch nur rein farbig gesehen sein wollen. Gerade die Hände,
72
Augen unter breiten Lidern und hohen, kurz ausschwingenden Brauen. Das Antlitz knochig von schar-
fem Kontur, aber ohne das flache Kinn und die in die Länge gezogenen erschlafften Züge des Philippe de
Croy. Es paßt zu diesem offenbar überlegenen und entschlossenen Charakter, daß die Bildränder den Kopf
enger umgrenzen. Das Porträt gewinnt damit an innerer Spannung. Der Rock hat einen breiteren Pelz-
besatz ; aber das Haar hängt tiefer als das des Froimont.
Künstlerisch nicht ganz so bedeutend sind das Bildnis Karls des Kühnen in Berlin (Abb. 112), das nur die
eigenhändige Replik eines verlorenen Originals sein dürfte53, und der Brüsseler Vliesritter mit dem Pfeil.
Das Porträt des noch jugendlichen Thronfolgers ist das eines Menschen von hoher Intelligenz, der sich
keine Wünsche versagt. Dunkelbraune Haare locken sich voller und freier um ein Antlitz von runderen For-
men. Über der breiten Brust und den breiten Schultern wirkt das Gesicht nur klein in der Fläche. Die blau-
grüne Hintergrundsfarbe ist nicht ursprünglich. Von Restaurierungen nicht frei ist auch das Porträt eines
Vliesritters in Brüssel, in dem man den Großbastard Anton von Burgund erkennen zu dürfen gemeint
hat (Abb. 110). Ein Willenstypus, aber nicht ohne Züge innerer Unsicherheit, kein ausgeglichener Cha-
rakter. Der Mund und das Untergesicht schieben sich vor, die Augen, in denen — infolge der Restaurie-
rungen ? — etwas Unstetes liegt, bleiben zurück. Da der Mann eine hohe Mütze trägt, steht das Antlitz
tief in der Fläche. Die rechte Hand mit dem schräg die Brust überteilenden Pfeil ist so hochgenommen,
daß sie, was dem Bildnisse etwas Gezwungenes gibt, gerade noch mit ins Bild kommt.
Zeitlich wahrscheinlich ganz am Schlüsse der Reihe steht als das überraschendste dieser Porträts das
des Francesco d'Este im Metropolitan Museum zu NewYork (Abb. 113). Die Persönlichkeit ist durch das
Wappen der Este und den französisierten Namen »francisque« auf der Rückseite der Tafel bestimmbar.
Dieser Francesco, ein illegitimer Sohn des ferraresischen Markgrafen Leonello — den selber man lange
Zeit in dem Bilde erkennen zu dürfen vermeinte — war 1444 zur Erziehung an den burgundischen Hof
nach Brüssel geschickt worden, wo er anscheinend auch als bereits Erwachsener verblieb54. Vielleicht
handelt es sich um ein Verlobungsbild des nicht mehr ganz jungen Fürstensohnes, da er außer einem
Hämmerchen, das man als Zeichen eines ritterlichen Amtes zu deuten hat, auch einen — erst bei einer
Restaurierung zutage getretenen — Ring in der Hand hält. Die Tracht erweist eindeutig, daß das Bildnis
nicht, wie man früher glaubte, schon während Rogiers Italienreise um 1450, daß es vielmehr erst um,
wenn nicht gar nach 1460 entstanden sein kann: tief in die Stirne und in den Nacken fallende Haare,
statt der Pelzbesätze weiße Streifen an dem flachliegenden oberen Saume des Leibrocks und an den En-
den der noch über die Mittelhand gezogenen Ärmel.
Völlig ungewöhnlich für Rogier, ja vielleicht für die niederländische Bildnismalerei überhaupt, ist die
farbige Gliederung der Fläche. Rogier hat, soviel wir sehen, sonst nie, so wie das hier der Fall ist, den Por-
trätierten statt vor einem dunklen, vor einem weißen Grunde gemalt. Der spätere Campin freilich hatte
dies in seinem Kopfbildnis eines feisten burgundischen Edelmannes im Berliner Museum (Abb. 11) schon
einmal getan; dort aber dominierte einseitig die plastische Masse des Kopfes. Hier jedoch tritt alles Pla-
stische hinter den farbigen Gegensätzen von Fläche zu Fläche zurück. Im großen ist das Bild auf
Weiß und Schwarz abgestimmt, das Weiß des Grundes und das unmodellierte Schwarz des wieder weiß
gesäumten Gewandes. Die stärksten Buntakzente sind nur ganz kleine Partien: die karmin gehaltenen
Stücke des Kragens hinter der goldenen Halskette über dem weißen Saume. Unmodellierte Fläche ist auch
das dunkle Braun des gegen den Nacken hin etwas voller gelockten Haares. Einzig die mittelhellen Töne
des Inkarnats zeigen eine zarte Modellierung in Licht und Schatten: Gesicht und Hände, die jedoch in
dieser Umgebung in erster Linie zunächst auch nur rein farbig gesehen sein wollen. Gerade die Hände,
72