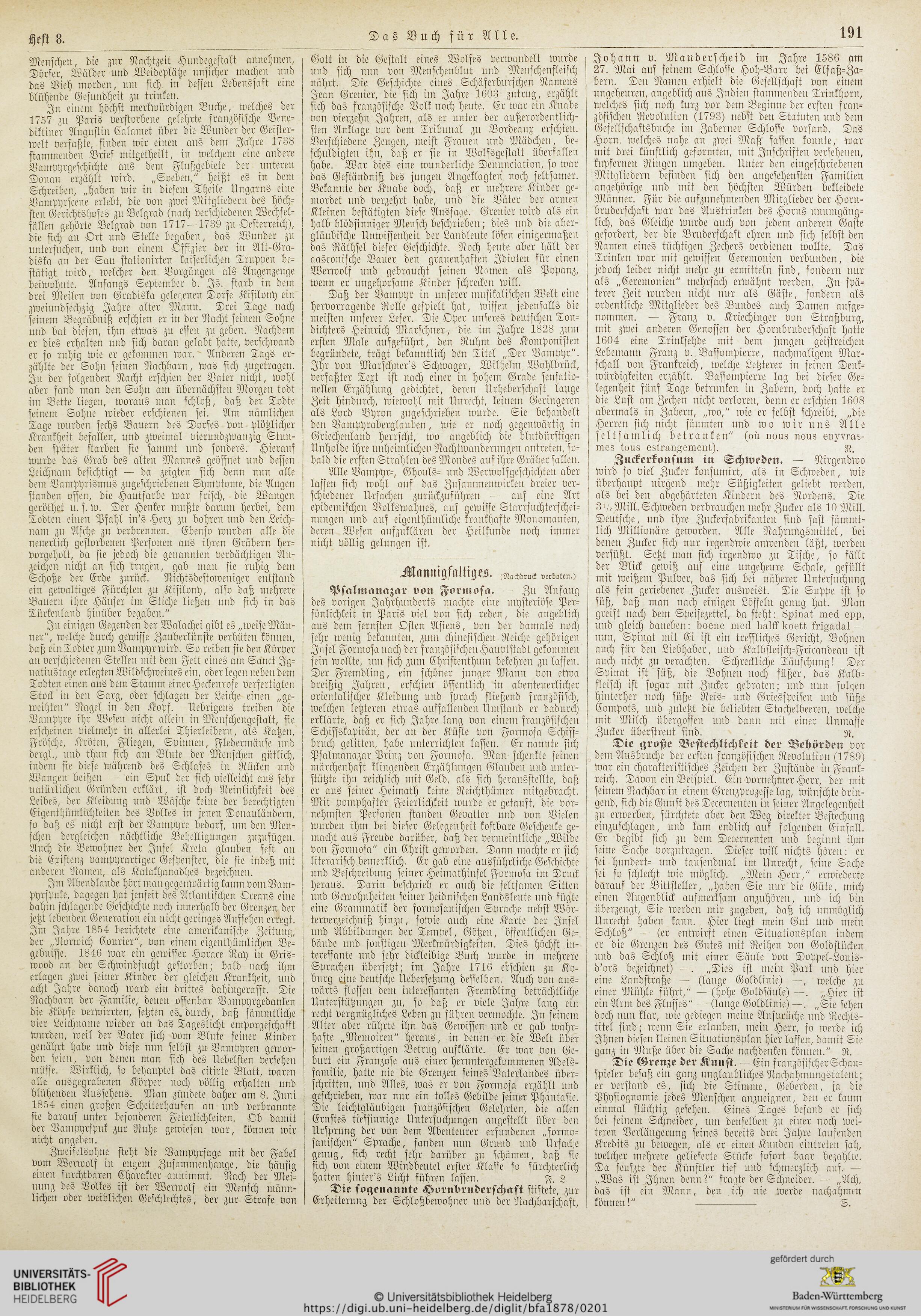191
Das Buch für Alle.
Heft 8.
Gott in die Gestalt eines Wolfes verwandelt wurde
und sich nun von Menschenblut und Menschenfleisch
nährt. Die Geschichte eines Schäferburschen Namens
Jean Grenier, die sich im Jahre 1603 zutrug, erzählt
sich das französische Bolt noch heute. Er war ein Knabe
von vierzehn Jahren, als.er unter der außerordentlich-
stcn Anklage vor dem Tribunal zu Bordeaux erschien.
Verschiedene Zeugen, meist Frauen und Mädchen, be-
schuldigten ihn, daß er sie in Wolfsgestalt überfallen
habe. War dies eine wunderliche Denunciation, fo war
das Geständniß des jungen Angeklagten' noch seltsamer.
Bekannte der Knabe doch, daß er mehrere Kinder ge-
mordet und verzehrt habe, und die Väter der armen
Kleinen bestätigten diese Aussage. Greuier wird als ein
halb blödsinniger Mensch beschrieben; dies und die aber-
gläubische Unwissenheit der Landleute lösen einigermaßen
das Räthfel dieser Geschichte. Noch heute aber hält der
aasconische Bauer den grauenhaften Idioten für einen
Werwolf und gebraucht feinen Namen als Popanz,
wenn er ungehorsame Kinder schrecken will.
Daß der Vampyr in unserer musikalischen Welt eine
hervorragende Rolle gespielt hat, wissen jedenfalls die
meisten unserer Leser. Die Oper unseres deutschen Ton-
dichters Heinrich Marschner, die im Jahre 1828 zum
ersten Male aufgeführt, den Ruhm des Komponisten
begründete, trägt bekanntlich den Titel „Der Vampyr".
Ihr von Marschner's Schwager, Wilhelm Wohlbrück,
verfaßter Text ist nach einer in hohem Grade sensatio-
nellen Erzählung gedichtet, deren Urheberschaft, lauge
Zeit hindurch, wiewohl mit Unrecht, keinem Geringeren
als Lord Byron zugeschrieben wurde. Sie behandelt
den Vampyraberglauben, wie er noch gegenwärtig in
Griechenland herrscht, wo angeblich die blutdürstigen
Unholde ihre unheimlichen Nachtwanderungen antreten, so-
bald die ersten Strahlen des Mondes auf ihre Gräber fallen.
Alle Vampyr-, Ghouls- und Werwolfgeschichten aber
lassen sich Wohl aus das Zusammenwirken dreier ver-
schiedener Ursachen zurückzuführen — aus eine Art
epidemischen Volkswahnes, aus gewisse Starrsuchterschei-
nungen und auf eigenthümliche krankhafte Monomanien,
deren Wesen auszuklären der Heilkunde noch immer
nicht völlig gelungen ist.
(Nachdruck verboten.)
Psalmanazar von Formosa. — Zu Anfang
des vorigen Jahrhunderts machte eine mysteriöse Per-
sönlichkeit in Paris viel von sich reden, die angeblich
aus dem fernsten Osten Asiens, von der damals noch
sehr wenig bekannten, zum chinesischen Reiche gehörigen
Insel Formosa nach der französischen Hauptstadt gekommen
sein wollte, nm sich zum Christenthun: bekehren zu lassen.
Der Fremdling, ein schöner junger Mann von etwa
dreißig Jahren, erschien öffentlich in abenteuerlicher
orientalischer Kleidung und sprach fließend französisch,
welchen letzteren etwas ausfallenden Umstand er dadurch
erklärte, daß er sich Jahre lang von einem französischen
Schiffskapitän, der an der Küste von Formosa Schiff-
bruch gelitten, habe unterrichten lassen. Er nannte sich
Psalmanazar Prinz von Formosa. Man schenkte seinen
märchenhaft klingenden Erzählungen Glauben und unter-
stützte ihn reichlich mit Geld, als sich herausstellte, daß
er aus seiner Heimath keine Reichthümer mitgebracht.
Mit pomphafter Feierlichkeit wurde er getauft, die vor-
nehmsten Personen standen Gevatter und von Vielen
wurden ihm bei dieser Gelegenheit kostbare Geschenke ge-
macht ans Freude darüber, daß der vermeintliche „Wilde
von Formosa" ein Christ geworden. Dann machte er sich
literarisch bemerklich. Er gab eine ausführliche Geschichte
und Beschreibung seiner Heimathiusel Formosa im Druck
heraus. Darin beschrieb er auch die seltsamen Sitten
und Gewohnheiten seiner heidnischen Landsleute und fügte
eine Grammatik der sornwsanischen Sprache nebst Wör-
terverzeichniß hinzu, sowie auch eine Karte der Insel
und Abbildungen der Tempel, Götzen, öffentlichen Ge-
bäude und sonstigen Merkwürdigkeiten. Dies höchst in-
teressante und sehr dickleibige Buch wurde in mehrere
Sprachen übersetzt; im Jahre 1716 erschien zu Ko-
bnrg eine deutsche Uebersetzuug desselben. Auch von aus-
wärts flössen dem interessanten Fremdling beträchtliche
Unterstützungen zu, so daß er viele Jahre laug ein
recht vergnügliches Leben zu führen vermochte. In seinem
Alter aber rührte ihn das Gewissen und er gab wahr-
hafte „Memoiren" heraus, in denen er die Welt über-
feinen großartigen Betrug aufklärte. Er war von Ge-
burt ein Franzose aus einer heruntergekommenen Adels-
familie, hatte nie die Grenzen seines Vaterlandes über-
schritten, und Alles, was er von Formosa erzählt und
geschrieben, war nur ein tolles Gebilde seiner Phantasie.
Die leichtgläubigen französischen Gelehrten, die allen
Ernstes tiefsinnige Untersuchungen angestellt über den
Ursprung der von dem Abenteurer erfundenen „sorino-
sanischen" Sprache, fanden nun Grund und Ursache
genug, sich recht sehr darüber zu schämen, daß sie
sich von einem Windbeutel erster Klasse so fürchterlich
hatten hinter's Licht führen lassen. F. L
Die sogenannte Hornbruderschaft stiftete, zur
Erheiterung der Schloßbewohner und der Nachbarschaft,
Menschen, die zur Nachtzeit Hundegestalt annehmen,
Dörfer, Wälder und Weideplätze unsicher machen und
das Vieh morden, um sich in dessen Lebenssaft eine
blühende Gesundheit zu trinken.
In einem höchst merkwürdigen Buche, welches der
1757 zu Paris verstorbene gelehrte französische Bene-
diktiner Augustin Calumet über die Wunder der Geister-
Welt verfaßte, finden wir einen aus dem Jahre 1738
stammenden Brief mitgetheilt, in welchem eine andere
Vampyrgeschichte aus dem Flußgebiete der unteren
Donau erzählt wird. „Soeben," heißt es in dem
Schreiben, „haben wir in diesem Theile Ungarns eine
Vampyrseene erlebt, die von zwei Mitgliedern des höch-
sten Gerichtshofes zu Belgrad (nach verschiedenen Wechsel-
fällen gehörte Belgrad von 1717—1739 zu Oesterreich),
die sich an Ort und Stelle begaben, das Wunder zu
untersuchen, und von einem Offizier der in Alt-Gra-
diska an der Sau stationirten kaiserlichen Truppen be-
stätigt wird, welcher den Vorgängen als Augenzeuge
beiwohnte. Anfangs September d. Js. starb in dem
drei Meilen von Gradiska gelegenen Dorfe Kisilony ein
zweiundsechzig Jahre alter Mann. Drei , Tage nach
seinem Begräbniß erschien er in der Nacht seinen: Sohne
und bat diesen, ihm etwas zu essen zu geben. Nachdem
er dies erhalten rind sich daran gelabt hatte, verschwand
er so ruhig wie er gekommen war." Anderen Tags er-
zählte der Sohu seinen Nachbarn, was sich zugetragen.
In der folgenden Nacht erschien der Vater nicht, wohl
aber sand man den Sohn am übernächsten Morgen todt
im Bette liegen, woraus man schloß, daß der Todte
seinem Sohne wieder erschienen sei. An: nämlichen
Tage wurden sechs Bauern des Dorfes von plötzlicher
Krankheit befallen, und zweimal vierundzwanzig Stun-
den später starben sie sammt und sonders. Hierauf
wurde das Grab des alten Mannes geöffnet und dessen
Leichnam besichtigt — da zeigten sich denn nun alle
dem Vampyrismus zugeschriebenen Symptome, die Augen
standen offen, die Hautfarbe war frisch, die Wangen
geröthet u. s. w. Der Henker mußte darum herbei, dem
Todten einen Pfahl in's Herz zu bohren und den Leich-
nam zu Asche zu verbrennen. Ebenso wurden alle die
neuerlich gestorbenen Personen aus ihren Gräbern her-
vorgeholt, da sie jedoch die genannten verdächtigen An-
zeichen nicht an sich trugen, gab man sie ruhig dem
Schoße der Erde zurück. Nichtsdestoweniger entstand
ein gewaltiges Fürchten zu Kisilony, also daß mehrere
Bauern ihre Häuser im Stiche ließen und sich in das
Türkenland hinüber begaben."
In einigen Gegenden der Walachei gibt es „weise Män-
ner", welche durch gewisse Zauberkünste verhüten können,
daß ein Todter zum Vampyr wird. So reiben sie den Körper
an verschiedenen Stellen mit dem Fett eines am Sauet Jg-
natiustage erlegten Wildschweines ein, oder legen neben dem
Todten einen aus dem Stamm einer Heckenrose verfertigten
Stock in den Sarg, oder schlagen der Leiche einen „ge-
weihten" Nagel in den Kopf. Uebrigens treiben die
Vampyre ihr Wesen nicht allein in Menschengestalt, sie
erscheinen vielmehr in allerlei Thierleibern, als Katzen,
Frösche, Kröten, Fliegen, Spinnen, Fledermäuse und
decgl., und thun sich an: Blute der Menschen gütlich,
indem sie diese während des Schlafes in Rücken und
Wange:: beißen — ein Spuk der sich vielleicht aus sehr
natürlichen Gründen erklärt, ist doch Reinlichkeit des
Leibes, der Kleidung und Wäsche keine der berechtigten
Eigenthümlichkeiten des Volkes in jenen Donaulündern,
so daß es nicht erst der Vampyre bedarf, um den Men-
schen dergleichen nächtliche Behelligungen zuzufügen.
Auch die Bewohner der Insel Kreta glauben fest an
die Existenz vampyrartiger Gespenster, die sie indeß mit
anderen Namen, als Katakhanadhes bezeichnen.
Im Abendlande hört man gegenwärtig kaum vom Vam-
pyrspuke, dagegen hat jenseit des Atlantischen Oceans eine
dahin schlagende Geschichte noch innerhalb der Grenzen der
jetzt lebenden Generation ein nicht geringes Aufsehen erregt.
Im Jahre 1854 berichtete eine amerikanische Zeitung,
der „Norwich Courier", von einem eigenthümlichen Be-
gebnisse. 1846 war ein gewisser Horacc Ray in Gris-
wood an der Schwindsucht gestorben; bald nach ihm
erlagen zwei seiner Kinder der gleichen Krankheit, und
acht Jahre danach ward ein drittes dahingerafft. Die
Nachbarn der Familie, denen offenbar Vampyrgedanken
die Köpfe verwirrten, setzten es. durch, daß sümmtliche
vier Leichname wieder an das Tageslicht cmporgeschasft
wurden, weil der Vater sich vom Blute seiner' Kinder-
genährt habe und diese nun selbst zu Vampyren gewor-
den seien, von denen man sich des Uebelsten versehen
müsse. Wirklich, so behauptet das citirte Blatt, waren
alle ausgegrabenen Körper noch völlig erhalten und
blühenden Aussehens. Man zündete daher am 8. Juni
1854 einen großen Scheiterhaufen an und verbrannte
sie darauf unter besonderen Feierlichkeiten. Ob damit
der Vampyrspuk zur Ruhe gewiesen war, können wir
nicht angeben.
Zweifelsohne steht die Vampyrsage mit der Fabel
vom Werwolf in engem Zusammenhänge, die häufig
einen furchtbaren Charakter annimmt. Nach der Mei-
nung des Volkes ist der Werwolf ein Mensch männ-
lichen oder weiblichen Geschlechtes, der zur Strafe von
Johann v. Manderscheid im Jahre 1586 am
27. Mai auf seinem Schlosse Hoh-Barr bei Elsaß-Za-
bern. Den Namen erhielt die Gesellschaft von einem
ungeheuren, angeblich aus Jndieu stammenden Trinkhorn,
welches sich noch kurz vor dem Beginne der ersten fran-
zösischen Revolution (1793) nebst den Statuten und dem
Gcsellschastsbuche im Zaberner Schlosse vorfand. Das
Horn, welches nahe an zwei Maß fassen konnte, war
mit drei künstlich geformten, mit Inschriften versehenen,
kupfernen Ringen umgeben. Unter den eingeschriebenen
Mitgliedern befinden sich den angesehensten Familien
angehörige und mit den höchsten Würden bekleidete
Männer. Für die auszunehmenden Mitglieder der Horn-
bruderschast war das Austrinken des Horns unumgäng-
lich, das Gleiche wurde auch von jedem anderen Gaste
gefordert, der die Bruderschaft ehren und sich selbst den
Namen eines tüchtigen Zechers verdienen wollte. Das
Trinken war mit gewissen Ceremonien verbunden, die
jedoch leider nicht mehr zu ermitteln sind, sondern nur
als „Ceremonien" mehrfach erwähnt werden. In spä-
terer Zeit wurden nicht nur als Gäste, sondern als
ordentliche Mitglieder des Bundes auch Damen ausge-
nommen. — Franz v. Kriechinger von Straßburg,
niit zwei anderen Genossen der Hornbrnderschaft hatte
1604 eine Trinkfehde mit dem jungen geistreichen
Lebemann Franz v. Bassompierre, nachmaligen: Mar-
schall von Frankreich, welche Letzterer in seinen Denk-
würdigkeiten erzählt. Bassompierre lag bei dieser Ge-
legenheit fünf Tage betrunken in Zabern, doch hatte er
die Lust am Zechen nicht verloren, denn er erschien 1608
abermals in Zabern, „wo," wie er selbst schreibt, „die
Herren sich nicht säumten und wo wir uns Alle
seltsamlich betranken" (oü nou8 nous 6nz--vra8-
mes tous 68trangem6nt). N.
Zuckerkonsum in Schweden. — Nirgendwo
wird so viel Zucker konsumirt, als in Schweden, wie
überhaupt nirgend mehr Süßigkeiten geliebt werden,
als bei den abgehärteten Kindern des Nordens. Die
3 yr Mill. Schweden verbrauchen mehr Zucker als l O Mill.
Deutsche, und ihre Zuckersabrikanten sind fast sämint-
lich Millionäre geworden. Alle Nahrungsmittel, bei
denen Zucker sich nur irgendwie anwenden läßt, werden
versüßt. Setzt man sich irgendwo zu Tische, so füllt
der Blick gewiß aus eine ungeheure Schale, gefüllt
mit weißem Pulver, das sich bei näherer Untersuchung
als fein geriebener Zucker ausweist. Die Suppe ist so
süß, daß man nach einigen Löffeln genug hat. Man
greift nach dem Speisezettel, da steht: Lxunat meck epp,
und gleich daneben: dosna mack batik'üoett trigaclat —
nun, Spinat mit Ei ist ein treffliches Gericht, Bohnen
auch für den Liebhaber, und Kalbfleisch-Fricandeau ist
anch nicht zu verachten. Schreckliche Täuschung! Der
Spinat ist süß, die Bohnen noch süßer, das Kalb-
fleisch ist sogar mit Zucker gebrateu; und nun folgen
hinterher noch süße Reis- und Griesspeisen und süße
Compots, und zuletzt die beliebten Stachelbeeren, welche
mit Milch übergossen und dann mit einer Unmasse
Zucker überstreut siud. R.
Die große Bestechlichkeit der Behörden vor
dem Ausbruche der ersten französischen Revolution (1789)
war ein charakteristisches Zeichen der Zustände in Frank-
reich. Davon ein Beispiel. Ein vornehmer Herr, der mit
seinem Nachbar in einem Grenzprozesse lag, wünschte drin-
gend, sich die Gunst des Decernenten in seiner Angelegenheit
zu erwerben, fürchtete aber den Weg direkter Bestechung
einzuschlagcn, und kam endlich auf folgenden Einfall.
Er begibt sich zu dem Decernenten und beginnt ihm
seine Sache vorzutragen. Dieser will nichts hören: er
sei hundert- und tausendmal im Unrecht, seine Sache
sei so schlecht wie möglich. „Mein Herr," erwiederte
darauf der Bittsteller, „haben Sie nur die Güte, mich
einen Augenblick aufmerksam anzuhören, und ich bin
überzeugt, Sie werden mir zugeben, daß ich unmöglich
Unrecht haben kann. Hier liegt mein Gut und mein
Schloß" — (er entwirft einen Situationsplan indem
er die Grenzen des Gutes mit Reihen von Goldstücken
und das Schloß mit einer Säule von Doppel-Louis-
d'ors bezeichnet) —. „Dies ist mein Park und hier
eine Landstraße — (lange Goldlinie) —, welche zu
einer Mühle führt," — (hohe Goldsüule) —. „Hier ist
ein Arm des Flusses" — (lange Goldlinie) —. „Sie sehen
doch nun klar, wie gediegen meine Ansprüche und Rechts-
titel sind; wenn Sie erlauben, mein Herr, so werde ich
Ihnen diesen kleinen Situationsplan hier lassen, damit Sie
ganz in Muße über die Sache nachdenken können." R.
Die Grenze der Kunst. — Ein französischer Schau-
spieler besaß ein ganz unglaubliches Nachahmungstalent;
er verstand es, sich die Stimme, Geberden, ja die
Physiognomie jedes Mensche:: anzueignen, den er kann:
einmal flüchtig gesehen. Eines Tages befand er sich
bei seinen: Schneider, um denselben zu einer noch wei-
teren Verlängerung seines bereits drei Jahre lausenden
Kredits zu bewegen, als er einen Kunden eintreten sah,
welcher mehrere gelieferte Stücke sofort baar bezahlte.
Da seufzte der Künstler tief und schmerzlich aus. —
„Was ist Ihnen denn?" fragte der Schneider. — „Ach,
das ist ein Mann, den ich nie werde nachahmcn
können!" - S.
Das Buch für Alle.
Heft 8.
Gott in die Gestalt eines Wolfes verwandelt wurde
und sich nun von Menschenblut und Menschenfleisch
nährt. Die Geschichte eines Schäferburschen Namens
Jean Grenier, die sich im Jahre 1603 zutrug, erzählt
sich das französische Bolt noch heute. Er war ein Knabe
von vierzehn Jahren, als.er unter der außerordentlich-
stcn Anklage vor dem Tribunal zu Bordeaux erschien.
Verschiedene Zeugen, meist Frauen und Mädchen, be-
schuldigten ihn, daß er sie in Wolfsgestalt überfallen
habe. War dies eine wunderliche Denunciation, fo war
das Geständniß des jungen Angeklagten' noch seltsamer.
Bekannte der Knabe doch, daß er mehrere Kinder ge-
mordet und verzehrt habe, und die Väter der armen
Kleinen bestätigten diese Aussage. Greuier wird als ein
halb blödsinniger Mensch beschrieben; dies und die aber-
gläubische Unwissenheit der Landleute lösen einigermaßen
das Räthfel dieser Geschichte. Noch heute aber hält der
aasconische Bauer den grauenhaften Idioten für einen
Werwolf und gebraucht feinen Namen als Popanz,
wenn er ungehorsame Kinder schrecken will.
Daß der Vampyr in unserer musikalischen Welt eine
hervorragende Rolle gespielt hat, wissen jedenfalls die
meisten unserer Leser. Die Oper unseres deutschen Ton-
dichters Heinrich Marschner, die im Jahre 1828 zum
ersten Male aufgeführt, den Ruhm des Komponisten
begründete, trägt bekanntlich den Titel „Der Vampyr".
Ihr von Marschner's Schwager, Wilhelm Wohlbrück,
verfaßter Text ist nach einer in hohem Grade sensatio-
nellen Erzählung gedichtet, deren Urheberschaft, lauge
Zeit hindurch, wiewohl mit Unrecht, keinem Geringeren
als Lord Byron zugeschrieben wurde. Sie behandelt
den Vampyraberglauben, wie er noch gegenwärtig in
Griechenland herrscht, wo angeblich die blutdürstigen
Unholde ihre unheimlichen Nachtwanderungen antreten, so-
bald die ersten Strahlen des Mondes auf ihre Gräber fallen.
Alle Vampyr-, Ghouls- und Werwolfgeschichten aber
lassen sich Wohl aus das Zusammenwirken dreier ver-
schiedener Ursachen zurückzuführen — aus eine Art
epidemischen Volkswahnes, aus gewisse Starrsuchterschei-
nungen und auf eigenthümliche krankhafte Monomanien,
deren Wesen auszuklären der Heilkunde noch immer
nicht völlig gelungen ist.
(Nachdruck verboten.)
Psalmanazar von Formosa. — Zu Anfang
des vorigen Jahrhunderts machte eine mysteriöse Per-
sönlichkeit in Paris viel von sich reden, die angeblich
aus dem fernsten Osten Asiens, von der damals noch
sehr wenig bekannten, zum chinesischen Reiche gehörigen
Insel Formosa nach der französischen Hauptstadt gekommen
sein wollte, nm sich zum Christenthun: bekehren zu lassen.
Der Fremdling, ein schöner junger Mann von etwa
dreißig Jahren, erschien öffentlich in abenteuerlicher
orientalischer Kleidung und sprach fließend französisch,
welchen letzteren etwas ausfallenden Umstand er dadurch
erklärte, daß er sich Jahre lang von einem französischen
Schiffskapitän, der an der Küste von Formosa Schiff-
bruch gelitten, habe unterrichten lassen. Er nannte sich
Psalmanazar Prinz von Formosa. Man schenkte seinen
märchenhaft klingenden Erzählungen Glauben und unter-
stützte ihn reichlich mit Geld, als sich herausstellte, daß
er aus seiner Heimath keine Reichthümer mitgebracht.
Mit pomphafter Feierlichkeit wurde er getauft, die vor-
nehmsten Personen standen Gevatter und von Vielen
wurden ihm bei dieser Gelegenheit kostbare Geschenke ge-
macht ans Freude darüber, daß der vermeintliche „Wilde
von Formosa" ein Christ geworden. Dann machte er sich
literarisch bemerklich. Er gab eine ausführliche Geschichte
und Beschreibung seiner Heimathiusel Formosa im Druck
heraus. Darin beschrieb er auch die seltsamen Sitten
und Gewohnheiten seiner heidnischen Landsleute und fügte
eine Grammatik der sornwsanischen Sprache nebst Wör-
terverzeichniß hinzu, sowie auch eine Karte der Insel
und Abbildungen der Tempel, Götzen, öffentlichen Ge-
bäude und sonstigen Merkwürdigkeiten. Dies höchst in-
teressante und sehr dickleibige Buch wurde in mehrere
Sprachen übersetzt; im Jahre 1716 erschien zu Ko-
bnrg eine deutsche Uebersetzuug desselben. Auch von aus-
wärts flössen dem interessanten Fremdling beträchtliche
Unterstützungen zu, so daß er viele Jahre laug ein
recht vergnügliches Leben zu führen vermochte. In seinem
Alter aber rührte ihn das Gewissen und er gab wahr-
hafte „Memoiren" heraus, in denen er die Welt über-
feinen großartigen Betrug aufklärte. Er war von Ge-
burt ein Franzose aus einer heruntergekommenen Adels-
familie, hatte nie die Grenzen seines Vaterlandes über-
schritten, und Alles, was er von Formosa erzählt und
geschrieben, war nur ein tolles Gebilde seiner Phantasie.
Die leichtgläubigen französischen Gelehrten, die allen
Ernstes tiefsinnige Untersuchungen angestellt über den
Ursprung der von dem Abenteurer erfundenen „sorino-
sanischen" Sprache, fanden nun Grund und Ursache
genug, sich recht sehr darüber zu schämen, daß sie
sich von einem Windbeutel erster Klasse so fürchterlich
hatten hinter's Licht führen lassen. F. L
Die sogenannte Hornbruderschaft stiftete, zur
Erheiterung der Schloßbewohner und der Nachbarschaft,
Menschen, die zur Nachtzeit Hundegestalt annehmen,
Dörfer, Wälder und Weideplätze unsicher machen und
das Vieh morden, um sich in dessen Lebenssaft eine
blühende Gesundheit zu trinken.
In einem höchst merkwürdigen Buche, welches der
1757 zu Paris verstorbene gelehrte französische Bene-
diktiner Augustin Calumet über die Wunder der Geister-
Welt verfaßte, finden wir einen aus dem Jahre 1738
stammenden Brief mitgetheilt, in welchem eine andere
Vampyrgeschichte aus dem Flußgebiete der unteren
Donau erzählt wird. „Soeben," heißt es in dem
Schreiben, „haben wir in diesem Theile Ungarns eine
Vampyrseene erlebt, die von zwei Mitgliedern des höch-
sten Gerichtshofes zu Belgrad (nach verschiedenen Wechsel-
fällen gehörte Belgrad von 1717—1739 zu Oesterreich),
die sich an Ort und Stelle begaben, das Wunder zu
untersuchen, und von einem Offizier der in Alt-Gra-
diska an der Sau stationirten kaiserlichen Truppen be-
stätigt wird, welcher den Vorgängen als Augenzeuge
beiwohnte. Anfangs September d. Js. starb in dem
drei Meilen von Gradiska gelegenen Dorfe Kisilony ein
zweiundsechzig Jahre alter Mann. Drei , Tage nach
seinem Begräbniß erschien er in der Nacht seinen: Sohne
und bat diesen, ihm etwas zu essen zu geben. Nachdem
er dies erhalten rind sich daran gelabt hatte, verschwand
er so ruhig wie er gekommen war." Anderen Tags er-
zählte der Sohu seinen Nachbarn, was sich zugetragen.
In der folgenden Nacht erschien der Vater nicht, wohl
aber sand man den Sohn am übernächsten Morgen todt
im Bette liegen, woraus man schloß, daß der Todte
seinem Sohne wieder erschienen sei. An: nämlichen
Tage wurden sechs Bauern des Dorfes von plötzlicher
Krankheit befallen, und zweimal vierundzwanzig Stun-
den später starben sie sammt und sonders. Hierauf
wurde das Grab des alten Mannes geöffnet und dessen
Leichnam besichtigt — da zeigten sich denn nun alle
dem Vampyrismus zugeschriebenen Symptome, die Augen
standen offen, die Hautfarbe war frisch, die Wangen
geröthet u. s. w. Der Henker mußte darum herbei, dem
Todten einen Pfahl in's Herz zu bohren und den Leich-
nam zu Asche zu verbrennen. Ebenso wurden alle die
neuerlich gestorbenen Personen aus ihren Gräbern her-
vorgeholt, da sie jedoch die genannten verdächtigen An-
zeichen nicht an sich trugen, gab man sie ruhig dem
Schoße der Erde zurück. Nichtsdestoweniger entstand
ein gewaltiges Fürchten zu Kisilony, also daß mehrere
Bauern ihre Häuser im Stiche ließen und sich in das
Türkenland hinüber begaben."
In einigen Gegenden der Walachei gibt es „weise Män-
ner", welche durch gewisse Zauberkünste verhüten können,
daß ein Todter zum Vampyr wird. So reiben sie den Körper
an verschiedenen Stellen mit dem Fett eines am Sauet Jg-
natiustage erlegten Wildschweines ein, oder legen neben dem
Todten einen aus dem Stamm einer Heckenrose verfertigten
Stock in den Sarg, oder schlagen der Leiche einen „ge-
weihten" Nagel in den Kopf. Uebrigens treiben die
Vampyre ihr Wesen nicht allein in Menschengestalt, sie
erscheinen vielmehr in allerlei Thierleibern, als Katzen,
Frösche, Kröten, Fliegen, Spinnen, Fledermäuse und
decgl., und thun sich an: Blute der Menschen gütlich,
indem sie diese während des Schlafes in Rücken und
Wange:: beißen — ein Spuk der sich vielleicht aus sehr
natürlichen Gründen erklärt, ist doch Reinlichkeit des
Leibes, der Kleidung und Wäsche keine der berechtigten
Eigenthümlichkeiten des Volkes in jenen Donaulündern,
so daß es nicht erst der Vampyre bedarf, um den Men-
schen dergleichen nächtliche Behelligungen zuzufügen.
Auch die Bewohner der Insel Kreta glauben fest an
die Existenz vampyrartiger Gespenster, die sie indeß mit
anderen Namen, als Katakhanadhes bezeichnen.
Im Abendlande hört man gegenwärtig kaum vom Vam-
pyrspuke, dagegen hat jenseit des Atlantischen Oceans eine
dahin schlagende Geschichte noch innerhalb der Grenzen der
jetzt lebenden Generation ein nicht geringes Aufsehen erregt.
Im Jahre 1854 berichtete eine amerikanische Zeitung,
der „Norwich Courier", von einem eigenthümlichen Be-
gebnisse. 1846 war ein gewisser Horacc Ray in Gris-
wood an der Schwindsucht gestorben; bald nach ihm
erlagen zwei seiner Kinder der gleichen Krankheit, und
acht Jahre danach ward ein drittes dahingerafft. Die
Nachbarn der Familie, denen offenbar Vampyrgedanken
die Köpfe verwirrten, setzten es. durch, daß sümmtliche
vier Leichname wieder an das Tageslicht cmporgeschasft
wurden, weil der Vater sich vom Blute seiner' Kinder-
genährt habe und diese nun selbst zu Vampyren gewor-
den seien, von denen man sich des Uebelsten versehen
müsse. Wirklich, so behauptet das citirte Blatt, waren
alle ausgegrabenen Körper noch völlig erhalten und
blühenden Aussehens. Man zündete daher am 8. Juni
1854 einen großen Scheiterhaufen an und verbrannte
sie darauf unter besonderen Feierlichkeiten. Ob damit
der Vampyrspuk zur Ruhe gewiesen war, können wir
nicht angeben.
Zweifelsohne steht die Vampyrsage mit der Fabel
vom Werwolf in engem Zusammenhänge, die häufig
einen furchtbaren Charakter annimmt. Nach der Mei-
nung des Volkes ist der Werwolf ein Mensch männ-
lichen oder weiblichen Geschlechtes, der zur Strafe von
Johann v. Manderscheid im Jahre 1586 am
27. Mai auf seinem Schlosse Hoh-Barr bei Elsaß-Za-
bern. Den Namen erhielt die Gesellschaft von einem
ungeheuren, angeblich aus Jndieu stammenden Trinkhorn,
welches sich noch kurz vor dem Beginne der ersten fran-
zösischen Revolution (1793) nebst den Statuten und dem
Gcsellschastsbuche im Zaberner Schlosse vorfand. Das
Horn, welches nahe an zwei Maß fassen konnte, war
mit drei künstlich geformten, mit Inschriften versehenen,
kupfernen Ringen umgeben. Unter den eingeschriebenen
Mitgliedern befinden sich den angesehensten Familien
angehörige und mit den höchsten Würden bekleidete
Männer. Für die auszunehmenden Mitglieder der Horn-
bruderschast war das Austrinken des Horns unumgäng-
lich, das Gleiche wurde auch von jedem anderen Gaste
gefordert, der die Bruderschaft ehren und sich selbst den
Namen eines tüchtigen Zechers verdienen wollte. Das
Trinken war mit gewissen Ceremonien verbunden, die
jedoch leider nicht mehr zu ermitteln sind, sondern nur
als „Ceremonien" mehrfach erwähnt werden. In spä-
terer Zeit wurden nicht nur als Gäste, sondern als
ordentliche Mitglieder des Bundes auch Damen ausge-
nommen. — Franz v. Kriechinger von Straßburg,
niit zwei anderen Genossen der Hornbrnderschaft hatte
1604 eine Trinkfehde mit dem jungen geistreichen
Lebemann Franz v. Bassompierre, nachmaligen: Mar-
schall von Frankreich, welche Letzterer in seinen Denk-
würdigkeiten erzählt. Bassompierre lag bei dieser Ge-
legenheit fünf Tage betrunken in Zabern, doch hatte er
die Lust am Zechen nicht verloren, denn er erschien 1608
abermals in Zabern, „wo," wie er selbst schreibt, „die
Herren sich nicht säumten und wo wir uns Alle
seltsamlich betranken" (oü nou8 nous 6nz--vra8-
mes tous 68trangem6nt). N.
Zuckerkonsum in Schweden. — Nirgendwo
wird so viel Zucker konsumirt, als in Schweden, wie
überhaupt nirgend mehr Süßigkeiten geliebt werden,
als bei den abgehärteten Kindern des Nordens. Die
3 yr Mill. Schweden verbrauchen mehr Zucker als l O Mill.
Deutsche, und ihre Zuckersabrikanten sind fast sämint-
lich Millionäre geworden. Alle Nahrungsmittel, bei
denen Zucker sich nur irgendwie anwenden läßt, werden
versüßt. Setzt man sich irgendwo zu Tische, so füllt
der Blick gewiß aus eine ungeheure Schale, gefüllt
mit weißem Pulver, das sich bei näherer Untersuchung
als fein geriebener Zucker ausweist. Die Suppe ist so
süß, daß man nach einigen Löffeln genug hat. Man
greift nach dem Speisezettel, da steht: Lxunat meck epp,
und gleich daneben: dosna mack batik'üoett trigaclat —
nun, Spinat mit Ei ist ein treffliches Gericht, Bohnen
auch für den Liebhaber, und Kalbfleisch-Fricandeau ist
anch nicht zu verachten. Schreckliche Täuschung! Der
Spinat ist süß, die Bohnen noch süßer, das Kalb-
fleisch ist sogar mit Zucker gebrateu; und nun folgen
hinterher noch süße Reis- und Griesspeisen und süße
Compots, und zuletzt die beliebten Stachelbeeren, welche
mit Milch übergossen und dann mit einer Unmasse
Zucker überstreut siud. R.
Die große Bestechlichkeit der Behörden vor
dem Ausbruche der ersten französischen Revolution (1789)
war ein charakteristisches Zeichen der Zustände in Frank-
reich. Davon ein Beispiel. Ein vornehmer Herr, der mit
seinem Nachbar in einem Grenzprozesse lag, wünschte drin-
gend, sich die Gunst des Decernenten in seiner Angelegenheit
zu erwerben, fürchtete aber den Weg direkter Bestechung
einzuschlagcn, und kam endlich auf folgenden Einfall.
Er begibt sich zu dem Decernenten und beginnt ihm
seine Sache vorzutragen. Dieser will nichts hören: er
sei hundert- und tausendmal im Unrecht, seine Sache
sei so schlecht wie möglich. „Mein Herr," erwiederte
darauf der Bittsteller, „haben Sie nur die Güte, mich
einen Augenblick aufmerksam anzuhören, und ich bin
überzeugt, Sie werden mir zugeben, daß ich unmöglich
Unrecht haben kann. Hier liegt mein Gut und mein
Schloß" — (er entwirft einen Situationsplan indem
er die Grenzen des Gutes mit Reihen von Goldstücken
und das Schloß mit einer Säule von Doppel-Louis-
d'ors bezeichnet) —. „Dies ist mein Park und hier
eine Landstraße — (lange Goldlinie) —, welche zu
einer Mühle führt," — (hohe Goldsüule) —. „Hier ist
ein Arm des Flusses" — (lange Goldlinie) —. „Sie sehen
doch nun klar, wie gediegen meine Ansprüche und Rechts-
titel sind; wenn Sie erlauben, mein Herr, so werde ich
Ihnen diesen kleinen Situationsplan hier lassen, damit Sie
ganz in Muße über die Sache nachdenken können." R.
Die Grenze der Kunst. — Ein französischer Schau-
spieler besaß ein ganz unglaubliches Nachahmungstalent;
er verstand es, sich die Stimme, Geberden, ja die
Physiognomie jedes Mensche:: anzueignen, den er kann:
einmal flüchtig gesehen. Eines Tages befand er sich
bei seinen: Schneider, um denselben zu einer noch wei-
teren Verlängerung seines bereits drei Jahre lausenden
Kredits zu bewegen, als er einen Kunden eintreten sah,
welcher mehrere gelieferte Stücke sofort baar bezahlte.
Da seufzte der Künstler tief und schmerzlich aus. —
„Was ist Ihnen denn?" fragte der Schneider. — „Ach,
das ist ein Mann, den ich nie werde nachahmcn
können!" - S.