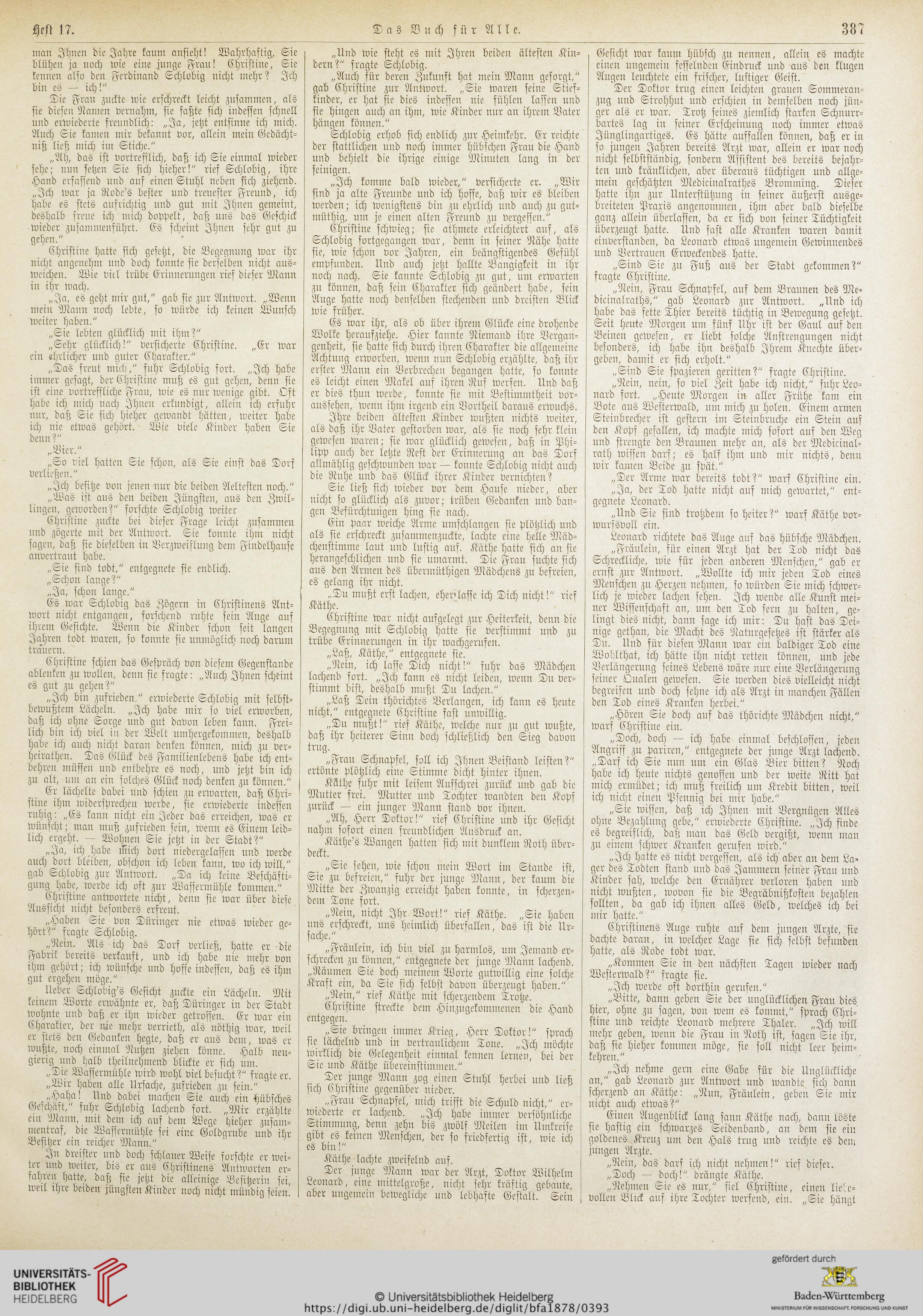Heft 17.
man Ihnen die Jahre kaum ansieht! Wahrhaftig, Sie
blühen ja noch wie eine junge Fran! Christine, Sie
kennen also den Ferdinand Schlobig nicht mehr? Ich
bin es — ich!"
Die Frau zuckte wie erschreckt leicht zusammen, als
sie diesen Namen vernahm, sie faßte sich indessen schnell
und erwiederte freundlich: „Ja, jetzt entsinne ich mich.
Auch Sie kamen mir bekannt vor, allein mein Gedacht-
niß ließ mich im Stiche."
„Ah, das ist vortrefflich, daß ich Sie einmal wieder
sehe; nun setzen Sie sich hieher!" rief Schlobig, ihre
Hand erfassend und auf einen Stuhl neben sich ziehend.
„Ich war ja Rode's bester und treuester Freuud, ich
habe es stets aufrichtig uud gut mit Ihnen gemeint,
deshalb freue ich mich doppelt, daß uns das Geschick
wieder zusammenführt. Cs scheint Ihnen sehr gut zu
gehen."
Christine hatte sich gesetzt, die Begegnung war ihr
nicht angenehm nnd doch konnte sie derselben nicht aus-
weichen. Wie viel trübe Erinnerungen rief dieser Mann
in ihr wach.
„Ja, es geht mir gut," gab sie zur Antwort. „Wenn
mein Mann noch lebte, so würde ich keinen Wunsch
weiter haben."
„Sie lebten glücklich mit ihm?"
„Sehr glücklich!" versicherte Christine. „Er war
ein ehrlicher und guter Charakter."
„Das freut mich," fuhr Schlobig fort. „Ich habe
immer gesagt, der Christine muß es gut gehen, denn sie
ist eine vortreffliche Frau, wie es uur wenige gibt. Oft
habe ich mich nach Ihnen erkundigt, allein ich erfuhr
uur, daß Sie sich hieher gewandt hätten, weiter habe
ich nie etwas gehört. Wie viele Kinder haben Sie
denn?"
„Vier."
„So viel hatten Sie schon, als Sie einst das Dorf
verließen."
„Ich besitze von jenen nur die beiden Nettesten noch."
„Was ist aus den beiden Jüngsten, aus den Zwil-
lingen, geworden?" forschte Schlobig weiter
Christine zuckte bei dieser Frage leicht zusammen
und zögerte mit der Antwort. Sie konnte ihm nicht
sagen, daß sie dieselben in Verzweiflung dem Findelhause
anvcrtraut habe.
„Sie find todt," entgegnete sie endlich.
„Schon lauge?"
„Ja, schon lange."
Es war Schlobig das Zögern in Christinens Ant-
wort nicht entgangen, forschend rnhte fein Auge auf
ihrem Gesichte. Wenn die Kinder schon feit langen
Jahren todt waren, so konnte sie unmöglich noch darum
trauern.
Christine schien das Gespräch von diesem Gegenstände
ablenken zu wollen, denn sie fragte: „Auch Ihnen scheint
es gut zu gehen?"
„Ich bin zufrieden." erwiederte Schlobig mit selbst-
bewußtem Lächeln. „Ich habe mir so viel erworben,
daß ich ohne Sorge und gut davon leben kann. Frei-
lich bin ich viel in der Welt umhergekommen, deshalb
habe ich auch nicht daran denken können, mich zu ver-
heirathen. Das Glück des Familienlebens habe ich ent-
behren müssen und entbehre es noch, und jetzt bin ich
zu alt, um an ein solches Glück noch denken zu könuen."
Er lächelte dabei und schien zu erwarten, daß Chri-
stine ihm widersprechen werde, sie erwiederte indessen
ruhig: „Es kann nicht ein Jeder das erreichen, was er
wünscht; man muß zufrieden fein, wenn es Einein leid- -
lich ergeht. — Wohnen Sie jetzt in der Stadt?"
„Ja, ich habe mich dort niedergelassen und werde
auch dort bleiben, obschon ich leben kann, wo ich will,"
gab Schlobig zur Antwort. „Da ich keine Beschäfti-
gung habe, werde ich oft zur Wassermühle kommen."
Christine antwortete nicht, denn sie war über diese
Aussicht nicht besonders erfreut.
„Haben Sie von Düringer nie etwas wieder ge-
hört?" fragte Schlobig.
„Nein. Als ich das Dorf verließ, hatte er die
Fabrik bereits verkauft, und ich habe nie mehr von
ihm gehört; ich wünsche und Hoffeindessen, daß es ihm
gut ergehen möge."
lieber Schlobig's Gesicht zuckte ein Lächeln. Mit
keinem Worte erwähnte er, daß Düringer in der Stadt
wohnte und daß er ihn wieder getroffen. Er war ein
Charakter, der nie mehr verrietst, als nöthig war, weil
er stets den Gedanken hegte, daß er aus dem, was er
wußte, noch einmal Nutzen ziehen könne. Halb neu-
gierig und halb theilnehmend blickte er sich um.
„Die Wassermühle wird wohl viel besucht?" fragte er.
„Wir haben alle Ursache, zufrieden zu sein."
„Haha! Und dabei machen Sie auch ein hübsches
Geschäft," fuhr Schlobig lachend fort. „Mir erzählte
ein Mann, mit dem ich auf dein Wege hieher zusam-
mentraf, die Wassermühle fei eine Goldgrube und ihr
Besitzer ein reicher Mann."
In dreister und doch schlauer Weise forschte er wei-
ter und weiter, bis er aus Christinens Antworten er-
fahren Hatte, daß sie jetzt die alleinige Besitzerin sei,
weil ihre beiden jüngsten Kinder noch nicht mündig seien.
Das Buch für Alle.
„Und wie steht es mit Ihren beiden ältesten Kin-
dern?" fragte Schlobig.
„Auch für deren Zukunft hat mein Mann gesorgt,"
gab Christine zur Antwort. „Sie waren seine Stief-
kinder, er hat sie dies indessen nie fühlen lassen und
sie hingen auch an ihm, wie Kinder nur an ihrem Vater-
hängen können."
Schlobig erhob sich endlich zur Heimkehr. Er reichte
der stattlichen und noch immer hübschen Frau die Hand
und behielt die ihrige einige Minuten lang in der
seinigen.
„Ich komme bald wieder," versicherte er. „Wir
sind ja alte Freunde und ich hoffe, daß wir es bleiben
werden; ich wenigstens bin zu ehrlich und auch zu gut-
müthig, um je einen alten Freund zu vergessen."
Christine schwieg; sie athmete erleichtert aus, als
Schlobig fortgegaugen war, denn in seiner Nähe hatte
sie, wie schon vor Jahren, ein beängstigendes Gefühl
empfunden. Und auch jetzt hallte Bangigkeit in ihr
noch nach. Sie kannte Schlobig zu gut, um erwarten
zu können, daß sein Charakter sich geändert habe, sein
Auge hatte noch denselben stechenden und dreisten Blick
wie früher.
Es war ihr, als ob über ihrem Glücke eine drohende
Wolke herausziehe. Hier kannte Niemand ihre Vergan-
genheit, sie hatte sich durch ihren Charakter die allgemeine
Achtung erworben, wenn nun Schlobig erzählte, daß ihr
erster Mann ein Verbrechen begangen hatte, so konnte
es leicht einen Makel aus ihren Ruf Wersen. Und daß
er dies thun werde, konnte sie mit Bestimmtheit Vor-
aussehen, wenn ihm irgend ein Vortheil daraus erwuchs.
Ihre beiden ältesten Kinder wußten nichts weiter,
als daß ihr Vater gestorben war, als sie noch sehr klein
gewesen waren; sie war glücklich gewesen, daß in Phi-
lipp auch der letzte Rest der Erinnerung an das Dorf
allmühlig geschwunden war — konnte Schlobig nicht auch
die Ruhe und das Glück ihrer Kinder vernichten?
Sie ließ sich wieder vor dem Hause nieder, aber
nicht so glücklich als zuvor; trüben Gedanken und ban-
gen Befürchtungen hing sie nach.
Ein Paar Weiche Arme umschlangen sie plötzlich und
als sie erschreckt zusammenzuckte, lachte eine Helle Mäd-
chenstimme laut und lustig auf. Käthe hatte sich an sie
herangeschlichcn und sie umarmt. Die Frau suchte sich
aus den Armen des übermüthigen Mädchens zu befreien,
es gelang ihr nicht.
„Du mußt erst lachen, eherslasse ich Dich nicht!" rief
Käthe.
Christine war nicht aufgelegt zur Heiterkeit, denn die
Begegnung mit Schlobig hatte sie verstimmt und zu
trübe Erinnerungen in ihr wachgerusen.
„Laß, Käthe," entgegnete sie.
„Nein, ich lasse Dich nicht!" fuhr das Mädchen
lachend fort. „Ich kann es nicht leiden, wenn Du ver-
stimmt bist, deshalb mußt Du lachen."
„Laß Dein thörichtes Verlangen, ich kann es heute
nicht," entgegnete Christine fast unwillig.
„Du mußt!" rief Käthe, welche nur zu gut wußte,
daß ihr heiterer Sinn doch schließlich den Sieg davon
trug.
„Frau Schnapset, soll ich Ihnen Beistand leisten?"
ertönte plötzlich eine Stimme dicht hinter ihnen.
Käthe fuhr mit leisem Aufschrei zurück und gab die
Mutter frei. Mutter und Tochter wandten den Kopf
zurück — ein junger Mann stand vor ihnen.
„Ah, Herr Doktor!" rief Christine und ihr Gesicht
nahm sofort einen freundlichen Ausdruck an.
Küthe's Wangen hatten sich nut dunklem Roth über-
deckt.
„Sie sehen, wie schon mein Wort im Stande ist,
Sie zu befreien," fuhr der junge Mann, der kaum die
Mitte der Zwanzig erreicht haben konnte, in scherzen-
dem Tone fort.
„Nein, nicht Ihr Wort!" ries Käthe. „Sie haben
uns erschreckt, uns heimlich überfallen, das ist die Ur-
sache."
„Fräulein, ich bin viel zu harmlos, um Jemand er-
schrecken zu können," entgegnete der junge Mann lachend.
„Räumen Sie doch meinem Worte gutwillig eine solche
Kraft ein, da Sie sich selbst davon überzeugt haben."
„Nein," rief Käthe nut scherzendem Trotze.
Christine streckte dem Hinzugekommenen die Hand
entgegen.
„Sie bringen immer Krieg, Herr Doktor!" sprach
sie lächelnd und in vertraulichem Tone. „Ich möchte
wirklich die Gelegenheit einmal kennen lernen, bei der
Sie und Käthe übereinstimmen."
Der junge Mann Zog einen Stuhl herbei uud ließ
sich Christine gegenüber nieder.
„Frau Schnapset, mich trifft die Schuld nicht," er-
wiederte er lachend. „Ich habe immer versöhnliche
Stimmung, denn zehn bis zwölf Meilen im Umkreise
gibt es keinen Menschen, der so friedfertig ist, wie ich
es bin!"
Küthe lachte zweifelnd auf.
Der junge Mann war der Arzt, Doktor Wilhelm
Leonard, eine mittelgroße, nicht sehr kräftig gebaute,
aber ungemein bewegliche und lebhafte Gestalt. Sein
387
Gesicht war kaum hübsch zu neuuen, allein es machte
einen ungemein fesselnden Eindruck und ans den klugen
Angen leuchtete ein frischer, lustiger Geist.
Der Doktor trug einen leichten grauen Sommeran-
zug und Strohhnt und erschien in demselben noch jün-
ger als er war. Trotz seines ziemlich starken Schnurr-
bartes lag in seiner Erscheinung noch immer etwas
Jünglingartiges. Es hätte auffallcn können, daß er in
so jungen Jahren bereits Arzt war, allein er war noch
nicht selbstständig, sondern Assistent des bereits bejahr-
ten und kränklichen, aber überaus tüchtigen und allge-
mein geschätzten Medicinalrathes Bromming. Dieser
hatte ihn zur Unterstützung in seiner äußerst ausge-
breiteten Praxis angenommen, ihm aber bald dieselbe
ganz allein überlassen, da er sich von seiner Tüchtigkeit
überzeugt hatte. Und fast alle Kranken waren damit
einverstanden, da Leonard etwas ungemein Gewinnendes
und Vertrauen Erweckendes hatte.
„Sind Sie zu Fuß aus der Stadt gekommen?"
fragte Christine.
„Nein, Frau Schuapsel, aus dem Braunen des Me-
dicinalraths," gab Leonard zur Antwort. „Und ich
habe das fette Thier bereits tüchtig in Bewegung gesetzt.
Seit heute Morgen um fünf Uhr ist der Gaul auf den
Beinen gewesen, er liebt solche Anstrengungen nicht
besonders, ich habe ihn deshalb Ihrem Knechte über-
geben, damit er sich erholt."
„Sind Sie spazieren geritten?" fragte Christine.
„Nein, nein, so viel Zeit habe ich nicht," fuhr Leo-
nard fort. „Heute Morgeu in aller Frühe kam ein
Bote aus Westerwald, um mich zu holen. Einem armen
Steinbrecher ist gestern im Steinbruche ein Stein ans
den Kopf gefallen, ich machte mich sofort auf den Weg
und strengte den Braunen mehr an, als der Medicinal-
rath wissen darf; es half ihm und mir nichts, denn
wir kamen Beide zu spät."
„Der Arme war bereits todt?" warf Christine ein.
„Ja, der Tod hatte nicht auf mich gewartet," ent-
gegnete Leonard.
„Und Sie sind trotzdem so heiter?" warf Käthe vor-
wurfsvoll ein.
Leonard richtete das Auge auf das hübsche Mädchen.
„Fräulein, für einen Arzt hat der Tod nicht das
Schreckliche, wie für jeden anderen Menschen," gab er
ernst zur Antwort. „Wollte ich mir jeden Tod eines
Menschen zu Herzen nehmen, so würden Sie mich schwer-
lich je wieder lachen sehen. Ich wende alle Kunst mei-
ner Wissenschaft an, um den Tod fern zu halten, ge-
lingt dies nicht, dann sage ich mir: Du hast das Dei-
nige gethan, die Macht des Naturgesetzes ist stärker als
Du. Und für diesen Mann war ein baldiger Tod eine
Wohlthat, ich hätte ihn nicht retten können, und jede
Verlängerung seines Lebens wäre nur eine Verlängerung
seiner Qualen gewesen. Sie werden dies vielleicht nicht
begreifen und doch sehne ich als Arzt in manchen Fällen
den Tod eines Kranken herbei."
„Hören Sie doch auf das thörichte Mädchen nicht,"
warf Christine ein.
„Doch, doch — ich habe einmal beschlossen, jeden
Angriff zu pariren," entgegnete der junge Arzt lachend.
„Darf ich Sie nun um ein Glas Bier bitten? Noch
habe ich heute nichts genossen und der weite Ritt hat
mich ermüdet; ich muß freilich um Kredit bitten, weil
ich nicht einen Pfennig bei mir habe."
„Sie wissen, daß ich Ihnen mit Vergnügen Alles
ohne Bezahlung gebe," erwiederte Christine. „Ich finde
es begreiflich, daß man das Geld vergißt, wenn man
zu einem schwer Kranken gerufen wird."
„Ich hatte es nicht vergessen, als ich aber an dem La-
ger des Todtcn stand und das Jammern seiner Fran und
Kinder sah, welche den Ernährer verloren haben und
nicht wußten, wovon sie die Begräbnißkosten bezahlen
sollten, da gab ich ihnen alles Geld, welches ich bei
mir hatte."
Christinens Auge ruhte auf dem jungen Arzte, sie
dachte daran, in welcher Lage sie sich selbst befunden
hatte, als Rode todt war.
„Kommen Sie in den nächsten Tagen wieder nach
Westerwald?" fragte sie.
„Ich werde oft dorthin gerufen."
„Bitte, dann geben Sie der unglücklichen Frau dies
hier, ohne zu sagen, von wem es kommt," sprach Chri-
stine und reichte Leonard mehrere Thaler. „Ich will
mehr geben, wenn die Frau iu Noth ist, sagen Sie ihr,
daß sie hieher kommen möge, sie soll nicht leer heim-
kehren."
„Ich nehme gern eine Gabe für die Unglückliche
an," gab Leonard zur Antwort und wandte sich dann
scherzend an Käthe: „Nun, Fräulein, geben Sie mir
nicht auch etwas?"
Einen Augenblick lang sann Käthe nach, dann löste
sie hastig ein schwarzes Seidenband, an dem sie ein
goldenes Kreuz um den Hals trug uud reichte es dein
jungen Arzte.
„Nein, das darf ich nicht nehmen!" rief dieser.
„Doch — doch!" drängte Küthe.
„Nehmen Sie es nur," fiel Christine, einen lielc-
vollen Blick ans ihre Tochter werfend, ein. „Sie hängt
man Ihnen die Jahre kaum ansieht! Wahrhaftig, Sie
blühen ja noch wie eine junge Fran! Christine, Sie
kennen also den Ferdinand Schlobig nicht mehr? Ich
bin es — ich!"
Die Frau zuckte wie erschreckt leicht zusammen, als
sie diesen Namen vernahm, sie faßte sich indessen schnell
und erwiederte freundlich: „Ja, jetzt entsinne ich mich.
Auch Sie kamen mir bekannt vor, allein mein Gedacht-
niß ließ mich im Stiche."
„Ah, das ist vortrefflich, daß ich Sie einmal wieder
sehe; nun setzen Sie sich hieher!" rief Schlobig, ihre
Hand erfassend und auf einen Stuhl neben sich ziehend.
„Ich war ja Rode's bester und treuester Freuud, ich
habe es stets aufrichtig uud gut mit Ihnen gemeint,
deshalb freue ich mich doppelt, daß uns das Geschick
wieder zusammenführt. Cs scheint Ihnen sehr gut zu
gehen."
Christine hatte sich gesetzt, die Begegnung war ihr
nicht angenehm nnd doch konnte sie derselben nicht aus-
weichen. Wie viel trübe Erinnerungen rief dieser Mann
in ihr wach.
„Ja, es geht mir gut," gab sie zur Antwort. „Wenn
mein Mann noch lebte, so würde ich keinen Wunsch
weiter haben."
„Sie lebten glücklich mit ihm?"
„Sehr glücklich!" versicherte Christine. „Er war
ein ehrlicher und guter Charakter."
„Das freut mich," fuhr Schlobig fort. „Ich habe
immer gesagt, der Christine muß es gut gehen, denn sie
ist eine vortreffliche Frau, wie es uur wenige gibt. Oft
habe ich mich nach Ihnen erkundigt, allein ich erfuhr
uur, daß Sie sich hieher gewandt hätten, weiter habe
ich nie etwas gehört. Wie viele Kinder haben Sie
denn?"
„Vier."
„So viel hatten Sie schon, als Sie einst das Dorf
verließen."
„Ich besitze von jenen nur die beiden Nettesten noch."
„Was ist aus den beiden Jüngsten, aus den Zwil-
lingen, geworden?" forschte Schlobig weiter
Christine zuckte bei dieser Frage leicht zusammen
und zögerte mit der Antwort. Sie konnte ihm nicht
sagen, daß sie dieselben in Verzweiflung dem Findelhause
anvcrtraut habe.
„Sie find todt," entgegnete sie endlich.
„Schon lauge?"
„Ja, schon lange."
Es war Schlobig das Zögern in Christinens Ant-
wort nicht entgangen, forschend rnhte fein Auge auf
ihrem Gesichte. Wenn die Kinder schon feit langen
Jahren todt waren, so konnte sie unmöglich noch darum
trauern.
Christine schien das Gespräch von diesem Gegenstände
ablenken zu wollen, denn sie fragte: „Auch Ihnen scheint
es gut zu gehen?"
„Ich bin zufrieden." erwiederte Schlobig mit selbst-
bewußtem Lächeln. „Ich habe mir so viel erworben,
daß ich ohne Sorge und gut davon leben kann. Frei-
lich bin ich viel in der Welt umhergekommen, deshalb
habe ich auch nicht daran denken können, mich zu ver-
heirathen. Das Glück des Familienlebens habe ich ent-
behren müssen und entbehre es noch, und jetzt bin ich
zu alt, um an ein solches Glück noch denken zu könuen."
Er lächelte dabei und schien zu erwarten, daß Chri-
stine ihm widersprechen werde, sie erwiederte indessen
ruhig: „Es kann nicht ein Jeder das erreichen, was er
wünscht; man muß zufrieden fein, wenn es Einein leid- -
lich ergeht. — Wohnen Sie jetzt in der Stadt?"
„Ja, ich habe mich dort niedergelassen und werde
auch dort bleiben, obschon ich leben kann, wo ich will,"
gab Schlobig zur Antwort. „Da ich keine Beschäfti-
gung habe, werde ich oft zur Wassermühle kommen."
Christine antwortete nicht, denn sie war über diese
Aussicht nicht besonders erfreut.
„Haben Sie von Düringer nie etwas wieder ge-
hört?" fragte Schlobig.
„Nein. Als ich das Dorf verließ, hatte er die
Fabrik bereits verkauft, und ich habe nie mehr von
ihm gehört; ich wünsche und Hoffeindessen, daß es ihm
gut ergehen möge."
lieber Schlobig's Gesicht zuckte ein Lächeln. Mit
keinem Worte erwähnte er, daß Düringer in der Stadt
wohnte und daß er ihn wieder getroffen. Er war ein
Charakter, der nie mehr verrietst, als nöthig war, weil
er stets den Gedanken hegte, daß er aus dem, was er
wußte, noch einmal Nutzen ziehen könne. Halb neu-
gierig und halb theilnehmend blickte er sich um.
„Die Wassermühle wird wohl viel besucht?" fragte er.
„Wir haben alle Ursache, zufrieden zu sein."
„Haha! Und dabei machen Sie auch ein hübsches
Geschäft," fuhr Schlobig lachend fort. „Mir erzählte
ein Mann, mit dem ich auf dein Wege hieher zusam-
mentraf, die Wassermühle fei eine Goldgrube und ihr
Besitzer ein reicher Mann."
In dreister und doch schlauer Weise forschte er wei-
ter und weiter, bis er aus Christinens Antworten er-
fahren Hatte, daß sie jetzt die alleinige Besitzerin sei,
weil ihre beiden jüngsten Kinder noch nicht mündig seien.
Das Buch für Alle.
„Und wie steht es mit Ihren beiden ältesten Kin-
dern?" fragte Schlobig.
„Auch für deren Zukunft hat mein Mann gesorgt,"
gab Christine zur Antwort. „Sie waren seine Stief-
kinder, er hat sie dies indessen nie fühlen lassen und
sie hingen auch an ihm, wie Kinder nur an ihrem Vater-
hängen können."
Schlobig erhob sich endlich zur Heimkehr. Er reichte
der stattlichen und noch immer hübschen Frau die Hand
und behielt die ihrige einige Minuten lang in der
seinigen.
„Ich komme bald wieder," versicherte er. „Wir
sind ja alte Freunde und ich hoffe, daß wir es bleiben
werden; ich wenigstens bin zu ehrlich und auch zu gut-
müthig, um je einen alten Freund zu vergessen."
Christine schwieg; sie athmete erleichtert aus, als
Schlobig fortgegaugen war, denn in seiner Nähe hatte
sie, wie schon vor Jahren, ein beängstigendes Gefühl
empfunden. Und auch jetzt hallte Bangigkeit in ihr
noch nach. Sie kannte Schlobig zu gut, um erwarten
zu können, daß sein Charakter sich geändert habe, sein
Auge hatte noch denselben stechenden und dreisten Blick
wie früher.
Es war ihr, als ob über ihrem Glücke eine drohende
Wolke herausziehe. Hier kannte Niemand ihre Vergan-
genheit, sie hatte sich durch ihren Charakter die allgemeine
Achtung erworben, wenn nun Schlobig erzählte, daß ihr
erster Mann ein Verbrechen begangen hatte, so konnte
es leicht einen Makel aus ihren Ruf Wersen. Und daß
er dies thun werde, konnte sie mit Bestimmtheit Vor-
aussehen, wenn ihm irgend ein Vortheil daraus erwuchs.
Ihre beiden ältesten Kinder wußten nichts weiter,
als daß ihr Vater gestorben war, als sie noch sehr klein
gewesen waren; sie war glücklich gewesen, daß in Phi-
lipp auch der letzte Rest der Erinnerung an das Dorf
allmühlig geschwunden war — konnte Schlobig nicht auch
die Ruhe und das Glück ihrer Kinder vernichten?
Sie ließ sich wieder vor dem Hause nieder, aber
nicht so glücklich als zuvor; trüben Gedanken und ban-
gen Befürchtungen hing sie nach.
Ein Paar Weiche Arme umschlangen sie plötzlich und
als sie erschreckt zusammenzuckte, lachte eine Helle Mäd-
chenstimme laut und lustig auf. Käthe hatte sich an sie
herangeschlichcn und sie umarmt. Die Frau suchte sich
aus den Armen des übermüthigen Mädchens zu befreien,
es gelang ihr nicht.
„Du mußt erst lachen, eherslasse ich Dich nicht!" rief
Käthe.
Christine war nicht aufgelegt zur Heiterkeit, denn die
Begegnung mit Schlobig hatte sie verstimmt und zu
trübe Erinnerungen in ihr wachgerusen.
„Laß, Käthe," entgegnete sie.
„Nein, ich lasse Dich nicht!" fuhr das Mädchen
lachend fort. „Ich kann es nicht leiden, wenn Du ver-
stimmt bist, deshalb mußt Du lachen."
„Laß Dein thörichtes Verlangen, ich kann es heute
nicht," entgegnete Christine fast unwillig.
„Du mußt!" rief Käthe, welche nur zu gut wußte,
daß ihr heiterer Sinn doch schließlich den Sieg davon
trug.
„Frau Schnapset, soll ich Ihnen Beistand leisten?"
ertönte plötzlich eine Stimme dicht hinter ihnen.
Käthe fuhr mit leisem Aufschrei zurück und gab die
Mutter frei. Mutter und Tochter wandten den Kopf
zurück — ein junger Mann stand vor ihnen.
„Ah, Herr Doktor!" rief Christine und ihr Gesicht
nahm sofort einen freundlichen Ausdruck an.
Küthe's Wangen hatten sich nut dunklem Roth über-
deckt.
„Sie sehen, wie schon mein Wort im Stande ist,
Sie zu befreien," fuhr der junge Mann, der kaum die
Mitte der Zwanzig erreicht haben konnte, in scherzen-
dem Tone fort.
„Nein, nicht Ihr Wort!" ries Käthe. „Sie haben
uns erschreckt, uns heimlich überfallen, das ist die Ur-
sache."
„Fräulein, ich bin viel zu harmlos, um Jemand er-
schrecken zu können," entgegnete der junge Mann lachend.
„Räumen Sie doch meinem Worte gutwillig eine solche
Kraft ein, da Sie sich selbst davon überzeugt haben."
„Nein," rief Käthe nut scherzendem Trotze.
Christine streckte dem Hinzugekommenen die Hand
entgegen.
„Sie bringen immer Krieg, Herr Doktor!" sprach
sie lächelnd und in vertraulichem Tone. „Ich möchte
wirklich die Gelegenheit einmal kennen lernen, bei der
Sie und Käthe übereinstimmen."
Der junge Mann Zog einen Stuhl herbei uud ließ
sich Christine gegenüber nieder.
„Frau Schnapset, mich trifft die Schuld nicht," er-
wiederte er lachend. „Ich habe immer versöhnliche
Stimmung, denn zehn bis zwölf Meilen im Umkreise
gibt es keinen Menschen, der so friedfertig ist, wie ich
es bin!"
Küthe lachte zweifelnd auf.
Der junge Mann war der Arzt, Doktor Wilhelm
Leonard, eine mittelgroße, nicht sehr kräftig gebaute,
aber ungemein bewegliche und lebhafte Gestalt. Sein
387
Gesicht war kaum hübsch zu neuuen, allein es machte
einen ungemein fesselnden Eindruck und ans den klugen
Angen leuchtete ein frischer, lustiger Geist.
Der Doktor trug einen leichten grauen Sommeran-
zug und Strohhnt und erschien in demselben noch jün-
ger als er war. Trotz seines ziemlich starken Schnurr-
bartes lag in seiner Erscheinung noch immer etwas
Jünglingartiges. Es hätte auffallcn können, daß er in
so jungen Jahren bereits Arzt war, allein er war noch
nicht selbstständig, sondern Assistent des bereits bejahr-
ten und kränklichen, aber überaus tüchtigen und allge-
mein geschätzten Medicinalrathes Bromming. Dieser
hatte ihn zur Unterstützung in seiner äußerst ausge-
breiteten Praxis angenommen, ihm aber bald dieselbe
ganz allein überlassen, da er sich von seiner Tüchtigkeit
überzeugt hatte. Und fast alle Kranken waren damit
einverstanden, da Leonard etwas ungemein Gewinnendes
und Vertrauen Erweckendes hatte.
„Sind Sie zu Fuß aus der Stadt gekommen?"
fragte Christine.
„Nein, Frau Schuapsel, aus dem Braunen des Me-
dicinalraths," gab Leonard zur Antwort. „Und ich
habe das fette Thier bereits tüchtig in Bewegung gesetzt.
Seit heute Morgen um fünf Uhr ist der Gaul auf den
Beinen gewesen, er liebt solche Anstrengungen nicht
besonders, ich habe ihn deshalb Ihrem Knechte über-
geben, damit er sich erholt."
„Sind Sie spazieren geritten?" fragte Christine.
„Nein, nein, so viel Zeit habe ich nicht," fuhr Leo-
nard fort. „Heute Morgeu in aller Frühe kam ein
Bote aus Westerwald, um mich zu holen. Einem armen
Steinbrecher ist gestern im Steinbruche ein Stein ans
den Kopf gefallen, ich machte mich sofort auf den Weg
und strengte den Braunen mehr an, als der Medicinal-
rath wissen darf; es half ihm und mir nichts, denn
wir kamen Beide zu spät."
„Der Arme war bereits todt?" warf Christine ein.
„Ja, der Tod hatte nicht auf mich gewartet," ent-
gegnete Leonard.
„Und Sie sind trotzdem so heiter?" warf Käthe vor-
wurfsvoll ein.
Leonard richtete das Auge auf das hübsche Mädchen.
„Fräulein, für einen Arzt hat der Tod nicht das
Schreckliche, wie für jeden anderen Menschen," gab er
ernst zur Antwort. „Wollte ich mir jeden Tod eines
Menschen zu Herzen nehmen, so würden Sie mich schwer-
lich je wieder lachen sehen. Ich wende alle Kunst mei-
ner Wissenschaft an, um den Tod fern zu halten, ge-
lingt dies nicht, dann sage ich mir: Du hast das Dei-
nige gethan, die Macht des Naturgesetzes ist stärker als
Du. Und für diesen Mann war ein baldiger Tod eine
Wohlthat, ich hätte ihn nicht retten können, und jede
Verlängerung seines Lebens wäre nur eine Verlängerung
seiner Qualen gewesen. Sie werden dies vielleicht nicht
begreifen und doch sehne ich als Arzt in manchen Fällen
den Tod eines Kranken herbei."
„Hören Sie doch auf das thörichte Mädchen nicht,"
warf Christine ein.
„Doch, doch — ich habe einmal beschlossen, jeden
Angriff zu pariren," entgegnete der junge Arzt lachend.
„Darf ich Sie nun um ein Glas Bier bitten? Noch
habe ich heute nichts genossen und der weite Ritt hat
mich ermüdet; ich muß freilich um Kredit bitten, weil
ich nicht einen Pfennig bei mir habe."
„Sie wissen, daß ich Ihnen mit Vergnügen Alles
ohne Bezahlung gebe," erwiederte Christine. „Ich finde
es begreiflich, daß man das Geld vergißt, wenn man
zu einem schwer Kranken gerufen wird."
„Ich hatte es nicht vergessen, als ich aber an dem La-
ger des Todtcn stand und das Jammern seiner Fran und
Kinder sah, welche den Ernährer verloren haben und
nicht wußten, wovon sie die Begräbnißkosten bezahlen
sollten, da gab ich ihnen alles Geld, welches ich bei
mir hatte."
Christinens Auge ruhte auf dem jungen Arzte, sie
dachte daran, in welcher Lage sie sich selbst befunden
hatte, als Rode todt war.
„Kommen Sie in den nächsten Tagen wieder nach
Westerwald?" fragte sie.
„Ich werde oft dorthin gerufen."
„Bitte, dann geben Sie der unglücklichen Frau dies
hier, ohne zu sagen, von wem es kommt," sprach Chri-
stine und reichte Leonard mehrere Thaler. „Ich will
mehr geben, wenn die Frau iu Noth ist, sagen Sie ihr,
daß sie hieher kommen möge, sie soll nicht leer heim-
kehren."
„Ich nehme gern eine Gabe für die Unglückliche
an," gab Leonard zur Antwort und wandte sich dann
scherzend an Käthe: „Nun, Fräulein, geben Sie mir
nicht auch etwas?"
Einen Augenblick lang sann Käthe nach, dann löste
sie hastig ein schwarzes Seidenband, an dem sie ein
goldenes Kreuz um den Hals trug uud reichte es dein
jungen Arzte.
„Nein, das darf ich nicht nehmen!" rief dieser.
„Doch — doch!" drängte Küthe.
„Nehmen Sie es nur," fiel Christine, einen lielc-
vollen Blick ans ihre Tochter werfend, ein. „Sie hängt