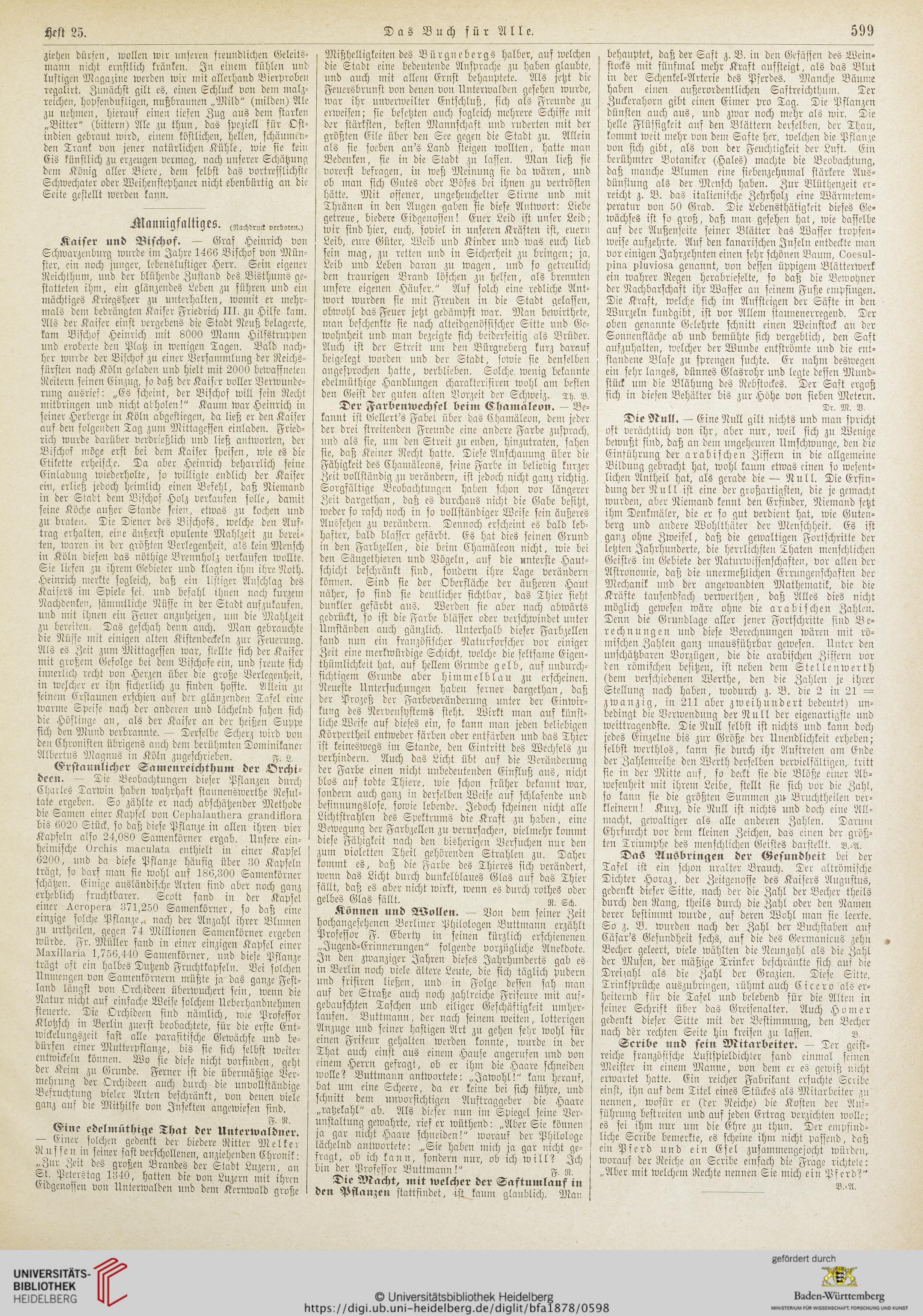Hrft 25.
ziehen dürfen, wollen wir nnferen freundlichen Geleits-
mann nicht ernstlich kränken. In einen: kühlen und
luftigen Magazine werden wir mit allerhand Bierproben
regalirt. Zunächst gilt es, einen Schluck vou dem malz-
reichen, hopfendufligen, nußbraunen „Mild" (milden) Ale
zu nehmen, hierauf einen liefen Zug aus dem starken
„Bitter" (bittern) Ale zu thun, das speziell für Ost-
indien gebraut wird, einem köstlichen, Hellen, schäumen-
den Trank von jener natürlichen Kühle, wie sie kein
Eis künstlich zu erzeugen vermag, nach unserer Schätzung
dem König aller Biere, dem selbst das vortrefflichste
Schwechater oder Weihenstephaner nicht ebenbürtig an die
Seite gestellt werden kann.
Mannigfaltiges.
(Nachdruck verboten.)
Kaiser und Bischof. — Graf, Heinrich von
Schwarzenburg wurde in: Jahre 1466 Bischof von Mün-
ster, ein noch junger, lebenslustiger Herr. Sein eigener
Reichthnm, und der blühende Zustand des Bisthums ge-
statteten ihn:, ein glänzendes Leben zu führen und ein
mächtiges 'Kriegsheer zu unterhalten, womit er mehr-
mals dem bedrängten Kaiser Friedrich III. zu Hilfe kam.
Als der Kaiser einst vergebens die Stadt Neuß belagerte,
kam Bischof Heinrich nut 8000 Mann Hilfstrnppen
und eroberte den Platz in wenigen Tagen. Bald nach-
her wurde der Bischof zu einer Versammlung der Reichs-
fürsten nach Köln geladen und hielt mit 2000 bewaffneten
Reitern seinen Einzug, so daß der Kaiser voller Verwunde-
rung ausrief: „Es scheint, der Bischof will sein Recht
mitbringen und nicht abholen!" Kaum war Heinrich in
seiner Herberge in Köln abgestiegen, da ließ er den Kaiser-
aus den folgenden Tag zum Mittagessen einladen. Fried-
rich wurde darüber verdrießlich und ließ antworten, der
Bischof möge erst bei dem Kaiser speisen, wie es die
Etikette erheische. Da aber Heinrich beharrlich seine
Einladung wiederholte, so willigte endlich der Kaiser
ein, erließ jedoch heimlich einen Befehl, daß Niemand
in der Stadt dem Bischof Holz verkaufen solle, damit
seine Köche außer Stande feien, etwas zu kochen und
zu braten. Die Diener des Bischofs, welche den Auf-
trag erhalten, eine äußerst opulente Mahlzeit zu berei-
ten, waren in der größten Verlegenheit, als kein Mensch
in Köln diesen das nöthige Brennholz verkaufen wollte.
Sie liefen zu ihren: Gebieter und klagten ihm ihre Noth.
Heinrich merkte sogleich, daß ein listiger Anschlag des
Kaisers in: Spiele sei, und befahl ihnen nach kurzen:
Nachdenken, sämmtliche Nüsse in der Stadt aufzukaufen,
und mit ihnen ein Feuer anzuheizen, um die Mahlzeit
zu bereiten. Das geschah denn auch. Man gebrauchte
die Nüsse mit einigen alten Kistendeckeln zur Feuerung.
Als es Zeit zum Mittagessen war, stellte sich der Kaiser
mit großem Gefolge bei den: Bischöfe ein, und freute sich
innerlich recht von Herzen über die große Verlegenheit,
in wejcher er ihn sicherlich zu finden hoffte. Allein zu
seinem Erstaunen erschien aus der glänzenden Tafel eine
warme Speise nach der anderen und lächelnd sahen sich
die Höflinge an, als der Kaiser an der heißen Suppe
sich den Mund verbrannte. — Derselbe Scherz wird von
den Chronisten übrigens auch den: berühmten Dominikaner
Albertus Magnus in Köln zugeschrieben. F. L.
Erstaunlicher Samenreichthunr der Orchi-
deen. — Die Beobachtungen dieser Pflanzen durch
Charles Darwin haben wahrhaft stannenswerthe Resul-
tate ergeben. So zählte er nach abschätzender Methode
die Samen einer Kapsel von Oopbalantbora Zranckittora
bis 6020 Stück, so daß diese Pflanze in allen ihren vier
Kapseln also 24,080 Samenkörner ergab. Unsere ein-
heimische Orebi8 maeutata enthielt in einer Kapsel
6200, und da diese Pflanze häufig über 30 Kapseln
trägt, so darf man sie wohl auf 186,300 Samenkörner-
schätzen. Einige ausländische Arten find aber noch ganz
erheblich fruchtbarer. Scott fand in der Kapsel
einer ^eropsra 371,250 Samenkörner, so daß eine
einzige solche Pflanze, nach, der Anzahl ihrer Blumen
zu urtheilen, gegen 74 Millionen Samenkörner ergeben
würde. Fr. Müller fand in einer einzigen Kapsel einer
Naxillaria 1,756,440 Samenkörner, und diese Pflanze
trägt oft ein halbes Dutzend Fruchtkapseln. Bei solchen
Unmengen von Samenkörnern müßte ja das ganze Fest-
land längst von Orchideen überwuchert sein, wenn die
Natur nicht auf einfache Weise solchem Ueberhandnehmen
steuerte. Die Orchideen sind nämlich, wie Professor
Klotzsch in Berlin zuerst beobachtete, für die erste Ent-
wickelungszeit fast alle parasitische Gewächse und be-
dürfen einer Mutterpflanze, bis sie sich selbst weiter-
entwickeln können. Wo sie diese nicht vorfinden, geht
der Kein: zu Grunde. Ferner ist die übermäßige Ver-
mehrung der Orchideen auch durch die unvollständige
Befruchtung vieler Arten beschränkt, von denen viele
ganz auf die Mithilfe von Infekten angewiesen sind.
F- N.
Eine edelmüthige That der Unterwaldner.
Einer solchen gedenkt der biedere Ritter Melker
Russen in seiner fast verschollenen, anziehenden Chronik:
„Zur Zeit des großen Brandes der Stadt Luzern, an
St Peterstag 1340, hatten die von Luzern nut ihren
Endgenossen von Unterwalden und den: Kernwald große
Das Buch für Alle.
Mißhelligkeitendes Bürgnebergs halber, auf welchen
die Stadt eine bedeutende Ansprache zu haben glaubte,
und auch mit allein Ernst behauptete. Als jetzt die
Feuersbrunst von denen von Unterwalden gesehen wurde,
war ihr unverweilter Entschluß, sich als Freunde zu
erweisen; sie besetzten auch sogleich mehrere Schiffe mit
der stärksten, besten Mannschaft und ruderten mit der
größten Eile über den See gegen die Stadt zu. Allein
als sie soeben an's Land steigen wollten, hatte inan
Bedenken, sie in die Stadt zu lassen. Man ließ sie
vorerst befragen, in weß Meinung sie da wären, und
ob inan sich Gutes oder Böses bei ihnen zu vertröste):
Hütte. Mit offener, ungeheuchelter Stirne und mit
Thränen in den Angen gaben sie diese Antwort: Liebe
getreue, biedere Eidgenossen! Euer Leid ist unser Leid;
wir sind hier, euch, soviel in unseren Kräften ist, euer::
Leib, eure Güter, Weib und Kinder und was euch lieb
sein mag, zu retten und in Sicherheit zu bringen; ja,
Leib und Leben daran zu wagen, und so getreulich
den traurigen Brand löschen zn helfen, als brennten
unsere eigenen Häuser." Auf solch eine redliche Ant-
wort wurden sie mit Freuden in die Stadt gelassen,
obwohl das Feuer jetzt gedämpft war. Man bewirthete,
inan beschenkte sie nach alteidgenössischer Sitte und Ge-
wohnheit und inan bezeigte sich beiderseitig als Brüder.
Auch ist der Streit um den Bürgneberg kurz darauf
beigelegt worden und der Stadt, sowie sie denselben
angesprochen hatte, verblieben. Solche wenig bekannte
edelmüthige Handlungen charaktcrisiren Wohl an: besten
den Geist der guten alten Vorzeit der Schweiz. Th. B.
Der Farbenwechsel beim Chamäleon. — Be-
kannt ist Gellerlls Fabel über das Chamäleon, den: jeder
der drei streitenden Freunde eine andere Farbe zusprach,
und als sie, um den Streit zu enden, hjnzutraten, sahen
sie, daß Keiner Recht hatte. Diese Anschauung über die
Fähigkeit des Chamäleons, seine Farbe in beliebig knrzer
Zeit vollständig zu verändern, ist jedoch nicht ganz richtig.
Sorgfältige Beobachtungen haben schon vor längerer
Zeit dargethan, daß es durchaus nicht die Gabe besitzt,
weder so rasch noch in so vollständiger Weise sein äußeres
Aussehen zu veräudern. Dennoch erscheint es bald leb-
hafter, bald blasser gefärbt. Es hat dies seinen Grund
in den Farbzellen, die beim Chamäleon nicht, wie bei
den Sängethieren und Vögeln, aus die unterste Haut-
schicht beschränkt sind, sondern ihre Lage verändern
können. Sind sie der Oberfläche der äußeren Haut
näher, so sind sie deutlicher sichtbar, das Thier sieht
dunkler gefärbt aus. Werden sic aber nach abwärts
gedrückt, so ist die Farbe blässer oder verschwindet unter
Umständen auch gänzlich. Unterhalb dieser Farbzellen
fand nun ein französischer Naturforscher vor einiger
Zeit eine merkwürdige Schicht, welche die seltsame Eigen-
thümlichkeit hat, aus hellem Grunde gelb, auf undurch-
sichtigem Grunde aber himmelblau zu erscheinen.
Neueste Untersuchungen haben ferner dargethan, daß
der Prozeß der Farbeveränderung unter der Einwir-
kung des Nervensystems steht. Wirkt man auf künst-
liche Weise auf dieses ein, so kann man jeden beliebigen
Körpertheil entweder färben oder entfärben und das Thier
ist keineswegs im Stande, den Eintritt des Wechsels zu
verhindern. Auch das Licht übt auf die Veränderung
der Farbe einen nicht unbedeutenden Einfluß aus, nicht
blos auf todte Thiere, wie schon früher bekannt war,
sondern auch ganz in derselben Weise auf schlafende und
besinnungslose, sowie lebende. Jedoch scheinen nicht alle
Lichtstrahlen des Spektrums die Kraft zu haben, eine
Bewegung der Farbzellen zu verursache,:, vielmehr kommt
diese Fähigkeit nach den bisherigen Versuchen nur den
zum violetten Theil gehörenden Strahlen zn. Daher-
kommt es, daß die Farbe des Thieres sich verändert,
wenn das Licht durch dunkelblaues Glas auf das Thier
fällt, daß es aber nicht wirkt, wenn es durch rothes oder-
gelbes Glas fällt. R. Sch.
Können und VZollen. — Von den: seiner Zeit
hochangesehenen Berliner Philologen Buttmann erzählt
Professor F. Eberth in seinen kürzlich erschienenen
„Jugend-Erinnerungen" folgende vorzügliche Anekdote.
In den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts gab es
in Berlin noch viele ältere Leute, die sich täglich Pudern
und srisiren ließen, und in Folge dessen sah inan
auf der Straße auch noch zahlreiche Friseure mit auf-
gebauschten Taschen und eiliger Geschäftigkeit umher-
laufen. Bnttmann, der nach seinem weiten, lotterigen
Anzuge und feiner hastigen Art zu gehen sehr Wohl für
einen Friseur gehalten werden konnte, wurde in der
That auch einst aus einen: Hause angernfen und von
einem Herrn gefragt, ob er ihn: die Haare schneiden
wolle? Buttmann antwortete: „Jawohl!" kau: herauf,
bat, un: eine Scheere, da er keine bei sich führe, und
schnitt den: unvorsichtigen Auftraggeber die Haare
„ratzekahl" ab. Als dieser nun in: Spiegel seine Ver-
unstaltung gewahrte, rief er wüthend: „Aber Sie können
ja gar nicht Haare schneiden!" worauf der Philologe
lächelnd antwortete: „Sie haben mich ja gar nicht ge-
fragt, ob ich kann, sondern nur, ob ich will? Ich
bin der Professor Buttmann!" F. R.
Die Macht, mit welcher der Saftumlauf in
den Pflanzen stattfindet, ist kaum glaublich. Man
599
behauptet, daß der Saft z. B. in den Gefässen des Wein-
stocks mit fünfmal mehr Kraft anfsteigt, als das Blut
in der Schenkel-Arterie des Pferdes. Manche Bäume
haben einen außerordentlichen Saftreichthun:. Ter
Zuckerahorn gibt einen Eimer pro Tag. Die Pflanzen
dünsten auch aus, und zwar noch mehr als wir. Die
Helle Flüssigkeit ans den Blättern derselben, der Thau,
kommt weit mehr von den: Saste her, welchen die Pflanze
von sich gibt, als von der Feuchtigkeit der Luft. Ein
berühmter Botaniker (Hales) machte die Beobachtung,
daß manche Blumen eine siebenzehnmal stärkere Aus-
dünstung als der Mensch haben. Zur Blütheuzeit er-
reicht z. B. das italienische Zehrholz eine Würmetem-
peratnr von 50 Grad. Die Lebensthätigkeit dieses Ge-
wächses ist so groß, daß man gesehen hat, wie dasselbe
auf der Außenseite seiner Blätter das Wasser tropfen-
weise aufzehrte. Auf den kanarischen Inseln entdeckte man
vor einigen Jahrzehnten einen sehr schönen Baum, Eoemll-
pina pluviosa genannt, von dessen üppigem Blütterwerk
ein wahrer Regen herabrieselte, so daß die Bewohner
der Nachbarschaft ihr Wasser an seinen: Fuße empfingen.
Die Kraft, welche sich in: Aufsteiger: der Säfte in den
Wurzeln kundgibt, ist vor Allen: staunenerregend. Der
oben genannte Gelehrte schnitt einen Weinstock an der
Sonnenfläche ab und bemühte sich vergeblich, den Saft
aufzuhalten, welcher der Wunde entströmte und die ent-
standene Blase zu sprengen suchte. Er nahm deswegen
ein sehr langes, dünnes Glasrohr und legte dessen Mund-
stück un: die Blähung des Rebstockes. Der Saft ergoß
sich in diesen Behälter bis zur Höhe von sieben Metern.
Dr. M. V.
Die Null. — Eine Null gilt nichts und man spricht
oft verächtlich von ihr, aber nur, weil sich zu Wenige
bewußt sind, daß an den: ungeheuren Umschwünge, den die
Einführung der arabischen Ziffern in die allgemeine
Bildung gebracht hat, wohl kaum etwas einen fo wesent-
lichen Antheil hat, als gerade die — Null. Die Erfin-
dung der Null ist eine der großartigsten, die je gemacht
wurden, aber Niemand kennt den Erfinder, Niemand setzt
ihn: Denkmäler, die er so gut verdient hat, wie Guten-
berg und andere Wohlthäter der Menschheit. Es ist
ganz ohne Zweifel, daß die gewaltigen Fortschritte der
letzten Jahrhunderte, die herrlichsten Thaten menschlichen
Geistes in: Gebiete der Naturwissenschaften, vor allen der
Astronomie, daß die unermeßlichen Errungenschaften der
Mechanik und der angewandten Mathematik, die die
Kräfte tausendfach verwerthen, daß Alles dies nicht
möglich gewesen wäre ohne die arabischen Zahlen.
Denn die Grundlage aller jener Fortschritte find Be-
rechnungen und diese Berechnungen wären mit rö-
mischen Zahlen ganz unausführbar gewesen. Unter den
unschätzbaren Vorzügen, die die arabischen Ziffern vor
den römischen besitzen, ist neben dem Stellenwerth
(dem verschiedenen Wertste, den die Zahlen je ihrer
Stellung nach haben, wodurch z. B. die 2 in 21 —
zwanzig, in 211 aber zweihundert bedeutet) un-
bedingt die Verwendung der Null der eigenartigste und
weittragendste. Die Null selbst ist nichts und kann doch
jedes Einzelne bis zur Größe der Unendlichkeit erheben;
selbst werthlos, kann sie durch ihr Auftreten an: Ende
der Zahlenreihe den Werth derselben vervielfältigen, tritt
sie in der Mitte auf, so deckt sie die Blöße einer Ab-
wesenheit mit ihrem Leibe, stellt sie sich vor die Zahl,
so kann sie die größten Summen zw Brnchtheilen ver-
kleinern! Kurz, die Null ist nichts und doch eine All-
macht, gewaltiger als alle anderen Zahlen. Darum
Ehrfurcht vor den: kleinen Zeichen, das einen der größ-
ten Triumphe des menschlichen Geistes darstellt. B.-A.
Das Ausbringen der Gesundheit bei der
Tafel ist ein schon uralter Brauch. Der altrömische
Dichter Horaz, der Zeitgenosse des Kaisers Augustus,
gedenkt dieser Sitte, nach der die Zahl der Becher theils
durch den Rang, theils durch die Zahl oder den Namen
derer bestimmt wurde, auf deren Wohl man sie leerte.
So z. B. wurden nach der Zahl der Buchstaben auf
Cäfar's Gesundheit sechs, auf die des Germaniens zehn
Becher geleert, viele wühlten die Neunzahl als die Zahl
der Musen, der mäßige Trinker beschränkte sich auf die
Dreimhl als die Zahl der Grazien. Diese Sitte,
Trinksprüche auszubriugen, rühmt auch Cicero als er-
heiternd für die Tafel und belebend für die Alten in
seiner Schrift über das Greisenalter. Auch Hvmer
gedenkt dieser Sitte mit der Bestimmung, den Becher
nach der rechten Seite hin kreisen zu lassen. B.
Scribe und sein Mitarbeiter. — Der geist-
reiche französische Lustspieldichter fand einmal feinen
Meister in einem Manne, von dem er es gewiß nicht
erwartet hatte. Ein reicher Fabrikant ersuchte Scnbc
einst, ihn auf dem Titel eines Stückes als Mitarbeiter zn
nennen, wofür er (der Reiche) die Koste:: der Aus-
führung bestreiten und auf jeden Ertrag verzichten wolle;
es fei ihm nur un: die Ehre zu thun. Der empfind-
liche Scribe bemerkte, es scheine ihn: nicht paffend, daß
ein Pferd und ein Esel zusammengejocht würden,
worauf der Reiche an Scribe einfach die Frage richtete:
„Aber mit welchem Rechte nennen Sie mich ein Pferd?"
V.-A.
ziehen dürfen, wollen wir nnferen freundlichen Geleits-
mann nicht ernstlich kränken. In einen: kühlen und
luftigen Magazine werden wir mit allerhand Bierproben
regalirt. Zunächst gilt es, einen Schluck vou dem malz-
reichen, hopfendufligen, nußbraunen „Mild" (milden) Ale
zu nehmen, hierauf einen liefen Zug aus dem starken
„Bitter" (bittern) Ale zu thun, das speziell für Ost-
indien gebraut wird, einem köstlichen, Hellen, schäumen-
den Trank von jener natürlichen Kühle, wie sie kein
Eis künstlich zu erzeugen vermag, nach unserer Schätzung
dem König aller Biere, dem selbst das vortrefflichste
Schwechater oder Weihenstephaner nicht ebenbürtig an die
Seite gestellt werden kann.
Mannigfaltiges.
(Nachdruck verboten.)
Kaiser und Bischof. — Graf, Heinrich von
Schwarzenburg wurde in: Jahre 1466 Bischof von Mün-
ster, ein noch junger, lebenslustiger Herr. Sein eigener
Reichthnm, und der blühende Zustand des Bisthums ge-
statteten ihn:, ein glänzendes Leben zu führen und ein
mächtiges 'Kriegsheer zu unterhalten, womit er mehr-
mals dem bedrängten Kaiser Friedrich III. zu Hilfe kam.
Als der Kaiser einst vergebens die Stadt Neuß belagerte,
kam Bischof Heinrich nut 8000 Mann Hilfstrnppen
und eroberte den Platz in wenigen Tagen. Bald nach-
her wurde der Bischof zu einer Versammlung der Reichs-
fürsten nach Köln geladen und hielt mit 2000 bewaffneten
Reitern seinen Einzug, so daß der Kaiser voller Verwunde-
rung ausrief: „Es scheint, der Bischof will sein Recht
mitbringen und nicht abholen!" Kaum war Heinrich in
seiner Herberge in Köln abgestiegen, da ließ er den Kaiser-
aus den folgenden Tag zum Mittagessen einladen. Fried-
rich wurde darüber verdrießlich und ließ antworten, der
Bischof möge erst bei dem Kaiser speisen, wie es die
Etikette erheische. Da aber Heinrich beharrlich seine
Einladung wiederholte, so willigte endlich der Kaiser
ein, erließ jedoch heimlich einen Befehl, daß Niemand
in der Stadt dem Bischof Holz verkaufen solle, damit
seine Köche außer Stande feien, etwas zu kochen und
zu braten. Die Diener des Bischofs, welche den Auf-
trag erhalten, eine äußerst opulente Mahlzeit zu berei-
ten, waren in der größten Verlegenheit, als kein Mensch
in Köln diesen das nöthige Brennholz verkaufen wollte.
Sie liefen zu ihren: Gebieter und klagten ihm ihre Noth.
Heinrich merkte sogleich, daß ein listiger Anschlag des
Kaisers in: Spiele sei, und befahl ihnen nach kurzen:
Nachdenken, sämmtliche Nüsse in der Stadt aufzukaufen,
und mit ihnen ein Feuer anzuheizen, um die Mahlzeit
zu bereiten. Das geschah denn auch. Man gebrauchte
die Nüsse mit einigen alten Kistendeckeln zur Feuerung.
Als es Zeit zum Mittagessen war, stellte sich der Kaiser
mit großem Gefolge bei den: Bischöfe ein, und freute sich
innerlich recht von Herzen über die große Verlegenheit,
in wejcher er ihn sicherlich zu finden hoffte. Allein zu
seinem Erstaunen erschien aus der glänzenden Tafel eine
warme Speise nach der anderen und lächelnd sahen sich
die Höflinge an, als der Kaiser an der heißen Suppe
sich den Mund verbrannte. — Derselbe Scherz wird von
den Chronisten übrigens auch den: berühmten Dominikaner
Albertus Magnus in Köln zugeschrieben. F. L.
Erstaunlicher Samenreichthunr der Orchi-
deen. — Die Beobachtungen dieser Pflanzen durch
Charles Darwin haben wahrhaft stannenswerthe Resul-
tate ergeben. So zählte er nach abschätzender Methode
die Samen einer Kapsel von Oopbalantbora Zranckittora
bis 6020 Stück, so daß diese Pflanze in allen ihren vier
Kapseln also 24,080 Samenkörner ergab. Unsere ein-
heimische Orebi8 maeutata enthielt in einer Kapsel
6200, und da diese Pflanze häufig über 30 Kapseln
trägt, so darf man sie wohl auf 186,300 Samenkörner-
schätzen. Einige ausländische Arten find aber noch ganz
erheblich fruchtbarer. Scott fand in der Kapsel
einer ^eropsra 371,250 Samenkörner, so daß eine
einzige solche Pflanze, nach, der Anzahl ihrer Blumen
zu urtheilen, gegen 74 Millionen Samenkörner ergeben
würde. Fr. Müller fand in einer einzigen Kapsel einer
Naxillaria 1,756,440 Samenkörner, und diese Pflanze
trägt oft ein halbes Dutzend Fruchtkapseln. Bei solchen
Unmengen von Samenkörnern müßte ja das ganze Fest-
land längst von Orchideen überwuchert sein, wenn die
Natur nicht auf einfache Weise solchem Ueberhandnehmen
steuerte. Die Orchideen sind nämlich, wie Professor
Klotzsch in Berlin zuerst beobachtete, für die erste Ent-
wickelungszeit fast alle parasitische Gewächse und be-
dürfen einer Mutterpflanze, bis sie sich selbst weiter-
entwickeln können. Wo sie diese nicht vorfinden, geht
der Kein: zu Grunde. Ferner ist die übermäßige Ver-
mehrung der Orchideen auch durch die unvollständige
Befruchtung vieler Arten beschränkt, von denen viele
ganz auf die Mithilfe von Infekten angewiesen sind.
F- N.
Eine edelmüthige That der Unterwaldner.
Einer solchen gedenkt der biedere Ritter Melker
Russen in seiner fast verschollenen, anziehenden Chronik:
„Zur Zeit des großen Brandes der Stadt Luzern, an
St Peterstag 1340, hatten die von Luzern nut ihren
Endgenossen von Unterwalden und den: Kernwald große
Das Buch für Alle.
Mißhelligkeitendes Bürgnebergs halber, auf welchen
die Stadt eine bedeutende Ansprache zu haben glaubte,
und auch mit allein Ernst behauptete. Als jetzt die
Feuersbrunst von denen von Unterwalden gesehen wurde,
war ihr unverweilter Entschluß, sich als Freunde zu
erweisen; sie besetzten auch sogleich mehrere Schiffe mit
der stärksten, besten Mannschaft und ruderten mit der
größten Eile über den See gegen die Stadt zu. Allein
als sie soeben an's Land steigen wollten, hatte inan
Bedenken, sie in die Stadt zu lassen. Man ließ sie
vorerst befragen, in weß Meinung sie da wären, und
ob inan sich Gutes oder Böses bei ihnen zu vertröste):
Hütte. Mit offener, ungeheuchelter Stirne und mit
Thränen in den Angen gaben sie diese Antwort: Liebe
getreue, biedere Eidgenossen! Euer Leid ist unser Leid;
wir sind hier, euch, soviel in unseren Kräften ist, euer::
Leib, eure Güter, Weib und Kinder und was euch lieb
sein mag, zu retten und in Sicherheit zu bringen; ja,
Leib und Leben daran zu wagen, und so getreulich
den traurigen Brand löschen zn helfen, als brennten
unsere eigenen Häuser." Auf solch eine redliche Ant-
wort wurden sie mit Freuden in die Stadt gelassen,
obwohl das Feuer jetzt gedämpft war. Man bewirthete,
inan beschenkte sie nach alteidgenössischer Sitte und Ge-
wohnheit und inan bezeigte sich beiderseitig als Brüder.
Auch ist der Streit um den Bürgneberg kurz darauf
beigelegt worden und der Stadt, sowie sie denselben
angesprochen hatte, verblieben. Solche wenig bekannte
edelmüthige Handlungen charaktcrisiren Wohl an: besten
den Geist der guten alten Vorzeit der Schweiz. Th. B.
Der Farbenwechsel beim Chamäleon. — Be-
kannt ist Gellerlls Fabel über das Chamäleon, den: jeder
der drei streitenden Freunde eine andere Farbe zusprach,
und als sie, um den Streit zu enden, hjnzutraten, sahen
sie, daß Keiner Recht hatte. Diese Anschauung über die
Fähigkeit des Chamäleons, seine Farbe in beliebig knrzer
Zeit vollständig zu verändern, ist jedoch nicht ganz richtig.
Sorgfältige Beobachtungen haben schon vor längerer
Zeit dargethan, daß es durchaus nicht die Gabe besitzt,
weder so rasch noch in so vollständiger Weise sein äußeres
Aussehen zu veräudern. Dennoch erscheint es bald leb-
hafter, bald blasser gefärbt. Es hat dies seinen Grund
in den Farbzellen, die beim Chamäleon nicht, wie bei
den Sängethieren und Vögeln, aus die unterste Haut-
schicht beschränkt sind, sondern ihre Lage verändern
können. Sind sie der Oberfläche der äußeren Haut
näher, so sind sie deutlicher sichtbar, das Thier sieht
dunkler gefärbt aus. Werden sic aber nach abwärts
gedrückt, so ist die Farbe blässer oder verschwindet unter
Umständen auch gänzlich. Unterhalb dieser Farbzellen
fand nun ein französischer Naturforscher vor einiger
Zeit eine merkwürdige Schicht, welche die seltsame Eigen-
thümlichkeit hat, aus hellem Grunde gelb, auf undurch-
sichtigem Grunde aber himmelblau zu erscheinen.
Neueste Untersuchungen haben ferner dargethan, daß
der Prozeß der Farbeveränderung unter der Einwir-
kung des Nervensystems steht. Wirkt man auf künst-
liche Weise auf dieses ein, so kann man jeden beliebigen
Körpertheil entweder färben oder entfärben und das Thier
ist keineswegs im Stande, den Eintritt des Wechsels zu
verhindern. Auch das Licht übt auf die Veränderung
der Farbe einen nicht unbedeutenden Einfluß aus, nicht
blos auf todte Thiere, wie schon früher bekannt war,
sondern auch ganz in derselben Weise auf schlafende und
besinnungslose, sowie lebende. Jedoch scheinen nicht alle
Lichtstrahlen des Spektrums die Kraft zu haben, eine
Bewegung der Farbzellen zu verursache,:, vielmehr kommt
diese Fähigkeit nach den bisherigen Versuchen nur den
zum violetten Theil gehörenden Strahlen zn. Daher-
kommt es, daß die Farbe des Thieres sich verändert,
wenn das Licht durch dunkelblaues Glas auf das Thier
fällt, daß es aber nicht wirkt, wenn es durch rothes oder-
gelbes Glas fällt. R. Sch.
Können und VZollen. — Von den: seiner Zeit
hochangesehenen Berliner Philologen Buttmann erzählt
Professor F. Eberth in seinen kürzlich erschienenen
„Jugend-Erinnerungen" folgende vorzügliche Anekdote.
In den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts gab es
in Berlin noch viele ältere Leute, die sich täglich Pudern
und srisiren ließen, und in Folge dessen sah inan
auf der Straße auch noch zahlreiche Friseure mit auf-
gebauschten Taschen und eiliger Geschäftigkeit umher-
laufen. Bnttmann, der nach seinem weiten, lotterigen
Anzuge und feiner hastigen Art zu gehen sehr Wohl für
einen Friseur gehalten werden konnte, wurde in der
That auch einst aus einen: Hause angernfen und von
einem Herrn gefragt, ob er ihn: die Haare schneiden
wolle? Buttmann antwortete: „Jawohl!" kau: herauf,
bat, un: eine Scheere, da er keine bei sich führe, und
schnitt den: unvorsichtigen Auftraggeber die Haare
„ratzekahl" ab. Als dieser nun in: Spiegel seine Ver-
unstaltung gewahrte, rief er wüthend: „Aber Sie können
ja gar nicht Haare schneiden!" worauf der Philologe
lächelnd antwortete: „Sie haben mich ja gar nicht ge-
fragt, ob ich kann, sondern nur, ob ich will? Ich
bin der Professor Buttmann!" F. R.
Die Macht, mit welcher der Saftumlauf in
den Pflanzen stattfindet, ist kaum glaublich. Man
599
behauptet, daß der Saft z. B. in den Gefässen des Wein-
stocks mit fünfmal mehr Kraft anfsteigt, als das Blut
in der Schenkel-Arterie des Pferdes. Manche Bäume
haben einen außerordentlichen Saftreichthun:. Ter
Zuckerahorn gibt einen Eimer pro Tag. Die Pflanzen
dünsten auch aus, und zwar noch mehr als wir. Die
Helle Flüssigkeit ans den Blättern derselben, der Thau,
kommt weit mehr von den: Saste her, welchen die Pflanze
von sich gibt, als von der Feuchtigkeit der Luft. Ein
berühmter Botaniker (Hales) machte die Beobachtung,
daß manche Blumen eine siebenzehnmal stärkere Aus-
dünstung als der Mensch haben. Zur Blütheuzeit er-
reicht z. B. das italienische Zehrholz eine Würmetem-
peratnr von 50 Grad. Die Lebensthätigkeit dieses Ge-
wächses ist so groß, daß man gesehen hat, wie dasselbe
auf der Außenseite seiner Blätter das Wasser tropfen-
weise aufzehrte. Auf den kanarischen Inseln entdeckte man
vor einigen Jahrzehnten einen sehr schönen Baum, Eoemll-
pina pluviosa genannt, von dessen üppigem Blütterwerk
ein wahrer Regen herabrieselte, so daß die Bewohner
der Nachbarschaft ihr Wasser an seinen: Fuße empfingen.
Die Kraft, welche sich in: Aufsteiger: der Säfte in den
Wurzeln kundgibt, ist vor Allen: staunenerregend. Der
oben genannte Gelehrte schnitt einen Weinstock an der
Sonnenfläche ab und bemühte sich vergeblich, den Saft
aufzuhalten, welcher der Wunde entströmte und die ent-
standene Blase zu sprengen suchte. Er nahm deswegen
ein sehr langes, dünnes Glasrohr und legte dessen Mund-
stück un: die Blähung des Rebstockes. Der Saft ergoß
sich in diesen Behälter bis zur Höhe von sieben Metern.
Dr. M. V.
Die Null. — Eine Null gilt nichts und man spricht
oft verächtlich von ihr, aber nur, weil sich zu Wenige
bewußt sind, daß an den: ungeheuren Umschwünge, den die
Einführung der arabischen Ziffern in die allgemeine
Bildung gebracht hat, wohl kaum etwas einen fo wesent-
lichen Antheil hat, als gerade die — Null. Die Erfin-
dung der Null ist eine der großartigsten, die je gemacht
wurden, aber Niemand kennt den Erfinder, Niemand setzt
ihn: Denkmäler, die er so gut verdient hat, wie Guten-
berg und andere Wohlthäter der Menschheit. Es ist
ganz ohne Zweifel, daß die gewaltigen Fortschritte der
letzten Jahrhunderte, die herrlichsten Thaten menschlichen
Geistes in: Gebiete der Naturwissenschaften, vor allen der
Astronomie, daß die unermeßlichen Errungenschaften der
Mechanik und der angewandten Mathematik, die die
Kräfte tausendfach verwerthen, daß Alles dies nicht
möglich gewesen wäre ohne die arabischen Zahlen.
Denn die Grundlage aller jener Fortschritte find Be-
rechnungen und diese Berechnungen wären mit rö-
mischen Zahlen ganz unausführbar gewesen. Unter den
unschätzbaren Vorzügen, die die arabischen Ziffern vor
den römischen besitzen, ist neben dem Stellenwerth
(dem verschiedenen Wertste, den die Zahlen je ihrer
Stellung nach haben, wodurch z. B. die 2 in 21 —
zwanzig, in 211 aber zweihundert bedeutet) un-
bedingt die Verwendung der Null der eigenartigste und
weittragendste. Die Null selbst ist nichts und kann doch
jedes Einzelne bis zur Größe der Unendlichkeit erheben;
selbst werthlos, kann sie durch ihr Auftreten an: Ende
der Zahlenreihe den Werth derselben vervielfältigen, tritt
sie in der Mitte auf, so deckt sie die Blöße einer Ab-
wesenheit mit ihrem Leibe, stellt sie sich vor die Zahl,
so kann sie die größten Summen zw Brnchtheilen ver-
kleinern! Kurz, die Null ist nichts und doch eine All-
macht, gewaltiger als alle anderen Zahlen. Darum
Ehrfurcht vor den: kleinen Zeichen, das einen der größ-
ten Triumphe des menschlichen Geistes darstellt. B.-A.
Das Ausbringen der Gesundheit bei der
Tafel ist ein schon uralter Brauch. Der altrömische
Dichter Horaz, der Zeitgenosse des Kaisers Augustus,
gedenkt dieser Sitte, nach der die Zahl der Becher theils
durch den Rang, theils durch die Zahl oder den Namen
derer bestimmt wurde, auf deren Wohl man sie leerte.
So z. B. wurden nach der Zahl der Buchstaben auf
Cäfar's Gesundheit sechs, auf die des Germaniens zehn
Becher geleert, viele wühlten die Neunzahl als die Zahl
der Musen, der mäßige Trinker beschränkte sich auf die
Dreimhl als die Zahl der Grazien. Diese Sitte,
Trinksprüche auszubriugen, rühmt auch Cicero als er-
heiternd für die Tafel und belebend für die Alten in
seiner Schrift über das Greisenalter. Auch Hvmer
gedenkt dieser Sitte mit der Bestimmung, den Becher
nach der rechten Seite hin kreisen zu lassen. B.
Scribe und sein Mitarbeiter. — Der geist-
reiche französische Lustspieldichter fand einmal feinen
Meister in einem Manne, von dem er es gewiß nicht
erwartet hatte. Ein reicher Fabrikant ersuchte Scnbc
einst, ihn auf dem Titel eines Stückes als Mitarbeiter zn
nennen, wofür er (der Reiche) die Koste:: der Aus-
führung bestreiten und auf jeden Ertrag verzichten wolle;
es fei ihm nur un: die Ehre zu thun. Der empfind-
liche Scribe bemerkte, es scheine ihn: nicht paffend, daß
ein Pferd und ein Esel zusammengejocht würden,
worauf der Reiche an Scribe einfach die Frage richtete:
„Aber mit welchem Rechte nennen Sie mich ein Pferd?"
V.-A.