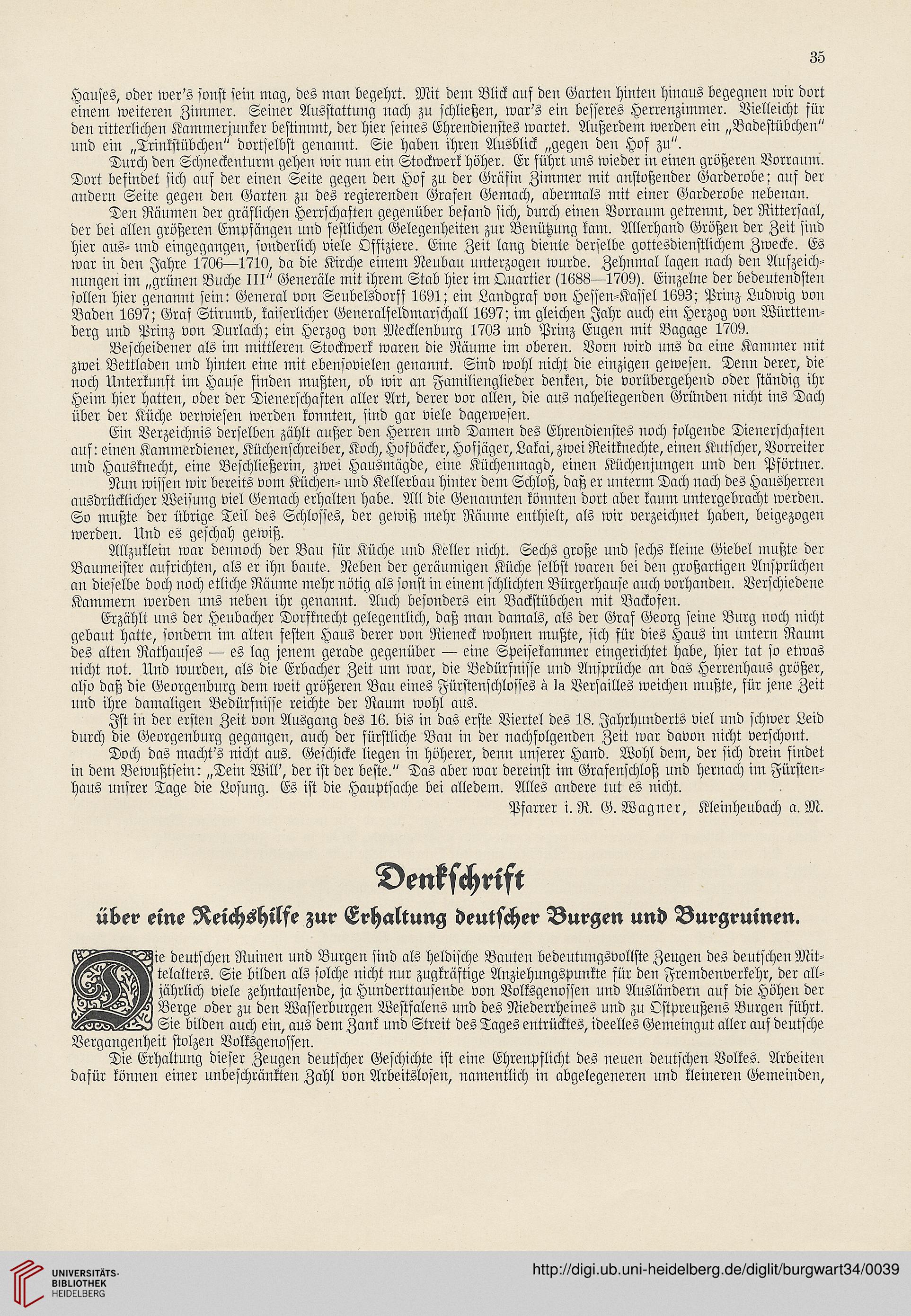35
Hauses, oder wer's sonst sein mag, des man begehrt. Mit dem Blick auf den Garten hinten hinaus begegnen wir dort
einem weiteren Zimmer. Seiner Ausstattung nach zu schließen, war's ein besseres Herrenzimmer. Vielleicht für
den ritterlichen Kammerjunker bestimmt, der hier seines Ehrendienstes wartet. Außerdem werden ein „Badestübchen"
und ein „Trinkstübchen" dortselbst genannt. Sie haben ihren Ausblick „gegen den Hof zu".
Durch den Schneckenturm gehen wir nun ein Stockwerk höher. Er führt uns wieder in einen größeren Vorraum.
Dort befindet sich auf der einen Seite gegen den Hof zu der Gräfin Zimmer mit anstoßender Garderobe; auf der
andern Seite gegen den Garten zu des regierenden Grafen Gemach, abermals mit einer Garderobe nebenan.
Den Räumen der gräflichen Herrschaften gegenüber befand sich, durch einen Vorraum getrennt, der Rittersaal,
der bei allen größeren Empfängen und festlichen Gelegenheiten zur Benützung kam. Allerhand Größen der Zeit sind
hier aus- und eingegangen, sonderlich viele Offiziere. Eine Zeit lang diente derselbe gottesdienstlichem Zwecke. Es
war in den Jahre 1706—1710, da die Kirche einem Neubau unterzogen wurde. Zehnmal lagen nach den Aufzeich-
nungen im „grünen Buche III" Generäle mit ihrem Stab hier im Quartier (1688—1709). Einzelne der bedeutendsten
sollen hier genannt sein: General von Seubelsdorff 1691; ein Landgraf von Hessen-Kassel 1693; Prinz Ludwig von
Baden 1697; Graf Stirumb, kaiserlicher Generalfeldmarschall 1697; im gleichen Jahr auch ein Herzog von Württem-
berg und Prinz von Durlach; ein Herzog von Mecklenburg 1703 und Prinz Eugen mit Bagage 1709.
Bescheidener als im mittleren Stockwerk waren die Räume im oberen. Vorn wird uns da eine Kammer mit
zwei Bettladen und hinten eine mit ebensovielen genannt. Sind wohl nicht die einzigen gewesen. Denn derer, die
noch Unterkunft im Hause finden mußten, ob wir an Familienglieder denken, die vorübergehend oder ständig ihr
Heim hier hatten, oder der Dienerschaften aller Art, derer vor allen, die aus naheliegenden Gründen nicht ins Dach
über der Küche verwiesen werden konnten, sind gar viele dagewesen.
Ein Verzeichnis derselben zählt außer den Herren und Damen des Ehrendienstes noch folgende Dienerschaften
auf: einen Kammerdiener, Küchenschreiber, Koch, Hvfbäcker, Hofjäger, Lakai, zwei Reitknechte, einen Kutscher, Vorreiter
und Hausknecht, eine Beschließerin, zwei Hausmägde, eine Küchenmagd, einen Küchenjungen und den Pförtner.
Nun wissen wir bereits von: Küchen- und Kellerbau hinter dem Schloß, daß er unterm Dach nach des Hausherreil
ausdrücklicher Weisung viel Gemach erhalten habe. All die Genannten könnten dort aber kaum untergebracht werden.
So mußte der übrige Teil des Schlosses, der gewiß mehr Räume enthielt, als wir verzeichnet haben, beigezogen
werden. Und es geschah gewiß.
Allzuklein war dennoch der Bau für Küche und Keller nicht. Sechs große und sechs kleine Giebel mußte der
Baumeister aufrichten, als er ihn baute. Neben der geräumigen Küche selbst waren bei den großartigen Ansprüchen
an dieselbe doch noch etliche Räume inehr nötig als sonst in einem schlichten Bürgerhause auch vorhanden. Verschiedene
Kammern werden uns neben ihr genannt. Auch besonders ein Backstübchen mit Backofen.
Erzählt uns der Heubacher Dorfknecht gelegentlich, daß mail damals, als der Graf Georg seine Burg noch nicht
gebaut hatte, sondern im alteil festen Haus derer von Rieneck wohnen mußte, sich für dies Haus im untern Raum
des alteil Rathauses — es lag jenem gerade gegenüber — eine Speisekammer eingerichtet habe, hier tat so etwas
nicht not. Und wurden, als die Erbacher Zeit um war, die Bedürfnisse und Ansprüche an das Herreilhaus größer,
also daß die Georgenburg dem weit größereil Bau eines Fürstenschlosses ä la Versailles weichen mußte, für jene Zeit
und ihre damaligen Bedürfnisse reichte der Raum wohl aus.
Ist in der ersteil Zeit von Ausgang des 16. bis in das erste Viertel des 18. Jahrhunderts viel und schwer Leid
durch die Georgenburg gegangen, auch der fürstliche Bau in der nachfolgenden Zeit war davon nicht verschollt.
Doch das macht's nicht aus. Geschicke liegeil in höherer, denn unserer Hand. Wohl dem, der sich drein findet
in dein Bewußtsein: „Dein Will', der ist der beste." Das aber war dereinst im Grafenschloß und hernach im Fürsten-
haus unsrer Tage die Losung. Es ist die Hauptsache bei alledem. Alles andere tut es nicht.
Pfarrer i. R. G. Wagner, Kleinheubach a. M.
Denkschrift
über eine Reichshilfe zur Erhaltung deutscher Burgen und Burgruinen.
Hie deutschen Ruinen und Burgen sind als heldische Bauteil bedeutungsvollste Zeugen des deutschen Mit-
1 telalters. Sie bilden als solche nicht nur zugkräftige Anziehungspunkte für den Fremdenverkehr, der all-
jährlich viele zehntausende, ja Hunderttausende von Volksgenossen und Ausländern auf die Höhen der
! Berge oder zu den Wasserburgen Westfalens und des Niederrheines und zu Ostpreußens Burgen führt.
> Sie bilden auch ein, aus dem Zank und Streit des Tages entrücktes, ideelles Gemeingut aller auf deutsche
Vergangenheit stolzen Volksgenossen.
Die Erhaltung dieser Zeugen deutscher Geschichte ist eine Ehrenpflicht des neuen deutschen Volkes. Arbeiteil
dafür können einer unbeschränkten Zahl von Arbeitsloseil, namentlich in abgelegeneren und kleineren Gemeinden,
Hauses, oder wer's sonst sein mag, des man begehrt. Mit dem Blick auf den Garten hinten hinaus begegnen wir dort
einem weiteren Zimmer. Seiner Ausstattung nach zu schließen, war's ein besseres Herrenzimmer. Vielleicht für
den ritterlichen Kammerjunker bestimmt, der hier seines Ehrendienstes wartet. Außerdem werden ein „Badestübchen"
und ein „Trinkstübchen" dortselbst genannt. Sie haben ihren Ausblick „gegen den Hof zu".
Durch den Schneckenturm gehen wir nun ein Stockwerk höher. Er führt uns wieder in einen größeren Vorraum.
Dort befindet sich auf der einen Seite gegen den Hof zu der Gräfin Zimmer mit anstoßender Garderobe; auf der
andern Seite gegen den Garten zu des regierenden Grafen Gemach, abermals mit einer Garderobe nebenan.
Den Räumen der gräflichen Herrschaften gegenüber befand sich, durch einen Vorraum getrennt, der Rittersaal,
der bei allen größeren Empfängen und festlichen Gelegenheiten zur Benützung kam. Allerhand Größen der Zeit sind
hier aus- und eingegangen, sonderlich viele Offiziere. Eine Zeit lang diente derselbe gottesdienstlichem Zwecke. Es
war in den Jahre 1706—1710, da die Kirche einem Neubau unterzogen wurde. Zehnmal lagen nach den Aufzeich-
nungen im „grünen Buche III" Generäle mit ihrem Stab hier im Quartier (1688—1709). Einzelne der bedeutendsten
sollen hier genannt sein: General von Seubelsdorff 1691; ein Landgraf von Hessen-Kassel 1693; Prinz Ludwig von
Baden 1697; Graf Stirumb, kaiserlicher Generalfeldmarschall 1697; im gleichen Jahr auch ein Herzog von Württem-
berg und Prinz von Durlach; ein Herzog von Mecklenburg 1703 und Prinz Eugen mit Bagage 1709.
Bescheidener als im mittleren Stockwerk waren die Räume im oberen. Vorn wird uns da eine Kammer mit
zwei Bettladen und hinten eine mit ebensovielen genannt. Sind wohl nicht die einzigen gewesen. Denn derer, die
noch Unterkunft im Hause finden mußten, ob wir an Familienglieder denken, die vorübergehend oder ständig ihr
Heim hier hatten, oder der Dienerschaften aller Art, derer vor allen, die aus naheliegenden Gründen nicht ins Dach
über der Küche verwiesen werden konnten, sind gar viele dagewesen.
Ein Verzeichnis derselben zählt außer den Herren und Damen des Ehrendienstes noch folgende Dienerschaften
auf: einen Kammerdiener, Küchenschreiber, Koch, Hvfbäcker, Hofjäger, Lakai, zwei Reitknechte, einen Kutscher, Vorreiter
und Hausknecht, eine Beschließerin, zwei Hausmägde, eine Küchenmagd, einen Küchenjungen und den Pförtner.
Nun wissen wir bereits von: Küchen- und Kellerbau hinter dem Schloß, daß er unterm Dach nach des Hausherreil
ausdrücklicher Weisung viel Gemach erhalten habe. All die Genannten könnten dort aber kaum untergebracht werden.
So mußte der übrige Teil des Schlosses, der gewiß mehr Räume enthielt, als wir verzeichnet haben, beigezogen
werden. Und es geschah gewiß.
Allzuklein war dennoch der Bau für Küche und Keller nicht. Sechs große und sechs kleine Giebel mußte der
Baumeister aufrichten, als er ihn baute. Neben der geräumigen Küche selbst waren bei den großartigen Ansprüchen
an dieselbe doch noch etliche Räume inehr nötig als sonst in einem schlichten Bürgerhause auch vorhanden. Verschiedene
Kammern werden uns neben ihr genannt. Auch besonders ein Backstübchen mit Backofen.
Erzählt uns der Heubacher Dorfknecht gelegentlich, daß mail damals, als der Graf Georg seine Burg noch nicht
gebaut hatte, sondern im alteil festen Haus derer von Rieneck wohnen mußte, sich für dies Haus im untern Raum
des alteil Rathauses — es lag jenem gerade gegenüber — eine Speisekammer eingerichtet habe, hier tat so etwas
nicht not. Und wurden, als die Erbacher Zeit um war, die Bedürfnisse und Ansprüche an das Herreilhaus größer,
also daß die Georgenburg dem weit größereil Bau eines Fürstenschlosses ä la Versailles weichen mußte, für jene Zeit
und ihre damaligen Bedürfnisse reichte der Raum wohl aus.
Ist in der ersteil Zeit von Ausgang des 16. bis in das erste Viertel des 18. Jahrhunderts viel und schwer Leid
durch die Georgenburg gegangen, auch der fürstliche Bau in der nachfolgenden Zeit war davon nicht verschollt.
Doch das macht's nicht aus. Geschicke liegeil in höherer, denn unserer Hand. Wohl dem, der sich drein findet
in dein Bewußtsein: „Dein Will', der ist der beste." Das aber war dereinst im Grafenschloß und hernach im Fürsten-
haus unsrer Tage die Losung. Es ist die Hauptsache bei alledem. Alles andere tut es nicht.
Pfarrer i. R. G. Wagner, Kleinheubach a. M.
Denkschrift
über eine Reichshilfe zur Erhaltung deutscher Burgen und Burgruinen.
Hie deutschen Ruinen und Burgen sind als heldische Bauteil bedeutungsvollste Zeugen des deutschen Mit-
1 telalters. Sie bilden als solche nicht nur zugkräftige Anziehungspunkte für den Fremdenverkehr, der all-
jährlich viele zehntausende, ja Hunderttausende von Volksgenossen und Ausländern auf die Höhen der
! Berge oder zu den Wasserburgen Westfalens und des Niederrheines und zu Ostpreußens Burgen führt.
> Sie bilden auch ein, aus dem Zank und Streit des Tages entrücktes, ideelles Gemeingut aller auf deutsche
Vergangenheit stolzen Volksgenossen.
Die Erhaltung dieser Zeugen deutscher Geschichte ist eine Ehrenpflicht des neuen deutschen Volkes. Arbeiteil
dafür können einer unbeschränkten Zahl von Arbeitsloseil, namentlich in abgelegeneren und kleineren Gemeinden,