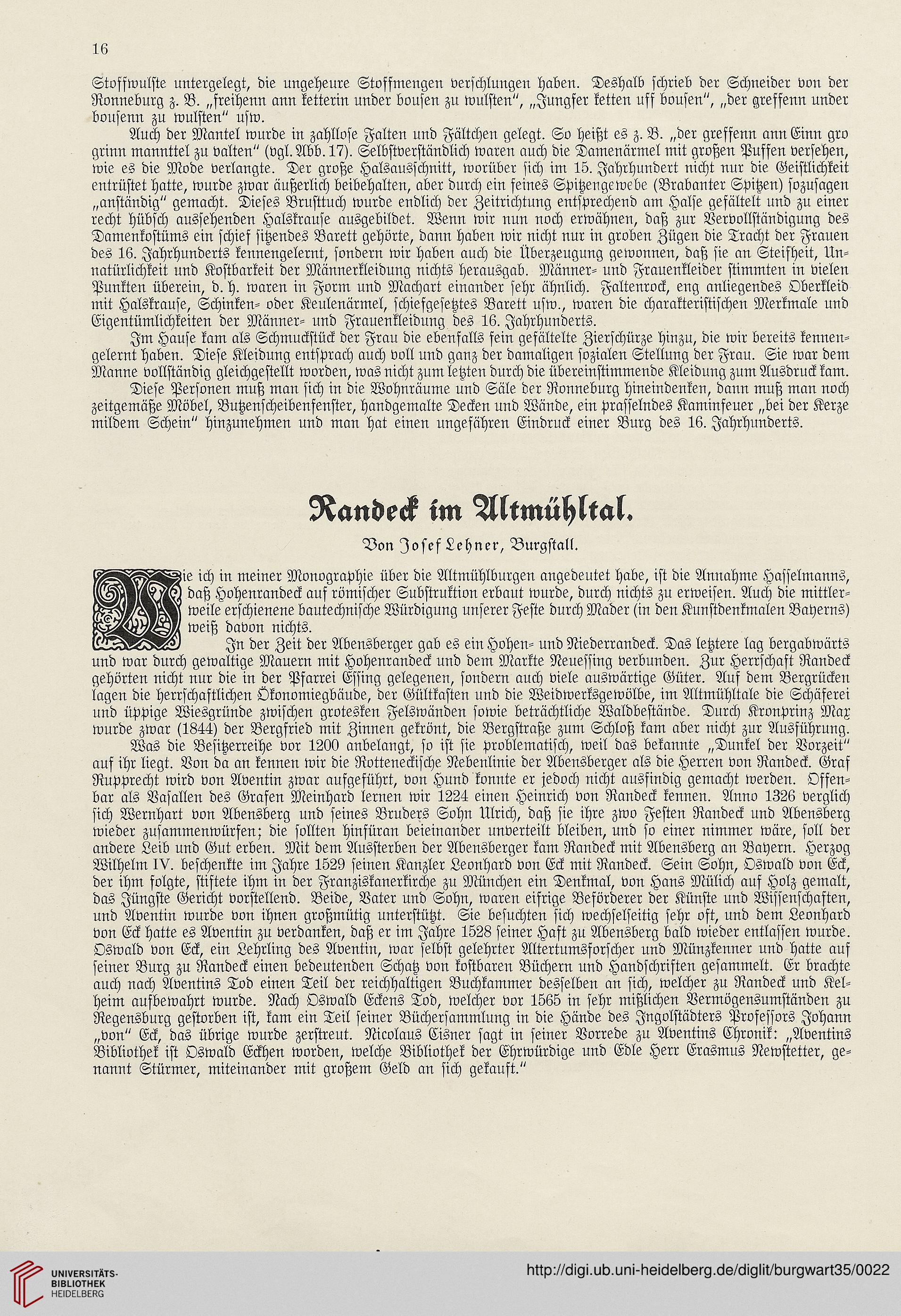16
Stoffwulste untergelegt, die ungeheure Stoffmengen verschlungen haben. Deshalb schrieb der Schneider von der
Ronneburg z. B. „freihenn ann ketterin under bousen zu Wülsten", „Jungfer ketten uff bousen", „der grefferm under
bousenn zu Wülsten" usw.
Auch der Mantel wurde in zahllose Falten und Fältchen gelegt. So heißt es z. B. „der grefferm ann Einn gro
grinn mannttel zu valten" (vgl.Abb. 17). Selbstverständlich waren auch die Damenärmel mit großen Puffen versehen,
wie es die Mode verlangte. Der große Halsausschnitt, worüber sich im 15. Jahrhundert nicht nur die Geistlichkeit
entrüstet hatte, wurde zwar äußerlich beibehalten, aber durch ein feines Spitzengewebe (Brabanter Spitzen) sozusagen
„anständig" gemacht. Dieses Brusttuch wurde endlich der Zeitrichtung entsprechend am Halse gefältelt und zu einer
recht hübsch aussehenden Halskrause ausgebildet. Wenn wir nun noch erwähnen, daß zur Vervollständigung des
Damenkostüms ein schief sitzendes Barett gehörte, dann haben wir nicht nur in groben Zügen die Tracht der Frauen
des 16. Jahrhunderts kennengelernt, sondern wir haben auch die Überzeugung gewonnen, daß sie an Steifheit, Un-
natürlichkeit und Kostbarkeit der Männerkleidung nichts herausgab. Männer- und Frauenkleider stimmten in vielen
Punkten überein, d. h. waren in Form und Machart einander sehr ähnlich. Faltenrock, eng anliegendes Oberkleid
mit Halskrause, Schinken- oder Keulenärmel, schiefgesetztes Barett usw., waren die charakteristischen Merkmale und
Eigentümlichkeiten der Männer- und Frauenkleidung des 16. Jahrhunderts.
Im Hause kam als Schmuckstück der Frau die ebenfalls fein gefältelte Zierschürze hinzu, die wir bereits kennen-
gelernt haben. Diese Kleidung entsprach auch voll und ganz der damaligen sozialen Stellung der Frau. Sie war dem
Manne vollständig gleichgestellt worden, was nicht zun: letzten durch die übereinstimmende Kleidung zum Ausdruck kam.
Diese Personen muß man sich in die Wohnräume und Säle der Ronneburg hineindenken, dann muß man noch
zeitgemäße Möbel, Butzenscheibenfenster, handgemalte Decken und Wände, ein prasselndes Kaminfeuer „bei der Kerze
mildem Schein" hinzunehmen und man hat einen ungefähren Eindruck einer Burg des 16. Jahrhunderts.
Randeck Lm Altmühltal.
Von Josef Lehner, Burgstall.
ich in meiner Monographie über die Altmühlburgen angedeutet habe, ist die Annahme Hasselmanns,
daß Hohenrandeck auf römischer Substruktion erbaut wurde, durch nichts zu erweisen. Auch die mittler-
weile erschienene bautechnische Würdigung unserer Feste durch Mader (in den Kuustdenkmälen Bayerns)
weiß davon nichts.
In der Zeit der Abensberger gab es ein Hohen- und Niederrandeck. Das letztere lag bergabwärts
und war durch gewaltige Mauern mit Hohenrandeck und dem Markte Neuessing verbunden. Zur Herrschaft Randeck
gehörten nicht nur die in der Pfarrei Essing gelegenen, sondern auch viele auswärtige Güter. Auf dem Bergrücken
lagen die herrschaftlichen Okonomiegbäude, der Gültkasten und die Weidwerksgewölbe, im Altmühltale die Schäferei
und üppige Wiesgründe zwischen grotesken Felswänden sowie beträchtliche Wäldbestände. Durch Kronprinz Max
wurde zwar (1844) der Bergfried mit Zinnen gekrönt, die Bergstraße zum Schloß kam aber nicht zur Ausführung.
Was die Besitzerreihe vor 1200 anbelangt, so ist sie problematisch, weil das bekannte „Dunkel der Vorzeit"
aus ihr liegt. Bon da an kennen wir die Rotteneckische Nebenlinie der Abensberger als die Herren von Randeck. Graf
Rupprecht wird von Aventin zwar aufgeführt, von Hund konnte er jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Offen-
bar als Vasallen des Grafen Meinhard lernen wir 1224 einen Heinrich von Randeck kennen. Anno 1326 verglich
sich Wernhart von Abensberg und seines Bruders Sohn Ulrich, daß sie ihre zwo Festen Randeck und Abensberg
wieder zusammenwürfen; die sollten hinfüran beieinander unterteilt bleiben, und so einer nimmer wäre, soll der
andere Leib und Gut erben. Mit dem Aussterben der Abensberger kam Randeck mit Abensberg an Bayern. Herzog
Wilhelm IV. beschenkte im Jahre 1529 seinen Kanzler Leonhard von Eck mit Randeck. Sein Sohn, Oswald von Eck,
der ihm folgte, stiftete ihm in der Franziskanerkirche zu München ein Denkmal, von Hans Millich auf Holz gemalt,
das Jüngste Gericht vorstellend. Beide, Vater und Sohn, waren eifrige Beförderer der Künste und Wissenschaften,
und Aventin wurde von ihnen großmütig unterstützt. Sie besuchten sich wechselseitig sehr oft, und dem Leonhard
von Eck hatte es Aventin zu verdanken, daß er im Jahre 1528 seiner Haft zu Abensberg bald wieder entlassen wurde.
Oswald von Eck, ein Lehrling des Aventin, war selbst gelehrter Altertumsforscher und Münzkenner und hatte auf
seiner Burg zu Randeck einen bedeutenden Schatz von kostbaren Büchern und Handschriften gesammelt. Er brachte
auch nach Aventins Tod einen Teil der reichhaltigen Buchkammer desselben an sich, welcher zu Randeck und Kel-
heim aufbewahrt wurde. Nach Oswald Eckens Tod, welcher vor 1565 in sehr mißlichen Vermögensumständen zu
Regensburg gestorben ist, kam ein Teil seiner Büchersammlung in die Hände des Jngolstädters Professors Johann
„von" Eck, das übrige wurde zerstreut. Nicolaus Cisner sagt in seiner Vorrede zu Aventins Chronik: „Aventins
Bibliothek ist Oswald Eckhen worden, welche Bibliothek der Ehrwürdige und Edle Herr Erasmus Newsletter, ge-
nannt Stürmer, miteinander mit großem Geld an sich gekauft."
Stoffwulste untergelegt, die ungeheure Stoffmengen verschlungen haben. Deshalb schrieb der Schneider von der
Ronneburg z. B. „freihenn ann ketterin under bousen zu Wülsten", „Jungfer ketten uff bousen", „der grefferm under
bousenn zu Wülsten" usw.
Auch der Mantel wurde in zahllose Falten und Fältchen gelegt. So heißt es z. B. „der grefferm ann Einn gro
grinn mannttel zu valten" (vgl.Abb. 17). Selbstverständlich waren auch die Damenärmel mit großen Puffen versehen,
wie es die Mode verlangte. Der große Halsausschnitt, worüber sich im 15. Jahrhundert nicht nur die Geistlichkeit
entrüstet hatte, wurde zwar äußerlich beibehalten, aber durch ein feines Spitzengewebe (Brabanter Spitzen) sozusagen
„anständig" gemacht. Dieses Brusttuch wurde endlich der Zeitrichtung entsprechend am Halse gefältelt und zu einer
recht hübsch aussehenden Halskrause ausgebildet. Wenn wir nun noch erwähnen, daß zur Vervollständigung des
Damenkostüms ein schief sitzendes Barett gehörte, dann haben wir nicht nur in groben Zügen die Tracht der Frauen
des 16. Jahrhunderts kennengelernt, sondern wir haben auch die Überzeugung gewonnen, daß sie an Steifheit, Un-
natürlichkeit und Kostbarkeit der Männerkleidung nichts herausgab. Männer- und Frauenkleider stimmten in vielen
Punkten überein, d. h. waren in Form und Machart einander sehr ähnlich. Faltenrock, eng anliegendes Oberkleid
mit Halskrause, Schinken- oder Keulenärmel, schiefgesetztes Barett usw., waren die charakteristischen Merkmale und
Eigentümlichkeiten der Männer- und Frauenkleidung des 16. Jahrhunderts.
Im Hause kam als Schmuckstück der Frau die ebenfalls fein gefältelte Zierschürze hinzu, die wir bereits kennen-
gelernt haben. Diese Kleidung entsprach auch voll und ganz der damaligen sozialen Stellung der Frau. Sie war dem
Manne vollständig gleichgestellt worden, was nicht zun: letzten durch die übereinstimmende Kleidung zum Ausdruck kam.
Diese Personen muß man sich in die Wohnräume und Säle der Ronneburg hineindenken, dann muß man noch
zeitgemäße Möbel, Butzenscheibenfenster, handgemalte Decken und Wände, ein prasselndes Kaminfeuer „bei der Kerze
mildem Schein" hinzunehmen und man hat einen ungefähren Eindruck einer Burg des 16. Jahrhunderts.
Randeck Lm Altmühltal.
Von Josef Lehner, Burgstall.
ich in meiner Monographie über die Altmühlburgen angedeutet habe, ist die Annahme Hasselmanns,
daß Hohenrandeck auf römischer Substruktion erbaut wurde, durch nichts zu erweisen. Auch die mittler-
weile erschienene bautechnische Würdigung unserer Feste durch Mader (in den Kuustdenkmälen Bayerns)
weiß davon nichts.
In der Zeit der Abensberger gab es ein Hohen- und Niederrandeck. Das letztere lag bergabwärts
und war durch gewaltige Mauern mit Hohenrandeck und dem Markte Neuessing verbunden. Zur Herrschaft Randeck
gehörten nicht nur die in der Pfarrei Essing gelegenen, sondern auch viele auswärtige Güter. Auf dem Bergrücken
lagen die herrschaftlichen Okonomiegbäude, der Gültkasten und die Weidwerksgewölbe, im Altmühltale die Schäferei
und üppige Wiesgründe zwischen grotesken Felswänden sowie beträchtliche Wäldbestände. Durch Kronprinz Max
wurde zwar (1844) der Bergfried mit Zinnen gekrönt, die Bergstraße zum Schloß kam aber nicht zur Ausführung.
Was die Besitzerreihe vor 1200 anbelangt, so ist sie problematisch, weil das bekannte „Dunkel der Vorzeit"
aus ihr liegt. Bon da an kennen wir die Rotteneckische Nebenlinie der Abensberger als die Herren von Randeck. Graf
Rupprecht wird von Aventin zwar aufgeführt, von Hund konnte er jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Offen-
bar als Vasallen des Grafen Meinhard lernen wir 1224 einen Heinrich von Randeck kennen. Anno 1326 verglich
sich Wernhart von Abensberg und seines Bruders Sohn Ulrich, daß sie ihre zwo Festen Randeck und Abensberg
wieder zusammenwürfen; die sollten hinfüran beieinander unterteilt bleiben, und so einer nimmer wäre, soll der
andere Leib und Gut erben. Mit dem Aussterben der Abensberger kam Randeck mit Abensberg an Bayern. Herzog
Wilhelm IV. beschenkte im Jahre 1529 seinen Kanzler Leonhard von Eck mit Randeck. Sein Sohn, Oswald von Eck,
der ihm folgte, stiftete ihm in der Franziskanerkirche zu München ein Denkmal, von Hans Millich auf Holz gemalt,
das Jüngste Gericht vorstellend. Beide, Vater und Sohn, waren eifrige Beförderer der Künste und Wissenschaften,
und Aventin wurde von ihnen großmütig unterstützt. Sie besuchten sich wechselseitig sehr oft, und dem Leonhard
von Eck hatte es Aventin zu verdanken, daß er im Jahre 1528 seiner Haft zu Abensberg bald wieder entlassen wurde.
Oswald von Eck, ein Lehrling des Aventin, war selbst gelehrter Altertumsforscher und Münzkenner und hatte auf
seiner Burg zu Randeck einen bedeutenden Schatz von kostbaren Büchern und Handschriften gesammelt. Er brachte
auch nach Aventins Tod einen Teil der reichhaltigen Buchkammer desselben an sich, welcher zu Randeck und Kel-
heim aufbewahrt wurde. Nach Oswald Eckens Tod, welcher vor 1565 in sehr mißlichen Vermögensumständen zu
Regensburg gestorben ist, kam ein Teil seiner Büchersammlung in die Hände des Jngolstädters Professors Johann
„von" Eck, das übrige wurde zerstreut. Nicolaus Cisner sagt in seiner Vorrede zu Aventins Chronik: „Aventins
Bibliothek ist Oswald Eckhen worden, welche Bibliothek der Ehrwürdige und Edle Herr Erasmus Newsletter, ge-
nannt Stürmer, miteinander mit großem Geld an sich gekauft."