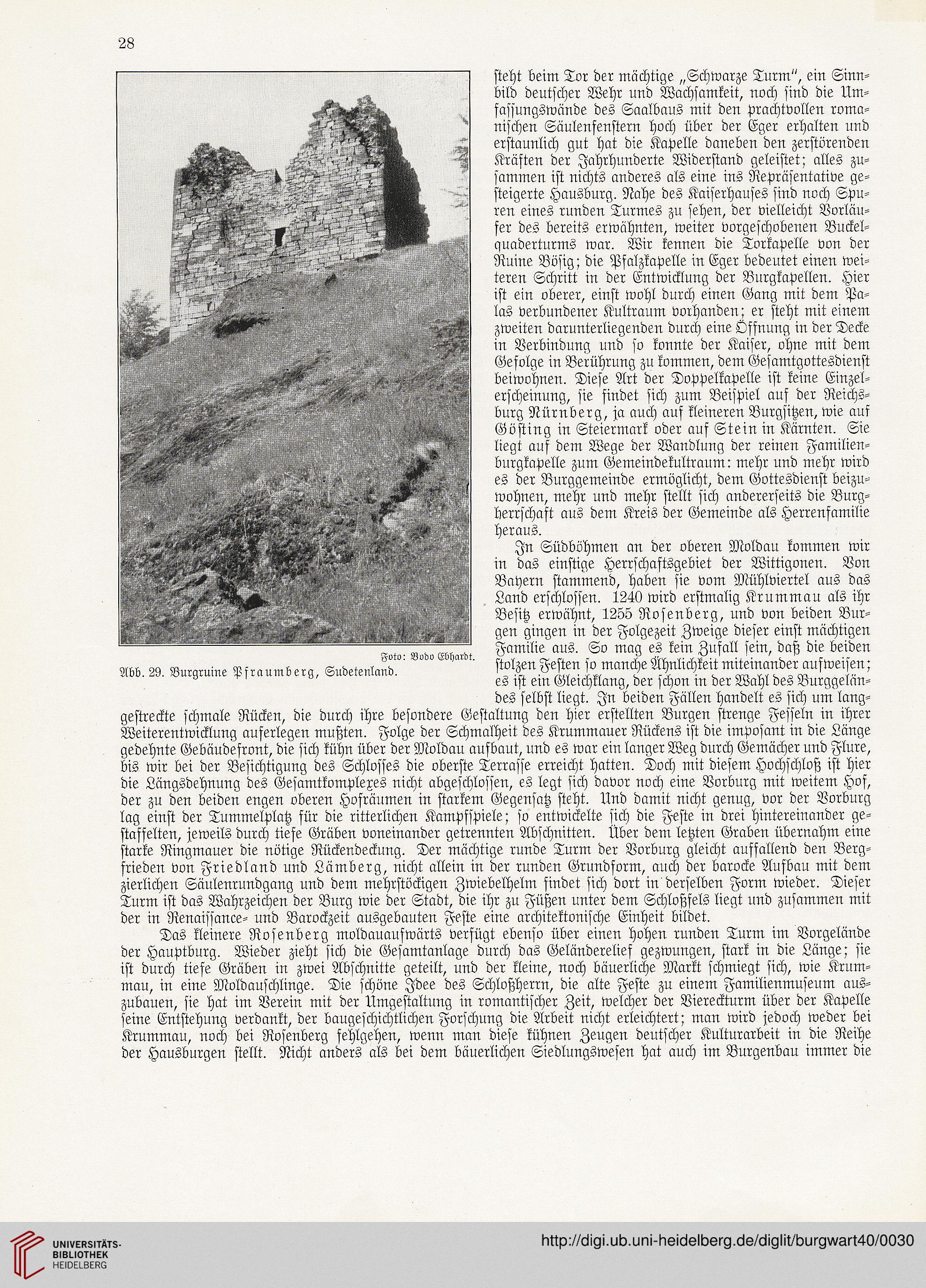28
steht beim Tor der mächtige „Schwarze Turm", ein Sinn-
bild deutscher Wehr und Wachsamkeit, noch sind die Um-
fassungswände des Saalbaus mit den prachtvollen roma-
nischen Säulenfenstern hoch über der Eger erhalten und
erstaunlich gut hat die Kapelle daneben den zerstörenden
Kräften der Jahrhunderte Widerstand geleistet; alles zu-
sammen ist nichts anderes als eine ins Repräsentative ge-
steigerte Hausburg. Nahe des Kaiserhauses sind noch Spu-
ren eines runden Turmes zu sehen, der vielleicht Vorläu-
fer des bereits erwähnten, weiter vorgeschobenen Buckel-
guaderturms war. Wir kennen die Torkapelle von der
Ruine Bösig; die Pfalzkapelle in Eger bedeutet einen wei-
teren Schritt in der Entwicklung der Burgkapellen. Hier
ist ein oberer, einst wohl durch einen Gang mit dem Pa-
las verbundener Kultraum vorhanden; er steht mit einem
zweiten darunterliegenden durch eine Öffnung in der Decke
in Verbindung und so konnte der Kaiser, ohne mit dem
Gefolge in Berührung zu kommen, dem Gesamtgottesdienst
beiwohnen. Diese Art der Doppelkapelle ist keine Einzel-
erscheinung, sie findet sich zum Beispiel auf der Reichs-
burg Nürnberg, ja auch aus kleineren Burgsitzen, wie aut
Gösting in Steiermark oder auf Stein in Kärnten. Sie
liegt auf dem Wege der Wandlung der reinen Familien-
burgkapelle zum Gemeindekultraum: mehr und mehr wird
es der Burggemeinde ermöglicht, dem Gottesdienst beizu-
wohnen, mehr und mehr stellt sich andererseits die Burg-
berrschaft aus dem Kreis der Gemeinde als Herrenfamilie
heraus.
In Südböhmen an der oberen Moldau kommen wir
in das einstige Herrschaftsgebiet der Wittigonen. Von
Bayern stammend, haben sie vom Mühlviertel aus das
Land erschlossen. 1240 wird erstmalig Krummau als ihr
Besitz erwähnt, 1255 Rosenberg, und von beiden Bur-
gen gingen in der Folgezeit Zweige dieser einst mächtigen
Familie aus. So mag es kein Zufall sein, daß die beiden
stolzen Festen so manche Ähnlichkeit miteinander aufweisen;
es ist ein Gleichklang, der schon in der Wahl des Burggelän-
des selbst liegt. In beiden Fällen handelt es sich um lang-
gestreckte schmale Rücken, die durch ihre besondere Gestaltung den hier erstellten Burgen strenge Fesseln in ihrer
Weiterentwicklung auferlegen mußten. Folge der Schmalheit des Krummauer Rückens ist die imposant in die Länge
gedehnte Gebäudefront, die sich kühn über der Moldau aufbaut, und es war ein langer Weg durch Gemächer und Flure,
bis wir bei der Besichtigung des Schlosses die oberste Terrasse erreicht hatten. Doch mit diesem Hochschloß ist hier
die Längsdehnung des Gesamtkomplexes nicht abgeschlossen, es legt sich davor noch eine Borburg mit weitem Hof,
der zu den beiden engen oberen Hofräumen in starkem Gegensatz steht. Und damit nicht genug, vor der Vorburg
lag einst der Tummelplatz für die ritterlichen Kampfspiele; so entwickelte sich die Feste in drei hintereinander ge-
staffelten, jeweils durch tiefe Gräben voneinander getrennten Abschnitten. Uber dem letzten Graben übernahm eine
starke Ringmauer die nötige Rückendeckung. Der mächtige runde Turm der Vorburg gleicht auffallend den Berg-
frieden von Friedland und Lümberg, nicht allein in der runden Grundform, auch der barocke Aufbau mit dem
zierlichen Säulenrundgang und dem mehrstöckigen Zwiebelhelm findet sich dort in derselben Form wieder. Dieser
Turm ist das Wahrzeichen der Burg wie der Stadt, die ihr zu Füßen unter dem Schloßfels liegt und zusammen mit
der in Renaissance- und Barockzeit ausgebauten Feste eine architektonische Einheit bildet.
Das kleinere Rosenberg moldauaufwärts verfügt ebenso über einen hohen runden Turm im Vorgelände
der Hauptburg. Wieder zieht sich die Gesamtanlage durch das Geländerelief gezwungen, stark in die Länge; sie
ist durch tiefe Gräben in zwei Abschnitte geteilt, und der kleine, noch bäuerliche Markt schmiegt sich, wie Krum-
mau, in eine Moldauschlinge. Die schöne Idee des Schloßherrn, die alte Feste zu einem Familienmuseum aus-
zubauen, sie hat im Verein mit der Umgestaltung in romantischer Zeit, welcher der Viereckturm über der Kapelle
seine Entstehung verdankt, der baugeschichtlichen Forschung die Arbeit nicht erleichtert; man wird jedoch weder bei
Krummau, noch bei Rosenberg fehlgehen, wenn man diese kühnen Zeugen deutscher Kulturarbeit in die Reihe
der Hausburgen stellt. Nicht anders als bei dem bäuerlichen Siedlungswesen hat auch im Burgenbau immer die
Foto: Bodo Ebhardt
Abb. 29. Burgruine Pfraumberg, Sudetenland.
steht beim Tor der mächtige „Schwarze Turm", ein Sinn-
bild deutscher Wehr und Wachsamkeit, noch sind die Um-
fassungswände des Saalbaus mit den prachtvollen roma-
nischen Säulenfenstern hoch über der Eger erhalten und
erstaunlich gut hat die Kapelle daneben den zerstörenden
Kräften der Jahrhunderte Widerstand geleistet; alles zu-
sammen ist nichts anderes als eine ins Repräsentative ge-
steigerte Hausburg. Nahe des Kaiserhauses sind noch Spu-
ren eines runden Turmes zu sehen, der vielleicht Vorläu-
fer des bereits erwähnten, weiter vorgeschobenen Buckel-
guaderturms war. Wir kennen die Torkapelle von der
Ruine Bösig; die Pfalzkapelle in Eger bedeutet einen wei-
teren Schritt in der Entwicklung der Burgkapellen. Hier
ist ein oberer, einst wohl durch einen Gang mit dem Pa-
las verbundener Kultraum vorhanden; er steht mit einem
zweiten darunterliegenden durch eine Öffnung in der Decke
in Verbindung und so konnte der Kaiser, ohne mit dem
Gefolge in Berührung zu kommen, dem Gesamtgottesdienst
beiwohnen. Diese Art der Doppelkapelle ist keine Einzel-
erscheinung, sie findet sich zum Beispiel auf der Reichs-
burg Nürnberg, ja auch aus kleineren Burgsitzen, wie aut
Gösting in Steiermark oder auf Stein in Kärnten. Sie
liegt auf dem Wege der Wandlung der reinen Familien-
burgkapelle zum Gemeindekultraum: mehr und mehr wird
es der Burggemeinde ermöglicht, dem Gottesdienst beizu-
wohnen, mehr und mehr stellt sich andererseits die Burg-
berrschaft aus dem Kreis der Gemeinde als Herrenfamilie
heraus.
In Südböhmen an der oberen Moldau kommen wir
in das einstige Herrschaftsgebiet der Wittigonen. Von
Bayern stammend, haben sie vom Mühlviertel aus das
Land erschlossen. 1240 wird erstmalig Krummau als ihr
Besitz erwähnt, 1255 Rosenberg, und von beiden Bur-
gen gingen in der Folgezeit Zweige dieser einst mächtigen
Familie aus. So mag es kein Zufall sein, daß die beiden
stolzen Festen so manche Ähnlichkeit miteinander aufweisen;
es ist ein Gleichklang, der schon in der Wahl des Burggelän-
des selbst liegt. In beiden Fällen handelt es sich um lang-
gestreckte schmale Rücken, die durch ihre besondere Gestaltung den hier erstellten Burgen strenge Fesseln in ihrer
Weiterentwicklung auferlegen mußten. Folge der Schmalheit des Krummauer Rückens ist die imposant in die Länge
gedehnte Gebäudefront, die sich kühn über der Moldau aufbaut, und es war ein langer Weg durch Gemächer und Flure,
bis wir bei der Besichtigung des Schlosses die oberste Terrasse erreicht hatten. Doch mit diesem Hochschloß ist hier
die Längsdehnung des Gesamtkomplexes nicht abgeschlossen, es legt sich davor noch eine Borburg mit weitem Hof,
der zu den beiden engen oberen Hofräumen in starkem Gegensatz steht. Und damit nicht genug, vor der Vorburg
lag einst der Tummelplatz für die ritterlichen Kampfspiele; so entwickelte sich die Feste in drei hintereinander ge-
staffelten, jeweils durch tiefe Gräben voneinander getrennten Abschnitten. Uber dem letzten Graben übernahm eine
starke Ringmauer die nötige Rückendeckung. Der mächtige runde Turm der Vorburg gleicht auffallend den Berg-
frieden von Friedland und Lümberg, nicht allein in der runden Grundform, auch der barocke Aufbau mit dem
zierlichen Säulenrundgang und dem mehrstöckigen Zwiebelhelm findet sich dort in derselben Form wieder. Dieser
Turm ist das Wahrzeichen der Burg wie der Stadt, die ihr zu Füßen unter dem Schloßfels liegt und zusammen mit
der in Renaissance- und Barockzeit ausgebauten Feste eine architektonische Einheit bildet.
Das kleinere Rosenberg moldauaufwärts verfügt ebenso über einen hohen runden Turm im Vorgelände
der Hauptburg. Wieder zieht sich die Gesamtanlage durch das Geländerelief gezwungen, stark in die Länge; sie
ist durch tiefe Gräben in zwei Abschnitte geteilt, und der kleine, noch bäuerliche Markt schmiegt sich, wie Krum-
mau, in eine Moldauschlinge. Die schöne Idee des Schloßherrn, die alte Feste zu einem Familienmuseum aus-
zubauen, sie hat im Verein mit der Umgestaltung in romantischer Zeit, welcher der Viereckturm über der Kapelle
seine Entstehung verdankt, der baugeschichtlichen Forschung die Arbeit nicht erleichtert; man wird jedoch weder bei
Krummau, noch bei Rosenberg fehlgehen, wenn man diese kühnen Zeugen deutscher Kulturarbeit in die Reihe
der Hausburgen stellt. Nicht anders als bei dem bäuerlichen Siedlungswesen hat auch im Burgenbau immer die
Foto: Bodo Ebhardt
Abb. 29. Burgruine Pfraumberg, Sudetenland.