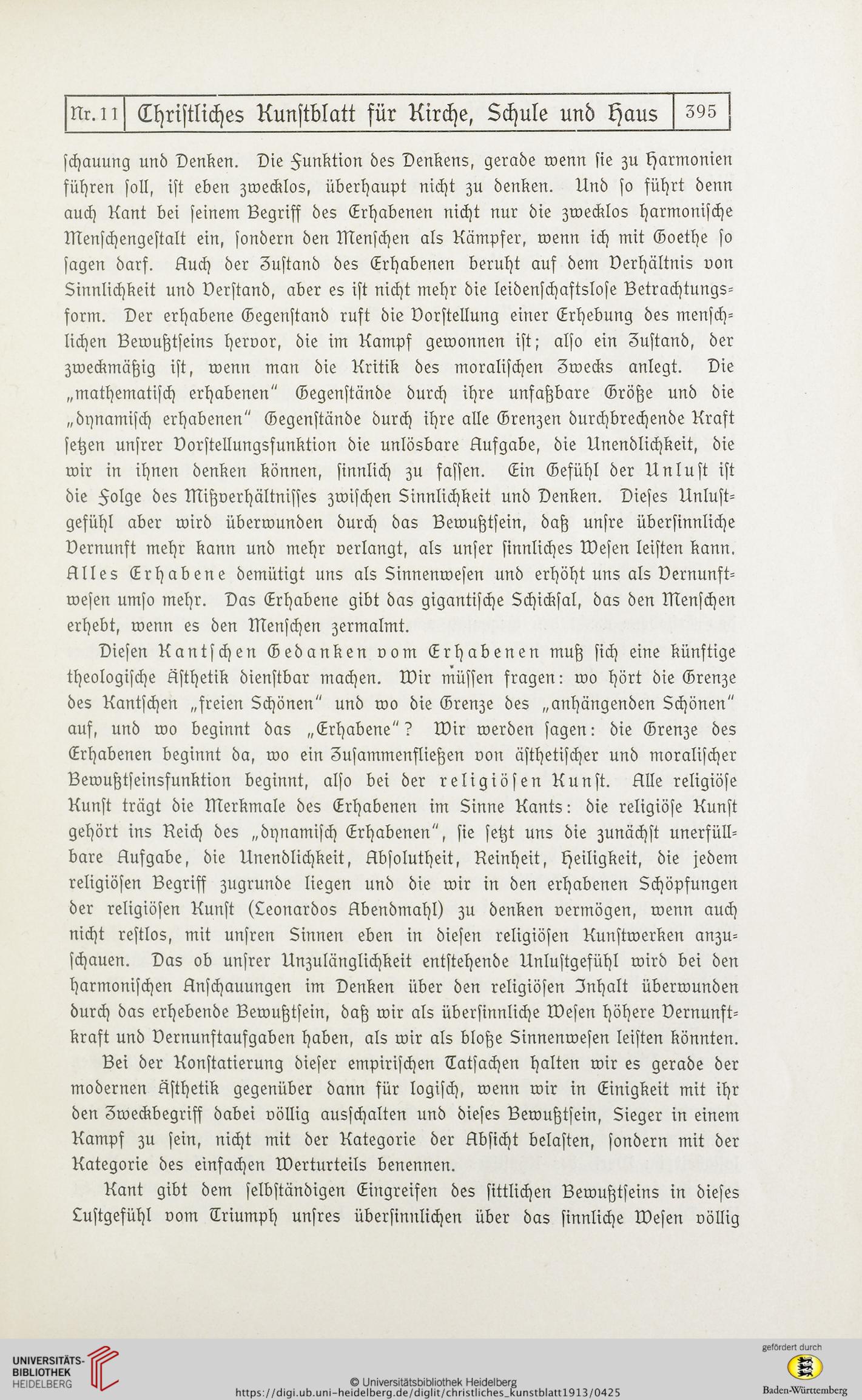395
Nr. II
Christliches Kunstblatt für Kirche, Zchule und Haus
schauung und Denken. Vie Funktion des Denkens, gerade wenn sie zu Harmonien
führen soll, ist eben zwecklos, überhaupt nicht zu denken. Und so führt denn
auch Kant bei seinem Begriff des Erhabenen nicht nur die zwecklos harmonische
Menschengestalt ein, sondern den Menschen als Kämpfer, wenn ich mit Goethe so
sagen darf. Auch der Zustand des Erhabenen beruht auf dem Verhältnis von
Sinnlichkeit und verstand, aber es ist nicht mehr die leidenschaftslose Betrachtungs-
form. Der erhabene Gegenstand ruft die Vorstellung einer Erhebung des mensch-
lichen Bewußtseins hervor, die im Kampf gewonnen ist- also ein Zustand, der
zweckmäßig ist, wenn man die Kritik des moralischen Zwecks anlegt. Vie
„mathematisch erhabenen" Gegenstände durch ihre unfaßbare Größe und die
„dynamisch erhabenen" Gegenstände durch ihre alle Grenzen durchbrechende Kraft
setzen unsrer vorstellungsfunktion die unlösbare Aufgabe, die Unendlichkeit, die
wir in ihnen denken können, sinnlich zu fassen. Ein Gefühl der Unlust ist
die Folge des Mißverhältnisses zwischen Sinnlichkeit und Denken. Dieses Unlust-
gefühl aber wird überwunden durch das Bewußtsein, daß unsre übersinnliche
Vernunft mehr kann und mehr verlangt, als unser sinnliches Wesen leisten kann.
Alles Erhabene demütigt uns als Sinnenwesen und erhöht uns als Vernunft-
wesen umso mehr. Vas Erhabene gibt das gigantische Schicksal, das den Menschen
erhebt, wenn es den Menschen zermalmt.
Viesen Kantschen Gedanken vom Erhabenen muß sich eine künftige
theologische Ästhetik dienstbar machen. Wir müssen fragen: wo hört die Grenze
des Kantschen „freien Schönen" und wo die Grenze des „anhängenden Schönen"
auf, und wo beginnt das „Erhabene"? Wir werden sagen: die Grenze des
Erhabenen beginnt da, wo ein Zusammenfließen von ästhetischer und moralischer
Vewußtseinsfunktion beginnt, also bei der religiösen Kunst. Ulle religiöse
Kunst trägt die Merkmale des Erhabenen im Sinne Kants: die religiöse Kunst
gehört ins Keich des „dynamisch Erhabenen", sie setzt uns die zunächst unerfüll-
bare Aufgabe, die Unendlichkeit, Absolutheit, Reinheit, Heiligkeit, die jedem
religiösen Begriff zugrunde liegen und die wir in den erhabenen Schöpfungen
der religiösen Kunst (Leonardos Abendmahl) zu denken vermögen, wenn auch
nicht restlos, mit unsren Sinnen eben in diesen religiösen Kunstwerken anzu-
schauen. Das ob unsrer Unzulänglichkeit entstehende Unlustgefühl wird bei den
harmonischen Anschauungen im Denken über den religiösen Inhalt überwunden
durch das erhebende Bewußtsein, daß wir als übersinnliche Wesen höhere Vernunft-
kraft und Vernunftaufgaben haben, als wir als bloße Sinnenwesen leisten könnten.
Bei der Konstatierung dieser empirischen Tatsachen halten wir es gerade der
modernen Ästhetik gegenüber dann für logisch, wenn wir in Einigkeit mit ihr
den Zweckbegriff dabei völlig ausschalten und dieses Bewußtsein, Sieger in einem
Kampf zu sein, nicht mit der Kategorie der Absicht belasten, sondern mit der
Kategorie des einfachen Werturteils benennen.
Kant gibt dem selbständigen Eingreifen des sittlichen Bewußtseins in dieses
Lustgefühl vom Triumph unsres übersinnlichen über das sinnliche Wesen völlig
Nr. II
Christliches Kunstblatt für Kirche, Zchule und Haus
schauung und Denken. Vie Funktion des Denkens, gerade wenn sie zu Harmonien
führen soll, ist eben zwecklos, überhaupt nicht zu denken. Und so führt denn
auch Kant bei seinem Begriff des Erhabenen nicht nur die zwecklos harmonische
Menschengestalt ein, sondern den Menschen als Kämpfer, wenn ich mit Goethe so
sagen darf. Auch der Zustand des Erhabenen beruht auf dem Verhältnis von
Sinnlichkeit und verstand, aber es ist nicht mehr die leidenschaftslose Betrachtungs-
form. Der erhabene Gegenstand ruft die Vorstellung einer Erhebung des mensch-
lichen Bewußtseins hervor, die im Kampf gewonnen ist- also ein Zustand, der
zweckmäßig ist, wenn man die Kritik des moralischen Zwecks anlegt. Vie
„mathematisch erhabenen" Gegenstände durch ihre unfaßbare Größe und die
„dynamisch erhabenen" Gegenstände durch ihre alle Grenzen durchbrechende Kraft
setzen unsrer vorstellungsfunktion die unlösbare Aufgabe, die Unendlichkeit, die
wir in ihnen denken können, sinnlich zu fassen. Ein Gefühl der Unlust ist
die Folge des Mißverhältnisses zwischen Sinnlichkeit und Denken. Dieses Unlust-
gefühl aber wird überwunden durch das Bewußtsein, daß unsre übersinnliche
Vernunft mehr kann und mehr verlangt, als unser sinnliches Wesen leisten kann.
Alles Erhabene demütigt uns als Sinnenwesen und erhöht uns als Vernunft-
wesen umso mehr. Vas Erhabene gibt das gigantische Schicksal, das den Menschen
erhebt, wenn es den Menschen zermalmt.
Viesen Kantschen Gedanken vom Erhabenen muß sich eine künftige
theologische Ästhetik dienstbar machen. Wir müssen fragen: wo hört die Grenze
des Kantschen „freien Schönen" und wo die Grenze des „anhängenden Schönen"
auf, und wo beginnt das „Erhabene"? Wir werden sagen: die Grenze des
Erhabenen beginnt da, wo ein Zusammenfließen von ästhetischer und moralischer
Vewußtseinsfunktion beginnt, also bei der religiösen Kunst. Ulle religiöse
Kunst trägt die Merkmale des Erhabenen im Sinne Kants: die religiöse Kunst
gehört ins Keich des „dynamisch Erhabenen", sie setzt uns die zunächst unerfüll-
bare Aufgabe, die Unendlichkeit, Absolutheit, Reinheit, Heiligkeit, die jedem
religiösen Begriff zugrunde liegen und die wir in den erhabenen Schöpfungen
der religiösen Kunst (Leonardos Abendmahl) zu denken vermögen, wenn auch
nicht restlos, mit unsren Sinnen eben in diesen religiösen Kunstwerken anzu-
schauen. Das ob unsrer Unzulänglichkeit entstehende Unlustgefühl wird bei den
harmonischen Anschauungen im Denken über den religiösen Inhalt überwunden
durch das erhebende Bewußtsein, daß wir als übersinnliche Wesen höhere Vernunft-
kraft und Vernunftaufgaben haben, als wir als bloße Sinnenwesen leisten könnten.
Bei der Konstatierung dieser empirischen Tatsachen halten wir es gerade der
modernen Ästhetik gegenüber dann für logisch, wenn wir in Einigkeit mit ihr
den Zweckbegriff dabei völlig ausschalten und dieses Bewußtsein, Sieger in einem
Kampf zu sein, nicht mit der Kategorie der Absicht belasten, sondern mit der
Kategorie des einfachen Werturteils benennen.
Kant gibt dem selbständigen Eingreifen des sittlichen Bewußtseins in dieses
Lustgefühl vom Triumph unsres übersinnlichen über das sinnliche Wesen völlig