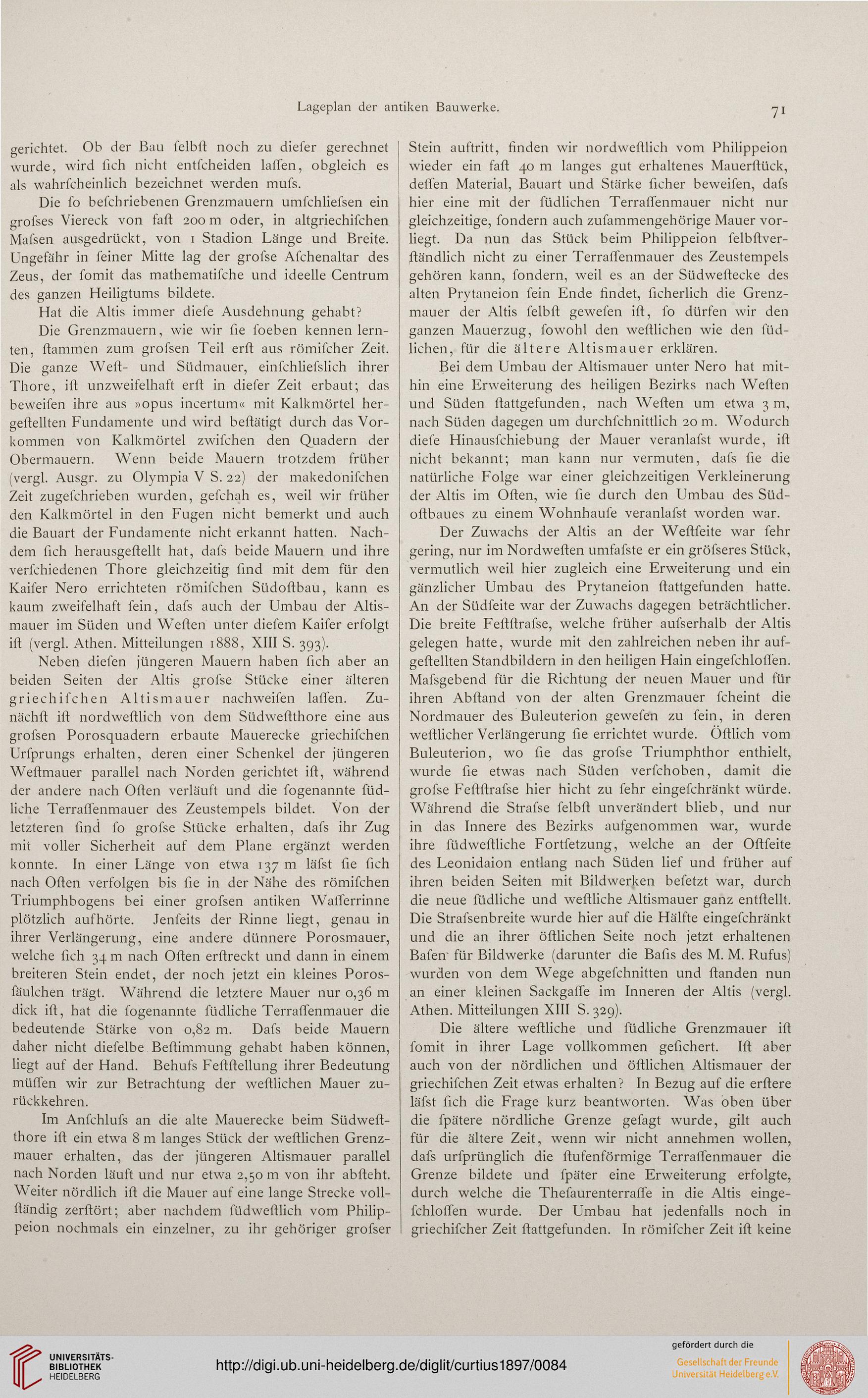Lageplan der antiken Bauwerke.
71
berichtet. Ob der Bau selbst noch zu dieser gerechnet
wurde, wird lieh nicht entscheiden lassen, obgleich es
als wahrscheinlich bezeichnet werden muss.
Die so beschriebenen Grenzmauern umschliessen ein
grosses Viereck von fast 200 m oder, in altgriechischen
Massen ausgedrückt, von 1 Stadion Länge und Breite.
Ungefähr in seiner Mitte lag der grosse Aschenaltar des
Zeus, der somit das mathematische und ideelle Centrum
des ganzen Heiligtums bildete.
Hat die Altis immer diese Ausdehnung gehabt?
Die Grenzmauern, wie wir (ie soeben kennen lern-
ten, slammen zum grossen Teil erst aus römischer Zeit.
Die ganze Welt- und Südmauer, einschliesslich ihrer
Thore, ist unzweifelhaft erst in dieser Zeit erbaut; das
beweisen ihre aus »opus incertum« mit Kalkmörtel her-
gestellten Fundamente und wird bestätigt durch das Vor-
kommen von Kalkmörtel zwischen den Quadern der
Obermauern. Wenn beide Mauern trotzdem früher
(vergl. Ausgr. zu Olympia V S. 22) der makedonischen
Zeit zugeschrieben wurden, geschah es, weil wir früher
den Kalkmörtel in den Fugen nicht bemerkt und auch
die Bauart der Fundamente nicht erkannt hatten. Nach-
dem Geh herausgestellt hat, dass beide Mauern und ihre
verschiedenen Thore gleichzeitig sind mit dem für den
Kaiser Nero errichteten römischen Südostbau, kann es
kaum zweifelhaft sein, dass auch der Umbau der Altis-
mauer im Süden und Weiten unter diesem Kaiser erfolgt
ist (vergl. Athen. Mitteilungen 1888, XIII S. 393).
Neben diesen jüngeren Mauern haben sich aber an
beiden Seiten der Altis grosse Stücke einer älteren
griechischen Altismauer nachweisen lassen. Zu-
nächst ist nordwestlich von dem Südwestthore eine aus
grossen Porosquadern erbaute Mauerecke griechischen
Ursprungs erhalten, deren einer Schenkel der jüngeren
Westmauer parallel nach Norden gerichtet ist, während
der andere nach Osfen verläuft und die sogenannte süd-
liche Terrassenmauer des Zeustempels bildet. Von der
letzteren sind so grosse Stücke erhalten, dass ihr Zug
mit voller Sicherheit auf dem Plane ergänzt werden
konnte. In einer Länge von etwa 137 m lässt ste sich
nach Osfen verfolgen bis sie in der Nähe des römischen
Triumphbogens bei einer grossen antiken Wasserrinne
plötzlich aufhörte. Jenseits der Rinne liegt, genau in
ihrer Verlängerung, eine andere dünnere Porosmauer,
welche sich 34 m nach Osfen erstreckt und dann in einem
breiteren Stein endet, der noch jetzt ein kleines Poros-
säulchen trägt. Während die letztere Mauer nur 0,36 m
dick ist, hat die sogenannte südliche Terrassenmauer die
bedeutende Stärke von 0,82 m. Dass beide Mauern
daher nicht dieselbe Bestimmung gehabt haben können,
liegt auf der Hand. Behufs Feststellung ihrer Bedeutung
mussen wir zur Betrachtung der weltlichen Mauer zu-
rückkehren.
Im Anschluss an die alte Mauerecke beim Südwest-
thore ist ein etwa 8 m langes Stück der westlichen Grenz-
mauer erhalten, das der jüngeren Altismauer parallel
nach Norden läuft und nur etwa 2,50 m von ihr absteht.
Weiter nördlich ist die Mauer auf eine lange Strecke voll-
Ständig zerstört; aber nachdem südwestlieh vom Philip-
peion nochmals ein einzelner, zu ihr gehöriger grosser
Stein auftritt, finden wir nordwestlich vom Philippeion
wieder ein fast 40 m langes gut erhaltenes Mauerstück,
dessen Material, Bauart und Stärke sicher beweisen, dass
hier eine mit der südlichen Terrassenmauer nicht nur
gleichzeitige, sondern auch zusammengehörige Mauer vor-
liegt. Da nun das Stück beim Philippeion selbstver-
ständlich nicht zu einer Terrassenmauer des Zeustempels
gehören kann, sondern, weil es an der Südwestecke des
alten Prytaneion sein Ende findet, sicherlich die Grenz-
mauer der Altis selbst gewesen ist, so dürfen wir den
ganzen Manerzug, sowohl den westlichen wie den süd-
lichen, für die ältere Altismauer erklären.
Bei dem Umbau der Altismauer unter Nero hat mit-
hin eine Erweiterung des heiligen Bezirks nach Werten
und Süden Stattgefunden, nach Weiten um etwa 3 m,
nach Süden dagegen um durchschnittlich 20 m. Wodurch
diese Hinausschiebung der Mauer veranlasst wurde, ist
nicht bekannt; man kann nur vermuten, dass sie die
natürliche Folge war einer gleichzeitigen Verkleinerung
der Altis im Osten, wie sie durch den Umbau des Süd-
ostbaues zu einem Wohnbaisse veranlasst worden war.
Der Zuwachs der Altis an der Westseite war sehr
gering, nur im Nordwesten umfasste er ein grösseres Stück,
vermutlich weil hier zugleich eine Erweiterung und ein
gänzlicher Umbau des Prytaneion Stattgefunden hatte.
An der Südseite war der Zuwachs dagegen beträchtlicher.
Die breite Feststrasse, welche früher ausserhalb der Altis
gelegen hatte, wurde mit den zahlreichen neben ihr auf-
gestellten Standbildern in den heiligen Hain eingeschlossen.
Massgebend für die Richtung der neuen Mauer und für
ihren Abstand von der alten Grenzmauer scheint die
Nordmauer des Buleuterion gewesen zu sein, in deren
westlicher Verlängerung sie errichtet wurde. Östlich vom
Buleuterion, wo sie das grosse Triumphthor enthielt,
wurde sie etwas nach Süden verschoben, damit die
grosse Feststrasse hier hicht zu sehr eingeschränkt würde.
Während die Strasse selbst unverändert blieb, und nur
in das Innere des Bezirks aufgenommen war, wurde
ihre südwestliche Fortsetzung, welche an der Ostseite
des Leonidaion entlang nach Süden lief und früher auf
ihren beiden Seiten mit Bildwerken besetzt war, durch
die neue südliche und westliche Altismauer ganz entstellt.
Die Stralsenbreite wurde hier auf die Hälfte eingeschränkt
und die an ihrer östlichen Seite noch jetzt erhaltenen
Basen' für Bildwerke (darunter die Balis des M. M. Rufus)
wurden von dem Wege abgeschnitten und standen nun
an einer kleinen Sackgasse im Inneren der Altis (vergl.
Athen. Mitteilungen XIII S. 329).
Die ältere westliche und südliche Grenzmauer ist
somit in ihrer Lage vollkommen gesichert. Ist aber
auch von der nördlichen und östlichen Altismauer der
griechischen Zeit etwas erhalten? In Bezug auf die erstere
lässt sich die Frage kurz beantworten. Was oben über
die spätere nördliche Grenze gesagt wurde, gilt auch
für die ältere Zeit, wenn wir nicht annehmen wollen,
dass ursprünglich die Stufenförmige Terralsenmauer die
Grenze bildete und später eine Erweiterung erfolgte,
durch welche die Thesaurenterrasse in die Altis einge-
schlossen wurde. Der Umbau hat jedenfalls noch in
griechischer Zeit Stattgefunden. In römischer Zeit ist keine
71
berichtet. Ob der Bau selbst noch zu dieser gerechnet
wurde, wird lieh nicht entscheiden lassen, obgleich es
als wahrscheinlich bezeichnet werden muss.
Die so beschriebenen Grenzmauern umschliessen ein
grosses Viereck von fast 200 m oder, in altgriechischen
Massen ausgedrückt, von 1 Stadion Länge und Breite.
Ungefähr in seiner Mitte lag der grosse Aschenaltar des
Zeus, der somit das mathematische und ideelle Centrum
des ganzen Heiligtums bildete.
Hat die Altis immer diese Ausdehnung gehabt?
Die Grenzmauern, wie wir (ie soeben kennen lern-
ten, slammen zum grossen Teil erst aus römischer Zeit.
Die ganze Welt- und Südmauer, einschliesslich ihrer
Thore, ist unzweifelhaft erst in dieser Zeit erbaut; das
beweisen ihre aus »opus incertum« mit Kalkmörtel her-
gestellten Fundamente und wird bestätigt durch das Vor-
kommen von Kalkmörtel zwischen den Quadern der
Obermauern. Wenn beide Mauern trotzdem früher
(vergl. Ausgr. zu Olympia V S. 22) der makedonischen
Zeit zugeschrieben wurden, geschah es, weil wir früher
den Kalkmörtel in den Fugen nicht bemerkt und auch
die Bauart der Fundamente nicht erkannt hatten. Nach-
dem Geh herausgestellt hat, dass beide Mauern und ihre
verschiedenen Thore gleichzeitig sind mit dem für den
Kaiser Nero errichteten römischen Südostbau, kann es
kaum zweifelhaft sein, dass auch der Umbau der Altis-
mauer im Süden und Weiten unter diesem Kaiser erfolgt
ist (vergl. Athen. Mitteilungen 1888, XIII S. 393).
Neben diesen jüngeren Mauern haben sich aber an
beiden Seiten der Altis grosse Stücke einer älteren
griechischen Altismauer nachweisen lassen. Zu-
nächst ist nordwestlich von dem Südwestthore eine aus
grossen Porosquadern erbaute Mauerecke griechischen
Ursprungs erhalten, deren einer Schenkel der jüngeren
Westmauer parallel nach Norden gerichtet ist, während
der andere nach Osfen verläuft und die sogenannte süd-
liche Terrassenmauer des Zeustempels bildet. Von der
letzteren sind so grosse Stücke erhalten, dass ihr Zug
mit voller Sicherheit auf dem Plane ergänzt werden
konnte. In einer Länge von etwa 137 m lässt ste sich
nach Osfen verfolgen bis sie in der Nähe des römischen
Triumphbogens bei einer grossen antiken Wasserrinne
plötzlich aufhörte. Jenseits der Rinne liegt, genau in
ihrer Verlängerung, eine andere dünnere Porosmauer,
welche sich 34 m nach Osfen erstreckt und dann in einem
breiteren Stein endet, der noch jetzt ein kleines Poros-
säulchen trägt. Während die letztere Mauer nur 0,36 m
dick ist, hat die sogenannte südliche Terrassenmauer die
bedeutende Stärke von 0,82 m. Dass beide Mauern
daher nicht dieselbe Bestimmung gehabt haben können,
liegt auf der Hand. Behufs Feststellung ihrer Bedeutung
mussen wir zur Betrachtung der weltlichen Mauer zu-
rückkehren.
Im Anschluss an die alte Mauerecke beim Südwest-
thore ist ein etwa 8 m langes Stück der westlichen Grenz-
mauer erhalten, das der jüngeren Altismauer parallel
nach Norden läuft und nur etwa 2,50 m von ihr absteht.
Weiter nördlich ist die Mauer auf eine lange Strecke voll-
Ständig zerstört; aber nachdem südwestlieh vom Philip-
peion nochmals ein einzelner, zu ihr gehöriger grosser
Stein auftritt, finden wir nordwestlich vom Philippeion
wieder ein fast 40 m langes gut erhaltenes Mauerstück,
dessen Material, Bauart und Stärke sicher beweisen, dass
hier eine mit der südlichen Terrassenmauer nicht nur
gleichzeitige, sondern auch zusammengehörige Mauer vor-
liegt. Da nun das Stück beim Philippeion selbstver-
ständlich nicht zu einer Terrassenmauer des Zeustempels
gehören kann, sondern, weil es an der Südwestecke des
alten Prytaneion sein Ende findet, sicherlich die Grenz-
mauer der Altis selbst gewesen ist, so dürfen wir den
ganzen Manerzug, sowohl den westlichen wie den süd-
lichen, für die ältere Altismauer erklären.
Bei dem Umbau der Altismauer unter Nero hat mit-
hin eine Erweiterung des heiligen Bezirks nach Werten
und Süden Stattgefunden, nach Weiten um etwa 3 m,
nach Süden dagegen um durchschnittlich 20 m. Wodurch
diese Hinausschiebung der Mauer veranlasst wurde, ist
nicht bekannt; man kann nur vermuten, dass sie die
natürliche Folge war einer gleichzeitigen Verkleinerung
der Altis im Osten, wie sie durch den Umbau des Süd-
ostbaues zu einem Wohnbaisse veranlasst worden war.
Der Zuwachs der Altis an der Westseite war sehr
gering, nur im Nordwesten umfasste er ein grösseres Stück,
vermutlich weil hier zugleich eine Erweiterung und ein
gänzlicher Umbau des Prytaneion Stattgefunden hatte.
An der Südseite war der Zuwachs dagegen beträchtlicher.
Die breite Feststrasse, welche früher ausserhalb der Altis
gelegen hatte, wurde mit den zahlreichen neben ihr auf-
gestellten Standbildern in den heiligen Hain eingeschlossen.
Massgebend für die Richtung der neuen Mauer und für
ihren Abstand von der alten Grenzmauer scheint die
Nordmauer des Buleuterion gewesen zu sein, in deren
westlicher Verlängerung sie errichtet wurde. Östlich vom
Buleuterion, wo sie das grosse Triumphthor enthielt,
wurde sie etwas nach Süden verschoben, damit die
grosse Feststrasse hier hicht zu sehr eingeschränkt würde.
Während die Strasse selbst unverändert blieb, und nur
in das Innere des Bezirks aufgenommen war, wurde
ihre südwestliche Fortsetzung, welche an der Ostseite
des Leonidaion entlang nach Süden lief und früher auf
ihren beiden Seiten mit Bildwerken besetzt war, durch
die neue südliche und westliche Altismauer ganz entstellt.
Die Stralsenbreite wurde hier auf die Hälfte eingeschränkt
und die an ihrer östlichen Seite noch jetzt erhaltenen
Basen' für Bildwerke (darunter die Balis des M. M. Rufus)
wurden von dem Wege abgeschnitten und standen nun
an einer kleinen Sackgasse im Inneren der Altis (vergl.
Athen. Mitteilungen XIII S. 329).
Die ältere westliche und südliche Grenzmauer ist
somit in ihrer Lage vollkommen gesichert. Ist aber
auch von der nördlichen und östlichen Altismauer der
griechischen Zeit etwas erhalten? In Bezug auf die erstere
lässt sich die Frage kurz beantworten. Was oben über
die spätere nördliche Grenze gesagt wurde, gilt auch
für die ältere Zeit, wenn wir nicht annehmen wollen,
dass ursprünglich die Stufenförmige Terralsenmauer die
Grenze bildete und später eine Erweiterung erfolgte,
durch welche die Thesaurenterrasse in die Altis einge-
schlossen wurde. Der Umbau hat jedenfalls noch in
griechischer Zeit Stattgefunden. In römischer Zeit ist keine