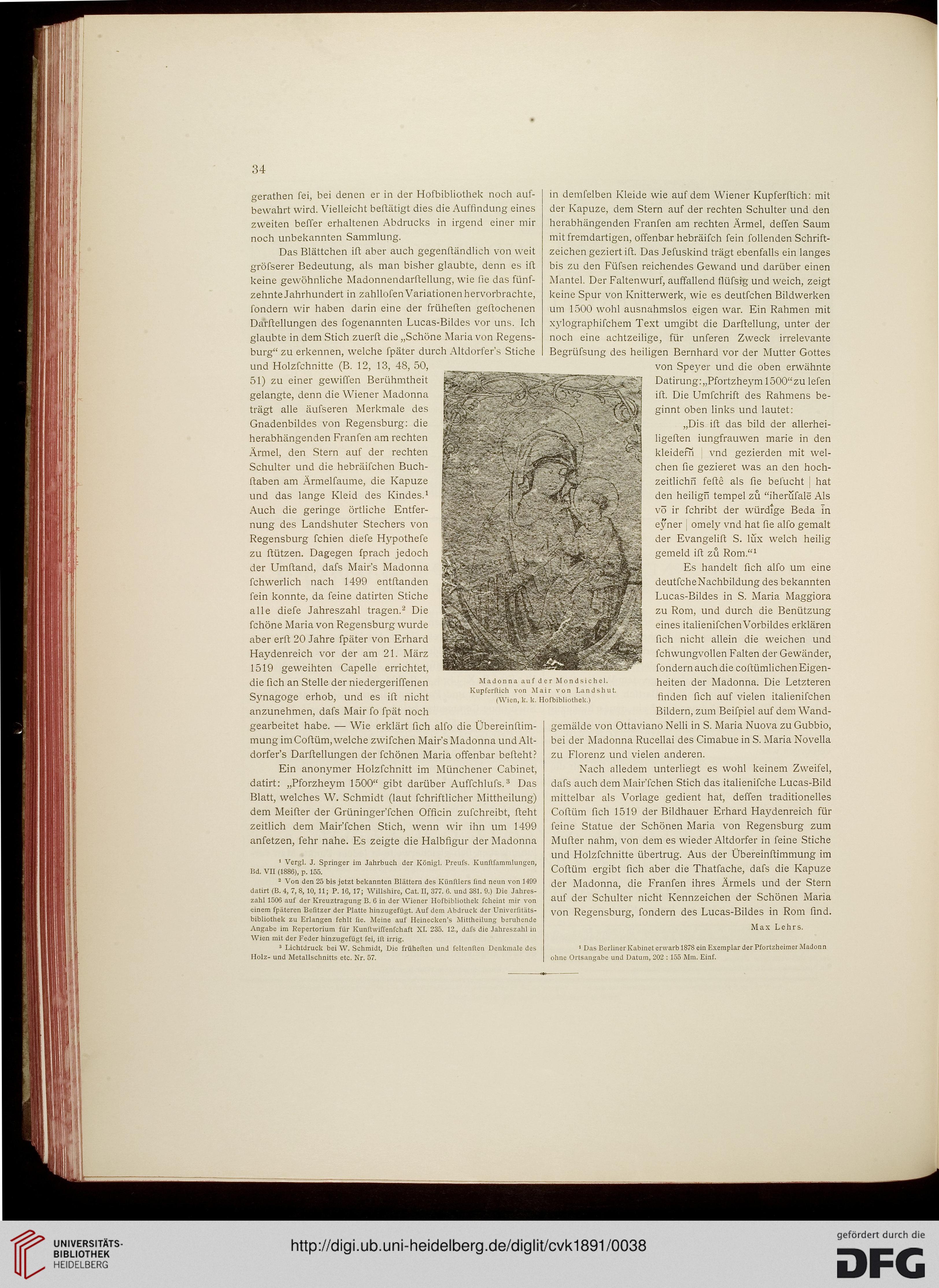34
gerathen sei, bei denen er in der Hofbibliothek noch auf-
bewahrt wird. Vielleicht bestätigt dies die Auffindung eines
zweiten besser erhaltenen Abdrucks in irgend einer mir
noch unbekannten Sammlung.
Das Blättchen ist aber auch gegenständlich von weit
grösserer Bedeutung, als man bisher glaubte, denn es ist
keine gewöhnliche Madonnendarstellung, wie sie das fünf-
zehnteJahrhundert in zahllosen Variationen hervorbrachte,
sondern wir haben darin eine der frühesten gestochenen
Darstellungen des sogenannten Lucas-Bildes vor uns. Ich
glaubte in dem Stich zuerst die „Schöne Maria von Regens-
burg" zu erkennen, welche später durch Altdorfer's Stiche
und Holzschnitte (B. 12, 13, 48, 50,
51) zu einer gewissen Berühmtheit
gelangte, denn die Wiener Madonna
trägt alle äusseren Merkmale des
Gnadenbildes von Regensburg: die
herabhängenden Fransen am rechten
Ärmel, den Stern auf der rechten
Schulter und die hebräischen Buch-
staben am Armelsaume, die Kapuze
und das lange Kleid des Kindes.1
Auch die geringe örtliche Entfer-
nung des Landshuter Stechers von
Regensburg schien diese Hypothese
zu stützen. Dagegen sprach jedoch
der Umstand, dass Mair's Madonna
schwerlich nach 1499 entstanden
sein konnte, da seine datirten Stiche
alle diese Jahreszahl tragen.2 Die
schöne Maria von Regensburg wurde
aber erst 20 Jahre später von Erhard
Haydenreich vor der am 21. März
1519 geweihten Capelle errichtet,
die sseh an Stelle der niedergerissenen
Synagoge erhob, und es ist nicht
anzunehmen, dass Mair so spät noch
gearbeitet habe. — Wie erklärt sseh also die Übereinstim-
mung imCostüm,welche zwischen Mair's Madonna undAlt-
dorfer's Darstellungen der schönen Maria offenbar besteht?
Ein anonymer Holzschnitt im Münchener Cabinet,
datirt: „Pforzheym 1500" gibt darüber Auffchluss.3 Das
Blatt, welches W. Schmidt (laut schriftlicher Mittheilung)
dem Meister der Grüninger'schen Offlein zuschreibt, sleht
zeitlich dem Mair'schen Stich, wenn wir ihn um 1499
ansetzen, sehr nahe. Es zeigte die Halbflgur der Madonna
1 Vergl. J. Springer im Jahrbuch der Königl. Preuss. Kunstsammlungen,
Bd. VII (1886), p. 155.
3 Von den 25 bis jetzt bekannten Blättern des Künstlers sind neun von 1499
datirt (B. 4, 7, 8, 10, 11; P. 16, 17; Wülshire, Cat. II, 377. 6. und 381. 9.) Die Jahres-
zahl 1506 auf der Kreuztragung B. 6 in der Wiener Hof bibliothek scheint mir von
einem spateren Besitzer der Platte hinzugefügt. Auf dem Abdruck der Universitäts-
bibliothek zu Erlangen sehlt sie. Meine auf Heinecken's Mittheilung beruhende
Angabe im Repertorium für Kunstwissenschaft XI. 235. 12,, dass die Jahreszahl in
Wien mit der Feder hinzugefügt sei, ist irrig.
3 Lichtdruck bei W. Schmidt, Die frühesten und seltensten Denkmale des
Holz- und Metallschnitts etc. Nr. 57.
Madonna auf der Mondsichel.
Kupferstich von Mair von Landshut
(Wien, k. k. Hosbibliothek.)
in demselben Kleide wie auf dem Wiener Kupferstich: mit
der Kapuze, dem Stern auf der rechten Schulter und den
herabhängenden Fransen am rechten Ärmel, dessen Saum
mit fremdartigen, offenbar hebräisch sein süllenden Schrift-
zeichen geziert ist. Das Jesuskind trägt ebenfalls ein langes
bis zu den Füssen reichendes Gewand und darüber einen
Mantel. Der Faltenwurf, ausfallend flüssig und weich, zeigt
keine Spur von Knitterwerk, wie es deutsehen Bildwerken
um 1500 wohl ausnahmslos eigen war. Ein Rahmen mit
xylographischem Text umgibt die Darsteilung, unter der
noch eine achtzeilige, für unseren Zweck irrelevante
Begrüssung des heiligen Bernhard vor der Mutter Gottes
von Speyer und die oben erwähnte
Datirung:„Pfortzheym 1500"zu lesen
ist. Die Umschrift des Rahmens be-
ginnt oben links und lautet:
„Dis. ist das bild der allerhei-
ligesten iungfrauwen marie in den
kleidesn vnd gezierden mit wel-
chen sie gezieret was an den hoch-
zeitlichn feste als sse besucht | hat
den heilign tempel zu "iherusale Als
vö ir schribt der würdige Beda in
eyner | omely vnd hat sse also gemalt
der Evangelist S. lux welch heilig
gemeld ist zu Rom."1
Es handelt sseh also um eine
deutscheNachbildung des bekannten
Lucas-Bildes in S. Maria Maggiora
zu Rom, und durch die Benützung
eines italienischenVorbildes erklären
sich nicht allein die weichen und
schwungvollen Falten der Gewänder,
sondern auch die costümlichen Eigen-
heiten der Madonna. Die Letzteren
finden sich auf vielen italienischen
Bildern, zum Beispiel auf dem Wand-
gemälde von Ottaviano Nelli in S. Maria Nuova zu Gubbio,
bei der Madonna Rucellai des Cimabue in S. Maria Novella
zu Florenz und vielen anderen.
Nach alledem unterliegt es wohl keinem Zweifel,
dass auch dem Mair'schen Stich das italienische Lucas-Bild
mittelbar als Vorlage gedient hat, dessen traditionelles
Costüm sich 1519 der Bildhauer Erhard Haydenreich für
seine Statue der Schönen Maria von Regensburg zum
Muster nahm, von dem es wieder Altdorfer in seine Stiche
und Holzschnitte übertrug. Aus der Übereinstimmung im
Costüm ergibt sseh aber die Thatsache, dass die Kapuze
der Madonna, die Fransen ihres Ärmels und der Stern
auf der Schulter nicht Kennzeichen der Schönen Maria
von Regensburg, sondern des Lucas-Bildes in Rom sind.
Max Lehrs.
1 Das Berliner Kabinet erwarb 1878 ein Exemplar der Pfortzheimer Madonn
ohne Ortsangabe und Datum, 202 : 155 Mm. Einf.
gerathen sei, bei denen er in der Hofbibliothek noch auf-
bewahrt wird. Vielleicht bestätigt dies die Auffindung eines
zweiten besser erhaltenen Abdrucks in irgend einer mir
noch unbekannten Sammlung.
Das Blättchen ist aber auch gegenständlich von weit
grösserer Bedeutung, als man bisher glaubte, denn es ist
keine gewöhnliche Madonnendarstellung, wie sie das fünf-
zehnteJahrhundert in zahllosen Variationen hervorbrachte,
sondern wir haben darin eine der frühesten gestochenen
Darstellungen des sogenannten Lucas-Bildes vor uns. Ich
glaubte in dem Stich zuerst die „Schöne Maria von Regens-
burg" zu erkennen, welche später durch Altdorfer's Stiche
und Holzschnitte (B. 12, 13, 48, 50,
51) zu einer gewissen Berühmtheit
gelangte, denn die Wiener Madonna
trägt alle äusseren Merkmale des
Gnadenbildes von Regensburg: die
herabhängenden Fransen am rechten
Ärmel, den Stern auf der rechten
Schulter und die hebräischen Buch-
staben am Armelsaume, die Kapuze
und das lange Kleid des Kindes.1
Auch die geringe örtliche Entfer-
nung des Landshuter Stechers von
Regensburg schien diese Hypothese
zu stützen. Dagegen sprach jedoch
der Umstand, dass Mair's Madonna
schwerlich nach 1499 entstanden
sein konnte, da seine datirten Stiche
alle diese Jahreszahl tragen.2 Die
schöne Maria von Regensburg wurde
aber erst 20 Jahre später von Erhard
Haydenreich vor der am 21. März
1519 geweihten Capelle errichtet,
die sseh an Stelle der niedergerissenen
Synagoge erhob, und es ist nicht
anzunehmen, dass Mair so spät noch
gearbeitet habe. — Wie erklärt sseh also die Übereinstim-
mung imCostüm,welche zwischen Mair's Madonna undAlt-
dorfer's Darstellungen der schönen Maria offenbar besteht?
Ein anonymer Holzschnitt im Münchener Cabinet,
datirt: „Pforzheym 1500" gibt darüber Auffchluss.3 Das
Blatt, welches W. Schmidt (laut schriftlicher Mittheilung)
dem Meister der Grüninger'schen Offlein zuschreibt, sleht
zeitlich dem Mair'schen Stich, wenn wir ihn um 1499
ansetzen, sehr nahe. Es zeigte die Halbflgur der Madonna
1 Vergl. J. Springer im Jahrbuch der Königl. Preuss. Kunstsammlungen,
Bd. VII (1886), p. 155.
3 Von den 25 bis jetzt bekannten Blättern des Künstlers sind neun von 1499
datirt (B. 4, 7, 8, 10, 11; P. 16, 17; Wülshire, Cat. II, 377. 6. und 381. 9.) Die Jahres-
zahl 1506 auf der Kreuztragung B. 6 in der Wiener Hof bibliothek scheint mir von
einem spateren Besitzer der Platte hinzugefügt. Auf dem Abdruck der Universitäts-
bibliothek zu Erlangen sehlt sie. Meine auf Heinecken's Mittheilung beruhende
Angabe im Repertorium für Kunstwissenschaft XI. 235. 12,, dass die Jahreszahl in
Wien mit der Feder hinzugefügt sei, ist irrig.
3 Lichtdruck bei W. Schmidt, Die frühesten und seltensten Denkmale des
Holz- und Metallschnitts etc. Nr. 57.
Madonna auf der Mondsichel.
Kupferstich von Mair von Landshut
(Wien, k. k. Hosbibliothek.)
in demselben Kleide wie auf dem Wiener Kupferstich: mit
der Kapuze, dem Stern auf der rechten Schulter und den
herabhängenden Fransen am rechten Ärmel, dessen Saum
mit fremdartigen, offenbar hebräisch sein süllenden Schrift-
zeichen geziert ist. Das Jesuskind trägt ebenfalls ein langes
bis zu den Füssen reichendes Gewand und darüber einen
Mantel. Der Faltenwurf, ausfallend flüssig und weich, zeigt
keine Spur von Knitterwerk, wie es deutsehen Bildwerken
um 1500 wohl ausnahmslos eigen war. Ein Rahmen mit
xylographischem Text umgibt die Darsteilung, unter der
noch eine achtzeilige, für unseren Zweck irrelevante
Begrüssung des heiligen Bernhard vor der Mutter Gottes
von Speyer und die oben erwähnte
Datirung:„Pfortzheym 1500"zu lesen
ist. Die Umschrift des Rahmens be-
ginnt oben links und lautet:
„Dis. ist das bild der allerhei-
ligesten iungfrauwen marie in den
kleidesn vnd gezierden mit wel-
chen sie gezieret was an den hoch-
zeitlichn feste als sse besucht | hat
den heilign tempel zu "iherusale Als
vö ir schribt der würdige Beda in
eyner | omely vnd hat sse also gemalt
der Evangelist S. lux welch heilig
gemeld ist zu Rom."1
Es handelt sseh also um eine
deutscheNachbildung des bekannten
Lucas-Bildes in S. Maria Maggiora
zu Rom, und durch die Benützung
eines italienischenVorbildes erklären
sich nicht allein die weichen und
schwungvollen Falten der Gewänder,
sondern auch die costümlichen Eigen-
heiten der Madonna. Die Letzteren
finden sich auf vielen italienischen
Bildern, zum Beispiel auf dem Wand-
gemälde von Ottaviano Nelli in S. Maria Nuova zu Gubbio,
bei der Madonna Rucellai des Cimabue in S. Maria Novella
zu Florenz und vielen anderen.
Nach alledem unterliegt es wohl keinem Zweifel,
dass auch dem Mair'schen Stich das italienische Lucas-Bild
mittelbar als Vorlage gedient hat, dessen traditionelles
Costüm sich 1519 der Bildhauer Erhard Haydenreich für
seine Statue der Schönen Maria von Regensburg zum
Muster nahm, von dem es wieder Altdorfer in seine Stiche
und Holzschnitte übertrug. Aus der Übereinstimmung im
Costüm ergibt sseh aber die Thatsache, dass die Kapuze
der Madonna, die Fransen ihres Ärmels und der Stern
auf der Schulter nicht Kennzeichen der Schönen Maria
von Regensburg, sondern des Lucas-Bildes in Rom sind.
Max Lehrs.
1 Das Berliner Kabinet erwarb 1878 ein Exemplar der Pfortzheimer Madonn
ohne Ortsangabe und Datum, 202 : 155 Mm. Einf.