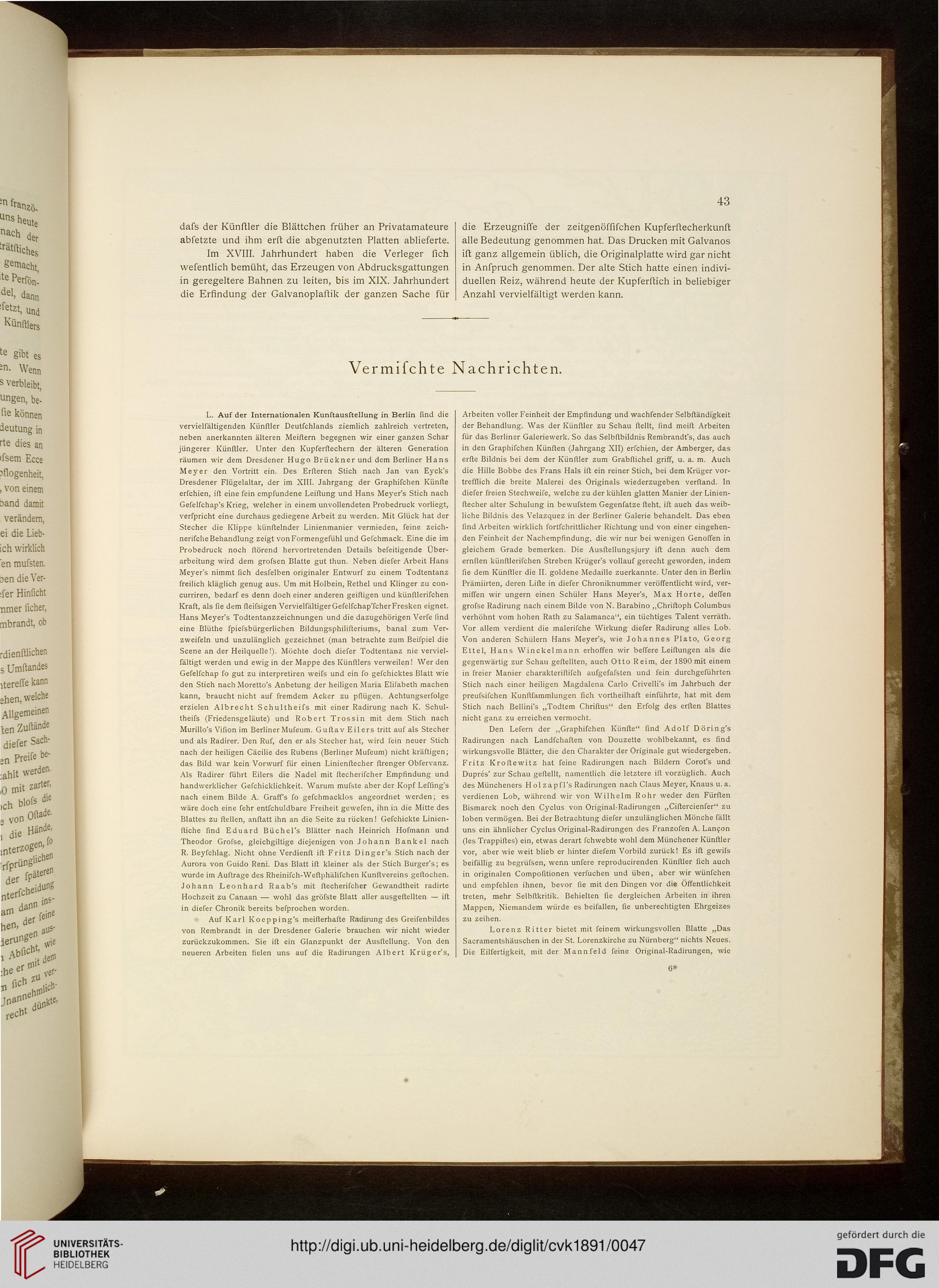43
dass der Künstler die Blättchen früher an Privatamateure
absetzte und ihm erst die abgenutzten Platten ablieferte.
Im XVIII. Jahrhundert haben die Verleger sich
wesentlich bemüht, das Erzeugen von Abdrucksgattungen
in geregeltere Bahnen zu leiten, bis im XIX. Jahrhundert
die Erfindung der Galvanoplastik der ganzen Sache für
die Erzeugnisse der zeitgenössischen Kupferstecherkunst
alle Bedeutung genommen hat. Das Drucken mit Galvanos
ist ganz allgemein üblich, die Originalplatte wird gar nicht
in Anspruch genommen. Der alte Stich hatte einen indivi-
duellen Reiz, während heute der Kupferstich in beliebiger
Anzahl vervielfältigt werden kann.
Vermischte Nachrichten.
L. Auf der Internationalen Kunstausstellung in Berlin sind die
vervielsältigenden Künstler Deutschlands ziemlich zahlreich vertreten,
neben anerkannten älteren Meistern begegnen wir einer ganzen Schar
jüngerer Künstler. Unter den Kupferstechern der älteren Generation
räumen wir dem Dresdener Hugo Brückner und dem Berliner Hans
Meyer den Vortritt ein. Des Errteren Stich nach Jan van Eyck's
Dresdener Flügelaltar, der im XIII, Jahrgang der Graphischen Künste
erschien, ist eine fein empfundene Leistung und Hans Meyer's Stich nach
Geselschap's Krieg, welcher in einem unvollendeten Probedruck vorliegt,
verspricht eine durchaus gediegene Arbeit zu werden. Mit Glück hat der
Stecher die Klippe künstelnder Linienmanier vermieden, seine zeich-
nerische Behandlung zeigt von Formengefühl und Geschmack. Eine die im
Probedruck noch störend hervortretenden Details beseitigende Über-
arbeitung wird dem grossen Blatte gut thun, Neben dieser Arbeit Hans
Meyer's nimmt sich desselben originaler Entwurf zu einem Todtentanz
freilich kläglich genug aus. Um mit Holbein, Rethel und Klinger zu con-
curriren, bedarf es denn doch einer anderen geistigen und künstlerischen
Kraft, als sie dem sieissigen VervielfältigerGeselschap'scherFresken eignet.
Hans Meyer's Todtentanzzeichnungen und die dazugehörigen Verse sind
eine Blüthe spiessbürgerlicben Bildungsphilisteriums, banal zum Ver-
zweiseln und unzulänglich gezeichnet (man betrachte zum Beispiel die
Scene an der Heilquelle!). Möchte doch dieser Todtentanz nie verviel-
fältigt werden und ewig in der Mappe des Künstlers verweilen! Wer den
Geseischap so gut zu interpretiren weiss und ein so geschicktes Blatt wie
den Stich nach Moretto's Anbetung der heiligen Maria Elisabeth machen
kann, braucht nicht auf fremdem Acker zu pflügen. Achtungsersolge
erzielen Albrecht Schultheiss mit einer Radirung nach K. Schul-
theiss (Friedensgeläute) und Robert Trossin mit dem Stich nach
Murillo's Vision im Berliner Museum. Gustav Eil ers tritt aus als Stecher
und als Radirer. Den Ruf, den er als Stecher hat, wird sein neuer Stich
nach der heiligen Cäcilie des Rubens (Berliner Museum) nicht kräftigen;
das Bild war kein Vorwurf sür einen Linienstecher strenger Observanz.
Als Radirer sührt Eilers die Nadel mit stecherischer Empfindung und
handwerklicher Geschicklichkeit. Warum musste aber der Kopf Lessing's
nach einem Bilde A. Grasf's so geschmacklos angeordnet werden; es
wäre doch eine sehr entschuldbare Freiheit gewesen, ihn in die Mitte des
Blattes zu stellen, anstatt ihn an die Seite zu rücken! Geschickte Linien-
sliehe sind Eduard Büchel's Blätter nach Heinrich Hofinann und
Theodor Grosse, gleichgiltige diejenigen von Johann Bankel nach
R. Beyschlag. Nicht ohne Verdienst ist Fritz Dinger's Stich nach der
Aurora von Guido Reni. Das Blatt ist kleiner als der Stich Burger's; es
wurde im Austrage des Rheinisch-Westphälischen Kunstvereins gestochen.
Johann Leonhard Raab's mit stecherischer Gewandtheit radirte
Hochzeit zu Canaan — wohl das grösste Blatt aller ausgestellten — ist
in dieser Chronik bereits besprochen worden.
Aus Karl Koepping's meisterhafte Radirung des Greisenbildes
von Rembrandt in der Dresdener Galerie brauchen wir nicht wieder
zurückzukommen. Sie ist ein Glanzpunkt der Ausstellung. Von den
neueren Arbeiten fielen uns auf die Radirungen Albert Krüger's,
Arbeiten voller Feinheit der Empfindung und wachsender Selbstandigkeit
der Behandlung. Was der Künstler zu Schau stellt, sind meist Arbeiten
für das Berliner Galeriewerk. So das Selbsibildnis Rembrandt's, das auch
in den Graphischen Künsten (Jahrgang XII) erschien, der Amberger, das
erste Bildnis bei dem der Künstler zum Grabstichel grisf, u. a. m. Auch
die Hille Bobbe des Frans Hals ist ein reiner Stich, bei dem Krüger vor-
trefslich die breite Malerei des Originals wiederzugeben verstand. In
dieser freien Stechweise, welche zu der kühlen glatten Manier der Linien-
stecher alter Schulung in bewusstem Gegensatze sleht ist auch das weib-
liche Bildnis des Velazquez in der Berliner Galerie behandelt. Das eben
sind Arbeiten wirklich fortschrittlicher Richtung und von einer eingehen-
den Feinheit der Nachempfindung, die wir nur bei wenigen Genossen in
gleichem Grade bemerken. Die Ausstellungsjury ist denn auch dem
ernsten künstlerischen Streben Krüger's vollaufgerecht geworden, indem
sie dem Künstler die IL goldene Medaille zuerkannte. Unter den in Berlin
Prärmirten, deren Liste in dieser Chroniknummer veröffentlicht wird, ver-
missen wir ungern einen Schüler Hans Meyer's, Max Horte, dessen
grosse Radirung nach einem Bilde von N. Barabino „Christoph Columbus
verhöhnt vom hohen Rath zu Salamanca", ein tüchtiges Talent verräth.
Vor allem verdient die malerische Wirkung dieser Radirung alles Lob.
Von anderen Schülern Hans Meyer's, wie Johannes Plato, Georg
Ettel, Hans Winckelmann erhoffen wir bessere Leitungen als die
gegenwärtig zur Schau gestellten, auch Otto Reim, der 1890 mit einem
in freier Manier charakteristisch aufgefassten und fein durchgeführten
Stich nach einer heiligen Magdalena Carlo Crivelli's im Jahrbuch der
preussischen Kunstsammlungen sich vorteilhaft einsührte, hat mit dem
Stich nach Bellini's „Todtem Cbristus" den Erfolg des ersten Blattes
nicht ganz zu erreichen vermocht.
Den Lesern der „Graphischen Künste" sind Adolf Döring's
Radirungen nach Landschaften von Douzette wohlbekannt, es sind
wirkungsvolle Blätter, die den Charakter der Originale gut wiedergeben.
Fritz Krostewitz hat seine Radirungen nach Bildern Corot's und
Dupres' zur Schau gesiellt, namentlich die letztere ist vorzüglich. Auch
des Müncheners H olzapfl's Radirungen nach Claus Meyer, Knaus u.a.
verdienen Lob, während wir von Wilhelm Rohr weder den Fürsten
Bismarck noch den Cyclus von Original-Radirungen „Cistercienser" zu
loben vermögen. Bei der Betrachtung dieser unzulänglichen Mönche sällt
uns ein ähnlicher Cyclus Original-Radirungen des Franzosen A. Lancon
(les Trappistes) ein, etwas derart schwebte wohl dem Münchener Künstler
vor, aber wie weit blieb er hinter diesem Vorbild zurück! Es ist gewiss
beifällig zu begrüssen, wenn unsere reproducirenden Künstler sich auch
in originalen Compositionen verslachen und üben, aber wir wünsehen
und empfehlen ihnen, bevor üe mit den Dingen vor die Ösfentlichkeit
treten, mehr Selbstkritik. Behielten sie dergleichen Arbeiten in ihren
Mappen, Niemandem würde es beifallen, sie unberechtigten Ehrgeizes
zu zeihen.
Lorenz Ritter bietet mit seinem wirkungsvollen Blatte „Das
Sacramentshäuschen in der St. Lorenzkirche zu Nürnberg" nichts Neues.
Die Eilsertigkeit, mit der Mannfeld seine Original-Radirungen, wie
dass der Künstler die Blättchen früher an Privatamateure
absetzte und ihm erst die abgenutzten Platten ablieferte.
Im XVIII. Jahrhundert haben die Verleger sich
wesentlich bemüht, das Erzeugen von Abdrucksgattungen
in geregeltere Bahnen zu leiten, bis im XIX. Jahrhundert
die Erfindung der Galvanoplastik der ganzen Sache für
die Erzeugnisse der zeitgenössischen Kupferstecherkunst
alle Bedeutung genommen hat. Das Drucken mit Galvanos
ist ganz allgemein üblich, die Originalplatte wird gar nicht
in Anspruch genommen. Der alte Stich hatte einen indivi-
duellen Reiz, während heute der Kupferstich in beliebiger
Anzahl vervielfältigt werden kann.
Vermischte Nachrichten.
L. Auf der Internationalen Kunstausstellung in Berlin sind die
vervielsältigenden Künstler Deutschlands ziemlich zahlreich vertreten,
neben anerkannten älteren Meistern begegnen wir einer ganzen Schar
jüngerer Künstler. Unter den Kupferstechern der älteren Generation
räumen wir dem Dresdener Hugo Brückner und dem Berliner Hans
Meyer den Vortritt ein. Des Errteren Stich nach Jan van Eyck's
Dresdener Flügelaltar, der im XIII, Jahrgang der Graphischen Künste
erschien, ist eine fein empfundene Leistung und Hans Meyer's Stich nach
Geselschap's Krieg, welcher in einem unvollendeten Probedruck vorliegt,
verspricht eine durchaus gediegene Arbeit zu werden. Mit Glück hat der
Stecher die Klippe künstelnder Linienmanier vermieden, seine zeich-
nerische Behandlung zeigt von Formengefühl und Geschmack. Eine die im
Probedruck noch störend hervortretenden Details beseitigende Über-
arbeitung wird dem grossen Blatte gut thun, Neben dieser Arbeit Hans
Meyer's nimmt sich desselben originaler Entwurf zu einem Todtentanz
freilich kläglich genug aus. Um mit Holbein, Rethel und Klinger zu con-
curriren, bedarf es denn doch einer anderen geistigen und künstlerischen
Kraft, als sie dem sieissigen VervielfältigerGeselschap'scherFresken eignet.
Hans Meyer's Todtentanzzeichnungen und die dazugehörigen Verse sind
eine Blüthe spiessbürgerlicben Bildungsphilisteriums, banal zum Ver-
zweiseln und unzulänglich gezeichnet (man betrachte zum Beispiel die
Scene an der Heilquelle!). Möchte doch dieser Todtentanz nie verviel-
fältigt werden und ewig in der Mappe des Künstlers verweilen! Wer den
Geseischap so gut zu interpretiren weiss und ein so geschicktes Blatt wie
den Stich nach Moretto's Anbetung der heiligen Maria Elisabeth machen
kann, braucht nicht auf fremdem Acker zu pflügen. Achtungsersolge
erzielen Albrecht Schultheiss mit einer Radirung nach K. Schul-
theiss (Friedensgeläute) und Robert Trossin mit dem Stich nach
Murillo's Vision im Berliner Museum. Gustav Eil ers tritt aus als Stecher
und als Radirer. Den Ruf, den er als Stecher hat, wird sein neuer Stich
nach der heiligen Cäcilie des Rubens (Berliner Museum) nicht kräftigen;
das Bild war kein Vorwurf sür einen Linienstecher strenger Observanz.
Als Radirer sührt Eilers die Nadel mit stecherischer Empfindung und
handwerklicher Geschicklichkeit. Warum musste aber der Kopf Lessing's
nach einem Bilde A. Grasf's so geschmacklos angeordnet werden; es
wäre doch eine sehr entschuldbare Freiheit gewesen, ihn in die Mitte des
Blattes zu stellen, anstatt ihn an die Seite zu rücken! Geschickte Linien-
sliehe sind Eduard Büchel's Blätter nach Heinrich Hofinann und
Theodor Grosse, gleichgiltige diejenigen von Johann Bankel nach
R. Beyschlag. Nicht ohne Verdienst ist Fritz Dinger's Stich nach der
Aurora von Guido Reni. Das Blatt ist kleiner als der Stich Burger's; es
wurde im Austrage des Rheinisch-Westphälischen Kunstvereins gestochen.
Johann Leonhard Raab's mit stecherischer Gewandtheit radirte
Hochzeit zu Canaan — wohl das grösste Blatt aller ausgestellten — ist
in dieser Chronik bereits besprochen worden.
Aus Karl Koepping's meisterhafte Radirung des Greisenbildes
von Rembrandt in der Dresdener Galerie brauchen wir nicht wieder
zurückzukommen. Sie ist ein Glanzpunkt der Ausstellung. Von den
neueren Arbeiten fielen uns auf die Radirungen Albert Krüger's,
Arbeiten voller Feinheit der Empfindung und wachsender Selbstandigkeit
der Behandlung. Was der Künstler zu Schau stellt, sind meist Arbeiten
für das Berliner Galeriewerk. So das Selbsibildnis Rembrandt's, das auch
in den Graphischen Künsten (Jahrgang XII) erschien, der Amberger, das
erste Bildnis bei dem der Künstler zum Grabstichel grisf, u. a. m. Auch
die Hille Bobbe des Frans Hals ist ein reiner Stich, bei dem Krüger vor-
trefslich die breite Malerei des Originals wiederzugeben verstand. In
dieser freien Stechweise, welche zu der kühlen glatten Manier der Linien-
stecher alter Schulung in bewusstem Gegensatze sleht ist auch das weib-
liche Bildnis des Velazquez in der Berliner Galerie behandelt. Das eben
sind Arbeiten wirklich fortschrittlicher Richtung und von einer eingehen-
den Feinheit der Nachempfindung, die wir nur bei wenigen Genossen in
gleichem Grade bemerken. Die Ausstellungsjury ist denn auch dem
ernsten künstlerischen Streben Krüger's vollaufgerecht geworden, indem
sie dem Künstler die IL goldene Medaille zuerkannte. Unter den in Berlin
Prärmirten, deren Liste in dieser Chroniknummer veröffentlicht wird, ver-
missen wir ungern einen Schüler Hans Meyer's, Max Horte, dessen
grosse Radirung nach einem Bilde von N. Barabino „Christoph Columbus
verhöhnt vom hohen Rath zu Salamanca", ein tüchtiges Talent verräth.
Vor allem verdient die malerische Wirkung dieser Radirung alles Lob.
Von anderen Schülern Hans Meyer's, wie Johannes Plato, Georg
Ettel, Hans Winckelmann erhoffen wir bessere Leitungen als die
gegenwärtig zur Schau gestellten, auch Otto Reim, der 1890 mit einem
in freier Manier charakteristisch aufgefassten und fein durchgeführten
Stich nach einer heiligen Magdalena Carlo Crivelli's im Jahrbuch der
preussischen Kunstsammlungen sich vorteilhaft einsührte, hat mit dem
Stich nach Bellini's „Todtem Cbristus" den Erfolg des ersten Blattes
nicht ganz zu erreichen vermocht.
Den Lesern der „Graphischen Künste" sind Adolf Döring's
Radirungen nach Landschaften von Douzette wohlbekannt, es sind
wirkungsvolle Blätter, die den Charakter der Originale gut wiedergeben.
Fritz Krostewitz hat seine Radirungen nach Bildern Corot's und
Dupres' zur Schau gesiellt, namentlich die letztere ist vorzüglich. Auch
des Müncheners H olzapfl's Radirungen nach Claus Meyer, Knaus u.a.
verdienen Lob, während wir von Wilhelm Rohr weder den Fürsten
Bismarck noch den Cyclus von Original-Radirungen „Cistercienser" zu
loben vermögen. Bei der Betrachtung dieser unzulänglichen Mönche sällt
uns ein ähnlicher Cyclus Original-Radirungen des Franzosen A. Lancon
(les Trappistes) ein, etwas derart schwebte wohl dem Münchener Künstler
vor, aber wie weit blieb er hinter diesem Vorbild zurück! Es ist gewiss
beifällig zu begrüssen, wenn unsere reproducirenden Künstler sich auch
in originalen Compositionen verslachen und üben, aber wir wünsehen
und empfehlen ihnen, bevor üe mit den Dingen vor die Ösfentlichkeit
treten, mehr Selbstkritik. Behielten sie dergleichen Arbeiten in ihren
Mappen, Niemandem würde es beifallen, sie unberechtigten Ehrgeizes
zu zeihen.
Lorenz Ritter bietet mit seinem wirkungsvollen Blatte „Das
Sacramentshäuschen in der St. Lorenzkirche zu Nürnberg" nichts Neues.
Die Eilsertigkeit, mit der Mannfeld seine Original-Radirungen, wie