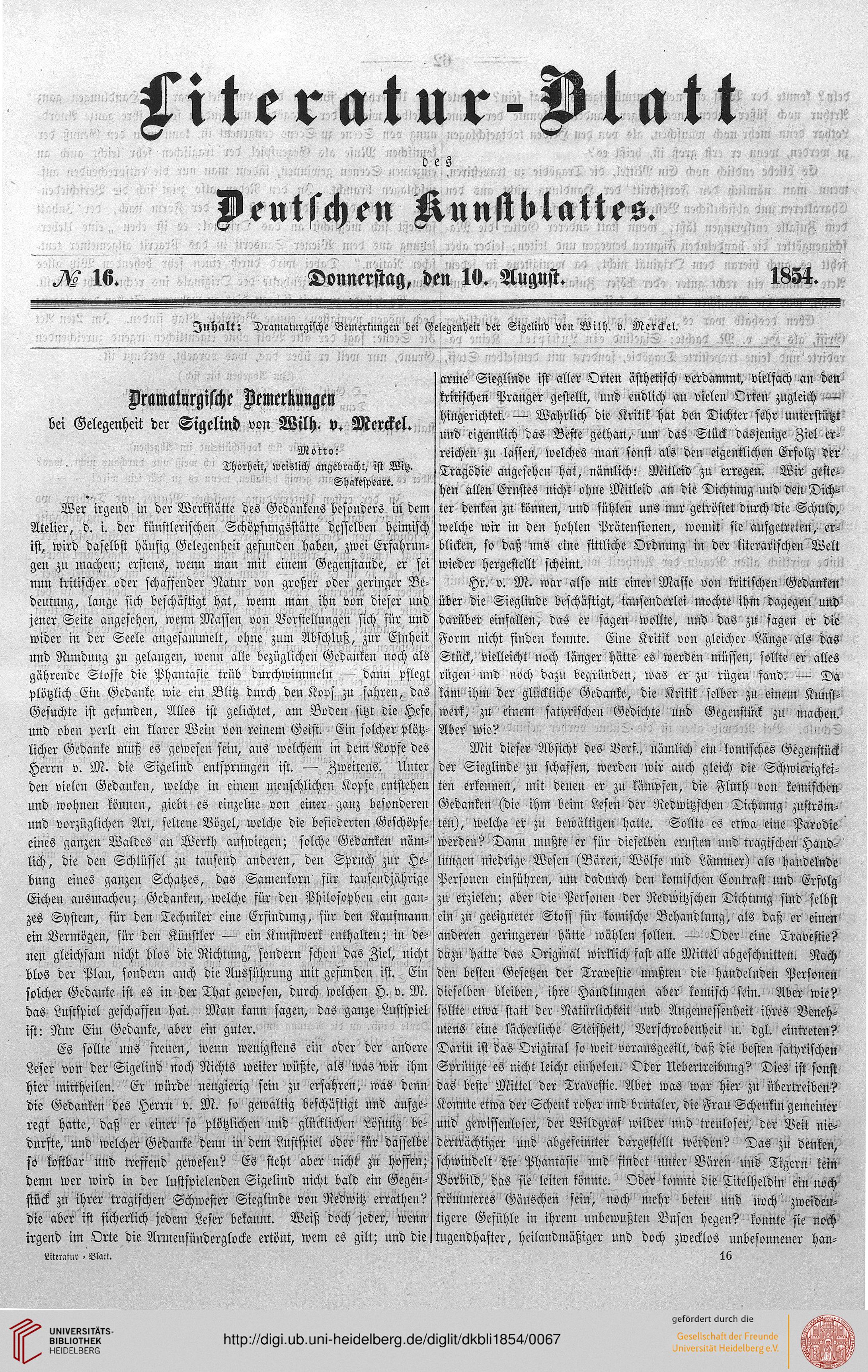Literatur
Dtatt
d e s
Deutschen Kunstblattes.
M 16.
Donnerstag, den 10. August.
1834.
Inhalt: Dramaturgische Bemerkungen bei Gelegenheit der Sigelind
von Wilh. v. Merckel.
Dramaturgische Bemerkungen
bei Gelegenheit der Sigelind von Wilh. v. Merckel.
Motto:
- Thorheit, weislich angebracht, ist Witz.
Shakespeare.
• - - • 'i ^ »f / '
Wer irgend in der Werkstätte des Gedankens besonders in dem
Atelier, d. i. der künstlerischen Schöpfungsstätte desselben heimisch
ist, wird daselbst häufig Gelegenheit gefunden haben, zwei Erfahrun-
gen zu machen; erstens, wenn man mit einem Gegenstände, er sei
nun kritischer oder schaffender Natur von großer oder geringer Be-
deutung, lange sich beschäftigt hat, wenn man ihn von dieser und
jener Seite angesehen, wenn Massen von Vorstellungen sich für und
wider in der Seele angesammelt, ohne zum Abschluß, zur Einheit
und Rundung zu gelangen, wenn alle bezüglichen Gedanken noch als
gährende Stoffe die Phantasie trüb durch wimmeln — dann pflegt
plötzlich Ein Gedanke wie ein Blitz durch den Kopf zu fahren, das
Gesuchte ist gefunden, Alles ist gelichtet, am Boden sitzt die Hefe
und oben perlt ein klarer Wein von reinem Geist. Ein solcher plötz-
licher Gedanke muß es gewesen sein, ans welchem in dem Kopfe des
Herrn v. M- die Sigelind entsprungen ist. — Zweitens. Unter
den vielen Gedanken, welche in einem menschlichen Kopfe entstehen
und wohnen können, giebt es einzelne von einer ganz besonderen
und vorzüglichen Art, seltene Vögel, welche die befiederten Geschöpfe
eines ganzen Waldes an Werth aufwiegen; solche Gedanken näm-
lich, die den Schlüssel zu tausend anderen, den Spruch zur He-
bung eines ganzen Schatzes, das Samenkorn' für tausendjährige
Eichen ansmachen; Gedanken, welche für den Philosophen ein gan-
zes System, für den Techniker eine Erfindung, für den Kaufmann
ein Vermögen, für den Künstler — ein Kunstwerk enthalten; in de-
nen gleichsam nicht blos die Richtung, sondern schon das Ziel, nicht
blos der Plan, sondern auch die Ausführung mit gesunden ist. Ein
solcher Gedanke ist es in der That gewesen, durch welchen H. v. M.
das Lustspiel geschaffen hat. Man kann sagen, das ganze Lustspiel
ist: Nur Ein Gedanke, aber ein guter.
Es sollte uns freuen, wenn wenigstens ein oder der andere
Leser von der Sigelind noch Nichts weiter wüßte, als was wir ihm
hier mittheilen. Er würde neugierig sein zu erfahren, was denn
die Gedanken des Herrn v. M. so gewaltig beschäftigt und aufge-
regt hatte, daß er einer so plötzlichen und glücklichen Lösung be-
durfte, und welcher Gedanke denn in dem Lustspiel oder für dasselbe
so kostbar und treffend gewesen? Es steht aber nicht zn hoffen;
denn wer wird in der lnstspielenden Sigelind nicht bald ein Gegen-
stück zu ihrer tragischen Schwester Sieglinde von Redwitz errathen?
die aber ist sicherlich jedem Leser bekannt. Weiß doch jeder, wenn
irgend im Orte die Armensünderglocke ertönt, wem es gilt; und die
Literatur - Blatt.
arme Sieglinde ist aller Orten ästhetisch verdammt, vielfach an den
kritischen Pranger gestellt, und endlich an vielen Orten zugleich —
hingerichtet. — Wahrlich die Kritik hat den Dichter sehr unterstützt
und eigentlich das Beste gethan/ um das Stück dasjenige Ziel er-
reichen zu lassen, welches man sonst als den eigentlichen Erfolg der
Tragödie angesehen hat, nämlich: Mitleid zu erregen. Wir geste-
hen allen Ernstes nicht ohne Mitleid an die Dichtung und den Dich-
ter denken zu können, und fühlen uns nur getröstet durch die Schuld,
welche wir in den hohlen Prätensionen, womit sie aufgetreten, er-
blicken, so daß uns eine sittliche Ordnung in der literarischen Welt
wieder hergestellt scheint.
Hr. v. M. war also mit einer Masse von kritischen Gedanken
über die Sieglinde beschäftigt, tausenderlei mochte ihm dagegen und
darüber einfallen, das er sagen wollte, und das zu sagen er die
Form nicht finden konnte. Eine Kritik von gleicher Länge als' das
Stück, vielleicht noch länger hätte es werden müssen, sollte er alles
rügen und noch dazu begründen, was er zu rügen fand. — Da
kam ihm der glückliche Gedanke, die Kritik selber zu einem Kunst-
werk, zu einem satyrischen Gedichte und Gegenstück zu machen.
Aber wie?
Mit dieser Absicht des Verf., nämlich ein komisches Gegenstück
der Sieglinde zu schaffen, werden wir auch gleich die Schwierigkei-
ten erkennen, mit denen er zu kämpfen, die Flnth von komischen
Gedanken (die ihm beim Lesen der Redwitzschen Dichtung zuström-
ten), welche er zu bewältigen hatte. Sollte es etwa eine Parodie
werden? Dann mußte er für dieselben ernsten und tragischen Hand-
lungen niedrige Wesen (Bären, Wölfe und Lämmer) als handelnde
Personen einführen, um dadurch den komischen Contrast und Erfolg
zu erzielen; aber die Personen der Redwitzschen Dichtung sind selbst
ein zu geeigneter Stoff für komische Behandlung, als daß er einen
anderen geringeren hätte wählen sollen. — Oder eine Travestie?
dazu hatte das Original wirklich fast alle Mittel abgeschnitten. Nach
den besten Gesetzen der Travestie mußten die handelnden Personen
dieselben bleiben, ihre Handlungen aber komisch sein. Aber wie?
sollte etwa statt der Natürlichkeit und Angemessenheit ihres Beneh-
mens eine lächerliche Steifheit, Verschrobenheit u. dgl. eintteten?
Darin ist das Original so weit vorausgeeilt, daß die besten satyrischen
Sprünge es nicht leicht einholen. Oder Uebertreibnng? Dies ist sonst
das' beste Mittel der Travestie. Aber was war hier zu übertreiben?
Konnte etwa der Schenk roher und brutaler, die Frau Schenkin gemeiner
und gewissenloser, der Wildgraf wilder und treuloser, der Veit nie-
derträchtiger und abgefeimter dargestellt werden? Das zu denken,
schwindelt die Phantasie und findet unter Bären und Tigern kein
Vorbild, das sie leiten könnte. Oder konnte die Titelheldin ein noch
frömmeres Gänschen sein, noch mehr beten und noch zweideu-
tigere Gefühle in ihrem unbewußten Busen hegen? konnte sie noch
tugendhafter, heilandmäßiger und doch zwecklos unbesonnener han-
16
Dtatt
d e s
Deutschen Kunstblattes.
M 16.
Donnerstag, den 10. August.
1834.
Inhalt: Dramaturgische Bemerkungen bei Gelegenheit der Sigelind
von Wilh. v. Merckel.
Dramaturgische Bemerkungen
bei Gelegenheit der Sigelind von Wilh. v. Merckel.
Motto:
- Thorheit, weislich angebracht, ist Witz.
Shakespeare.
• - - • 'i ^ »f / '
Wer irgend in der Werkstätte des Gedankens besonders in dem
Atelier, d. i. der künstlerischen Schöpfungsstätte desselben heimisch
ist, wird daselbst häufig Gelegenheit gefunden haben, zwei Erfahrun-
gen zu machen; erstens, wenn man mit einem Gegenstände, er sei
nun kritischer oder schaffender Natur von großer oder geringer Be-
deutung, lange sich beschäftigt hat, wenn man ihn von dieser und
jener Seite angesehen, wenn Massen von Vorstellungen sich für und
wider in der Seele angesammelt, ohne zum Abschluß, zur Einheit
und Rundung zu gelangen, wenn alle bezüglichen Gedanken noch als
gährende Stoffe die Phantasie trüb durch wimmeln — dann pflegt
plötzlich Ein Gedanke wie ein Blitz durch den Kopf zu fahren, das
Gesuchte ist gefunden, Alles ist gelichtet, am Boden sitzt die Hefe
und oben perlt ein klarer Wein von reinem Geist. Ein solcher plötz-
licher Gedanke muß es gewesen sein, ans welchem in dem Kopfe des
Herrn v. M- die Sigelind entsprungen ist. — Zweitens. Unter
den vielen Gedanken, welche in einem menschlichen Kopfe entstehen
und wohnen können, giebt es einzelne von einer ganz besonderen
und vorzüglichen Art, seltene Vögel, welche die befiederten Geschöpfe
eines ganzen Waldes an Werth aufwiegen; solche Gedanken näm-
lich, die den Schlüssel zu tausend anderen, den Spruch zur He-
bung eines ganzen Schatzes, das Samenkorn' für tausendjährige
Eichen ansmachen; Gedanken, welche für den Philosophen ein gan-
zes System, für den Techniker eine Erfindung, für den Kaufmann
ein Vermögen, für den Künstler — ein Kunstwerk enthalten; in de-
nen gleichsam nicht blos die Richtung, sondern schon das Ziel, nicht
blos der Plan, sondern auch die Ausführung mit gesunden ist. Ein
solcher Gedanke ist es in der That gewesen, durch welchen H. v. M.
das Lustspiel geschaffen hat. Man kann sagen, das ganze Lustspiel
ist: Nur Ein Gedanke, aber ein guter.
Es sollte uns freuen, wenn wenigstens ein oder der andere
Leser von der Sigelind noch Nichts weiter wüßte, als was wir ihm
hier mittheilen. Er würde neugierig sein zu erfahren, was denn
die Gedanken des Herrn v. M. so gewaltig beschäftigt und aufge-
regt hatte, daß er einer so plötzlichen und glücklichen Lösung be-
durfte, und welcher Gedanke denn in dem Lustspiel oder für dasselbe
so kostbar und treffend gewesen? Es steht aber nicht zn hoffen;
denn wer wird in der lnstspielenden Sigelind nicht bald ein Gegen-
stück zu ihrer tragischen Schwester Sieglinde von Redwitz errathen?
die aber ist sicherlich jedem Leser bekannt. Weiß doch jeder, wenn
irgend im Orte die Armensünderglocke ertönt, wem es gilt; und die
Literatur - Blatt.
arme Sieglinde ist aller Orten ästhetisch verdammt, vielfach an den
kritischen Pranger gestellt, und endlich an vielen Orten zugleich —
hingerichtet. — Wahrlich die Kritik hat den Dichter sehr unterstützt
und eigentlich das Beste gethan/ um das Stück dasjenige Ziel er-
reichen zu lassen, welches man sonst als den eigentlichen Erfolg der
Tragödie angesehen hat, nämlich: Mitleid zu erregen. Wir geste-
hen allen Ernstes nicht ohne Mitleid an die Dichtung und den Dich-
ter denken zu können, und fühlen uns nur getröstet durch die Schuld,
welche wir in den hohlen Prätensionen, womit sie aufgetreten, er-
blicken, so daß uns eine sittliche Ordnung in der literarischen Welt
wieder hergestellt scheint.
Hr. v. M. war also mit einer Masse von kritischen Gedanken
über die Sieglinde beschäftigt, tausenderlei mochte ihm dagegen und
darüber einfallen, das er sagen wollte, und das zu sagen er die
Form nicht finden konnte. Eine Kritik von gleicher Länge als' das
Stück, vielleicht noch länger hätte es werden müssen, sollte er alles
rügen und noch dazu begründen, was er zu rügen fand. — Da
kam ihm der glückliche Gedanke, die Kritik selber zu einem Kunst-
werk, zu einem satyrischen Gedichte und Gegenstück zu machen.
Aber wie?
Mit dieser Absicht des Verf., nämlich ein komisches Gegenstück
der Sieglinde zu schaffen, werden wir auch gleich die Schwierigkei-
ten erkennen, mit denen er zu kämpfen, die Flnth von komischen
Gedanken (die ihm beim Lesen der Redwitzschen Dichtung zuström-
ten), welche er zu bewältigen hatte. Sollte es etwa eine Parodie
werden? Dann mußte er für dieselben ernsten und tragischen Hand-
lungen niedrige Wesen (Bären, Wölfe und Lämmer) als handelnde
Personen einführen, um dadurch den komischen Contrast und Erfolg
zu erzielen; aber die Personen der Redwitzschen Dichtung sind selbst
ein zu geeigneter Stoff für komische Behandlung, als daß er einen
anderen geringeren hätte wählen sollen. — Oder eine Travestie?
dazu hatte das Original wirklich fast alle Mittel abgeschnitten. Nach
den besten Gesetzen der Travestie mußten die handelnden Personen
dieselben bleiben, ihre Handlungen aber komisch sein. Aber wie?
sollte etwa statt der Natürlichkeit und Angemessenheit ihres Beneh-
mens eine lächerliche Steifheit, Verschrobenheit u. dgl. eintteten?
Darin ist das Original so weit vorausgeeilt, daß die besten satyrischen
Sprünge es nicht leicht einholen. Oder Uebertreibnng? Dies ist sonst
das' beste Mittel der Travestie. Aber was war hier zu übertreiben?
Konnte etwa der Schenk roher und brutaler, die Frau Schenkin gemeiner
und gewissenloser, der Wildgraf wilder und treuloser, der Veit nie-
derträchtiger und abgefeimter dargestellt werden? Das zu denken,
schwindelt die Phantasie und findet unter Bären und Tigern kein
Vorbild, das sie leiten könnte. Oder konnte die Titelheldin ein noch
frömmeres Gänschen sein, noch mehr beten und noch zweideu-
tigere Gefühle in ihrem unbewußten Busen hegen? konnte sie noch
tugendhafter, heilandmäßiger und doch zwecklos unbesonnener han-
16