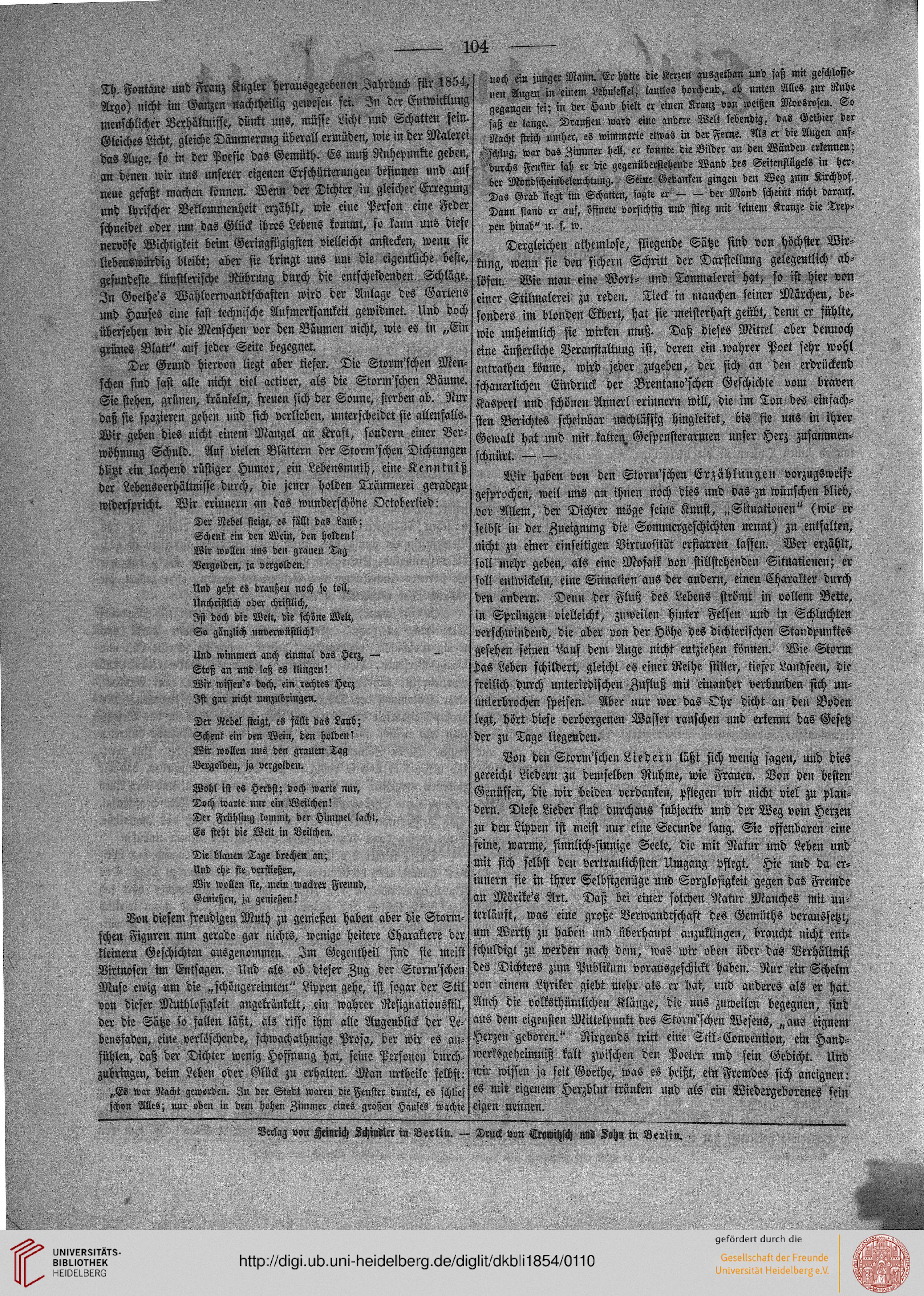104
Th. Fontane und Franz Kugler herausgegebenen Jahrbuch für 1854,
Argo) nicht im Ganzen nachtheilig gewesen sei. In der Entwicklung
menschlicher Verhältniffe, dünkt uns, müsse Licht nnd Schatten sein.
Gleiches Licht, gleiche Dämmerung überall ermüden, wie in der Malerei
das Auge, so in der Poesie das Gemüth. Es muß Ruhepunkte geben,
an denen wir uns unserer eigenen Erschütterungen besinnen und auf
neue gefaßt machen können. Wenn der Dichter in gleicher Erregung
und lyrischer Beklommenheit erzählt, wie eine Person eine Feder
schneidet oder um das Glück ihres Lebens kommt, so kann uns diese
nervöse Wichtigkeit beim Geringfügigsten vielleicht anstecken, wenn sie
liebenswürdig bleibt; aber sie bringt uns um die eigentliche beste,
gesundeste künstlerische Rührung durch die entscheidenden Schläge.
In Goethe's Wahlverwandtschaften wird der Anlage des Gartens
und Hauses eine fast technische Aufmerksamkeit gewidmet. Und doch
übersehen wir die Menschen vor den Bäumen nicht, wie es in „Ein
grünes Blatt" auf jeder Seite begegnet.
Der Grund hiervon liegt aber tiefer. Die Storm'schen Men-
schen sind fast alle nicht viel activer, als die Storm'schen Bäume.
Sie stehen, grünen, kränkeln, freuen sich der Sonne, sterben ab. Nur
daß sie spazieren gehen und sich verlieben, unterscheidet sie allenfalls.
Wir geben dies nicht einem Mangel an Kraft, sondern einer Ver-
wöhnung Schuld. Auf vielen Blättern der Storm'schen Dichtungen
blitzt ein lachend rüstiger Humor, ein Lebensmuth, eine Kenntniß
der Lebensverhältnisse durch, die jener holden Träumerei geradezu
widerspricht. Wir erinnern an das wunderschöne Octoberlied:
Der Nebel steigt, es fällt das Laub;
Scheut ein den Wein, den holden!
Wir wollen uns den grauen Tag
Vergolden, ja vergolden.
Und geht es draußen noch so toll,
Unchristlich oder christlich,
Ist doch die Welt, die schone Welt,
So gänzlich unverwüstlich!
Und wimmert auch einmal das Herz, —
Stoß an und laß es klingen!
Wir wisse»'« doch, ein rechtes Herz
Ist gar nicht nmzubringen.
Der Nebel steigt, es fallt das Laub;
Schenk ein den Wem, den holden!
Wir wollen uns den grauen Tag
Vergolden, ja vergolden.
Wohl ist es Herbst; doch warte nur,
Doch warte nur ein Weilchen!
Der Frühling kommt, der Himmel lacht,
Es steht die Welt in Veilchen.
Die blauen Tage brechen an;
Und ehe sie verfließen,
Wir wollen sie, mein wackrer Freund,
Genießen, ja genießen!
Von diesem fteudigen Muth zu genießen haben aber die Storm-
schen Figuren nun gerade gar nichts, wenige heitere Charaktere der
kleinern Geschichten ausgenommen. Im Gegenthcil sind sie ineist
Virtuosen im Entsagen. Und als ob dieser Zug der Storm'schen
Muse ewig um die „schöngereimtcn" Lippen gehe, ist sogar der Stil
von dieser Muthlosigkeit angekränkelt, ein wahrer Resignationsstil,
der die Sätze so fallen läßt, als risse ihm alle Augenblick der Le-
bensfaden, eine verlöschende, schwachathmige Prosa, der wir es an-
fühlen, daß der Dichter wenig Hoffnung hat, seine Personen durch-
zubringen, beim Leben oder Glück zu erhalten. Man urtheile selbst:
„ES war Nacht geworden. In der Stadt waren die Fenster dunkel, es schlief
schon Mes; nur oben in dem hohen Zimmer eines großen Hauses wachte
noch ein junger Mann. Er hatte die Kerzen ausgethan und saß mit geschloffe-
nen Augen in einem L-Hnseffel, lautlos horchend, ob unten Alles zur Ruhe
gegangen sei; in der Hand hielt er einen Kranz von weißen Moosrosen. So
saß er lange. Draußen ward eine andere Welt lebendig, das Gethier der
Nacht strich umher, es wimmerte etwas in der Ferne. Als er die Augen auf-
- schlug, war das Zimmer hell, er konnte die Bilder an den Wänden erkennen;
durchs Fenster sah er die gegenüberstehende Wand des Seitenflügels in her-
ber Mondscheinbeleuchtung. Seine Gedanken gingen den Weg zum Kirchhof.
Das Grab liegt im Schatten, sagte er — — der Mond scheint nicht darauf.
Dann stand er auf, öffnete vorsichttg und stieg mit seinem Kranze die Trep-
pen hinab" ». s. w.
Dergleichen athemlose, fliegende Sätze sind von höchster Wir-
kung, wenn sie den sichern Schritt der Darstellung gelegentlich ab-
lösen. Wie man eine Wort- und Tonmalerei hat, so ist hier von
einer Stilmalerei zu reden. Deck in manchen seiner Märchen, be-
sonders im blonden Ekbert, hat sie -meisterhaft geübt, denn er fühlte,
wie unheimlich sie wirken muß. Daß dieses Mittel aber dennoch
eine äußerliche Veranstaltung ist, deren ein wahrer Poet sehr wohl
entrathen könne, wird jeder zugeben, der sich an den erdrückend
schauerlichen Eindruck der Brentano'schen Geschichte vom braven
Kasperl und schönen Annerl erinnern will, die im Ton des einfach-
sten Berichtes scheinbar nachlässig hingleitet, bis sie uns in ihrer
Gewalt hat und mit kalten, Gespensterarmen unser Herz zusammen-
schnürt. —
Wir haben von den Storm'schen Erzählungen vorzugsweise
gesprochen, weil uns an ihnen noch dies und das zu wünschen blieb,
vor Allem, der Dichter möge seine Kunst, „Situationen" (wie er
selbst in der Zueignung die Sommergeschichten nennt) zu entfalten,
nicht zu einer einseittgen Virtuosität erstarren lassen. Wer erzählt,
soll mehr geben, als eine Mosaik von stillstehenden Situaüonen; er
soll entwickeln, eine Situatton aus der andern, einen Charakter durch
den andern. Denn der Fluß des Lebens strömt in vollem Bette,
in Sprüngen vielleicht, zuweilen hinter Felsen und in Schluchten
verschwindend, die aber von der Höhe des dichterischen Standpunktes
gesehen seinen Lauf dem Auge nicht entziehen können. Wie Storm
das Leben schildert, gleicht es einer Reihe Mer, tiefer Landseen, die
freilich durch unterirdischen Zufluß mit einander verbunden sich un-
unterbrochen speisen. Aber nur wer das Ohr dicht an den Boden
legt, hört diese verborgenen Wasser rauschen und erkennt das Gesetz
der zu Tage liegenden.
Von den Storm'schen Liedern läßt sich wenig sagen, und dies
gereicht Liedern zu demselben Ruhme, wie Frauen. Von den besten
Genüssen, die wir beiden verdanken, pflegen wir nicht viel zu plau-
dern. Diese Lieder sind durchaus subjectiv und der Weg vom Herzen
zu den Lippen ist meist nur eine Secunde lang. Sie offenbaren eine
feine, warme, sinnlich-sinnige Seele, die mit Natur und Leben und
mit sich selbst den vertraulichsten Umgang pflegt. Hie und da er-
innern sie in ihrer Selbstgenüge und Sorglosigkeit gegen das Fremde
an Mörike's Art. Daß bei einer solchen Natur Manches mit un-
terläuft, was eine große Verwandtschaft des Gemüths voraussetzt,
um Werth zu haben und überhaupt anzuklingen, braucht nicht ent-
schuldigt zu werden nach dem, was wir oben über das Verhältniß
des Dichters zum Publikum vorausgeschickt haben. Nur ein Schelm
von einem Lyriker giebt mehr als er hat, und anderes als er hat.
Auch die volksthümlichen Klänge, die uns zuweilen begegnen, sind
aus dem eigensten Mittelpunkt des Storm'schen Wesens, „aus eignem
Herzen geboren." Nirgends tritt eine Stil-Convention, ein Hand-
werksgeheimniß kalt zwischen den Poeten und sein Gedicht. Und
wir wissen ja seit Goethe, was es heißt, ein Fremdes sich aneignen:
es mit eigenem Herzblut tränken und als ein Wiedergeborenes sein
eigen nennen.
B-rlag von Heinrich Schindler in Berlin. — Druck von Trovihsch und Sohn in Berlin.
Th. Fontane und Franz Kugler herausgegebenen Jahrbuch für 1854,
Argo) nicht im Ganzen nachtheilig gewesen sei. In der Entwicklung
menschlicher Verhältniffe, dünkt uns, müsse Licht nnd Schatten sein.
Gleiches Licht, gleiche Dämmerung überall ermüden, wie in der Malerei
das Auge, so in der Poesie das Gemüth. Es muß Ruhepunkte geben,
an denen wir uns unserer eigenen Erschütterungen besinnen und auf
neue gefaßt machen können. Wenn der Dichter in gleicher Erregung
und lyrischer Beklommenheit erzählt, wie eine Person eine Feder
schneidet oder um das Glück ihres Lebens kommt, so kann uns diese
nervöse Wichtigkeit beim Geringfügigsten vielleicht anstecken, wenn sie
liebenswürdig bleibt; aber sie bringt uns um die eigentliche beste,
gesundeste künstlerische Rührung durch die entscheidenden Schläge.
In Goethe's Wahlverwandtschaften wird der Anlage des Gartens
und Hauses eine fast technische Aufmerksamkeit gewidmet. Und doch
übersehen wir die Menschen vor den Bäumen nicht, wie es in „Ein
grünes Blatt" auf jeder Seite begegnet.
Der Grund hiervon liegt aber tiefer. Die Storm'schen Men-
schen sind fast alle nicht viel activer, als die Storm'schen Bäume.
Sie stehen, grünen, kränkeln, freuen sich der Sonne, sterben ab. Nur
daß sie spazieren gehen und sich verlieben, unterscheidet sie allenfalls.
Wir geben dies nicht einem Mangel an Kraft, sondern einer Ver-
wöhnung Schuld. Auf vielen Blättern der Storm'schen Dichtungen
blitzt ein lachend rüstiger Humor, ein Lebensmuth, eine Kenntniß
der Lebensverhältnisse durch, die jener holden Träumerei geradezu
widerspricht. Wir erinnern an das wunderschöne Octoberlied:
Der Nebel steigt, es fällt das Laub;
Scheut ein den Wein, den holden!
Wir wollen uns den grauen Tag
Vergolden, ja vergolden.
Und geht es draußen noch so toll,
Unchristlich oder christlich,
Ist doch die Welt, die schone Welt,
So gänzlich unverwüstlich!
Und wimmert auch einmal das Herz, —
Stoß an und laß es klingen!
Wir wisse»'« doch, ein rechtes Herz
Ist gar nicht nmzubringen.
Der Nebel steigt, es fallt das Laub;
Schenk ein den Wem, den holden!
Wir wollen uns den grauen Tag
Vergolden, ja vergolden.
Wohl ist es Herbst; doch warte nur,
Doch warte nur ein Weilchen!
Der Frühling kommt, der Himmel lacht,
Es steht die Welt in Veilchen.
Die blauen Tage brechen an;
Und ehe sie verfließen,
Wir wollen sie, mein wackrer Freund,
Genießen, ja genießen!
Von diesem fteudigen Muth zu genießen haben aber die Storm-
schen Figuren nun gerade gar nichts, wenige heitere Charaktere der
kleinern Geschichten ausgenommen. Im Gegenthcil sind sie ineist
Virtuosen im Entsagen. Und als ob dieser Zug der Storm'schen
Muse ewig um die „schöngereimtcn" Lippen gehe, ist sogar der Stil
von dieser Muthlosigkeit angekränkelt, ein wahrer Resignationsstil,
der die Sätze so fallen läßt, als risse ihm alle Augenblick der Le-
bensfaden, eine verlöschende, schwachathmige Prosa, der wir es an-
fühlen, daß der Dichter wenig Hoffnung hat, seine Personen durch-
zubringen, beim Leben oder Glück zu erhalten. Man urtheile selbst:
„ES war Nacht geworden. In der Stadt waren die Fenster dunkel, es schlief
schon Mes; nur oben in dem hohen Zimmer eines großen Hauses wachte
noch ein junger Mann. Er hatte die Kerzen ausgethan und saß mit geschloffe-
nen Augen in einem L-Hnseffel, lautlos horchend, ob unten Alles zur Ruhe
gegangen sei; in der Hand hielt er einen Kranz von weißen Moosrosen. So
saß er lange. Draußen ward eine andere Welt lebendig, das Gethier der
Nacht strich umher, es wimmerte etwas in der Ferne. Als er die Augen auf-
- schlug, war das Zimmer hell, er konnte die Bilder an den Wänden erkennen;
durchs Fenster sah er die gegenüberstehende Wand des Seitenflügels in her-
ber Mondscheinbeleuchtung. Seine Gedanken gingen den Weg zum Kirchhof.
Das Grab liegt im Schatten, sagte er — — der Mond scheint nicht darauf.
Dann stand er auf, öffnete vorsichttg und stieg mit seinem Kranze die Trep-
pen hinab" ». s. w.
Dergleichen athemlose, fliegende Sätze sind von höchster Wir-
kung, wenn sie den sichern Schritt der Darstellung gelegentlich ab-
lösen. Wie man eine Wort- und Tonmalerei hat, so ist hier von
einer Stilmalerei zu reden. Deck in manchen seiner Märchen, be-
sonders im blonden Ekbert, hat sie -meisterhaft geübt, denn er fühlte,
wie unheimlich sie wirken muß. Daß dieses Mittel aber dennoch
eine äußerliche Veranstaltung ist, deren ein wahrer Poet sehr wohl
entrathen könne, wird jeder zugeben, der sich an den erdrückend
schauerlichen Eindruck der Brentano'schen Geschichte vom braven
Kasperl und schönen Annerl erinnern will, die im Ton des einfach-
sten Berichtes scheinbar nachlässig hingleitet, bis sie uns in ihrer
Gewalt hat und mit kalten, Gespensterarmen unser Herz zusammen-
schnürt. —
Wir haben von den Storm'schen Erzählungen vorzugsweise
gesprochen, weil uns an ihnen noch dies und das zu wünschen blieb,
vor Allem, der Dichter möge seine Kunst, „Situationen" (wie er
selbst in der Zueignung die Sommergeschichten nennt) zu entfalten,
nicht zu einer einseittgen Virtuosität erstarren lassen. Wer erzählt,
soll mehr geben, als eine Mosaik von stillstehenden Situaüonen; er
soll entwickeln, eine Situatton aus der andern, einen Charakter durch
den andern. Denn der Fluß des Lebens strömt in vollem Bette,
in Sprüngen vielleicht, zuweilen hinter Felsen und in Schluchten
verschwindend, die aber von der Höhe des dichterischen Standpunktes
gesehen seinen Lauf dem Auge nicht entziehen können. Wie Storm
das Leben schildert, gleicht es einer Reihe Mer, tiefer Landseen, die
freilich durch unterirdischen Zufluß mit einander verbunden sich un-
unterbrochen speisen. Aber nur wer das Ohr dicht an den Boden
legt, hört diese verborgenen Wasser rauschen und erkennt das Gesetz
der zu Tage liegenden.
Von den Storm'schen Liedern läßt sich wenig sagen, und dies
gereicht Liedern zu demselben Ruhme, wie Frauen. Von den besten
Genüssen, die wir beiden verdanken, pflegen wir nicht viel zu plau-
dern. Diese Lieder sind durchaus subjectiv und der Weg vom Herzen
zu den Lippen ist meist nur eine Secunde lang. Sie offenbaren eine
feine, warme, sinnlich-sinnige Seele, die mit Natur und Leben und
mit sich selbst den vertraulichsten Umgang pflegt. Hie und da er-
innern sie in ihrer Selbstgenüge und Sorglosigkeit gegen das Fremde
an Mörike's Art. Daß bei einer solchen Natur Manches mit un-
terläuft, was eine große Verwandtschaft des Gemüths voraussetzt,
um Werth zu haben und überhaupt anzuklingen, braucht nicht ent-
schuldigt zu werden nach dem, was wir oben über das Verhältniß
des Dichters zum Publikum vorausgeschickt haben. Nur ein Schelm
von einem Lyriker giebt mehr als er hat, und anderes als er hat.
Auch die volksthümlichen Klänge, die uns zuweilen begegnen, sind
aus dem eigensten Mittelpunkt des Storm'schen Wesens, „aus eignem
Herzen geboren." Nirgends tritt eine Stil-Convention, ein Hand-
werksgeheimniß kalt zwischen den Poeten und sein Gedicht. Und
wir wissen ja seit Goethe, was es heißt, ein Fremdes sich aneignen:
es mit eigenem Herzblut tränken und als ein Wiedergeborenes sein
eigen nennen.
B-rlag von Heinrich Schindler in Berlin. — Druck von Trovihsch und Sohn in Berlin.