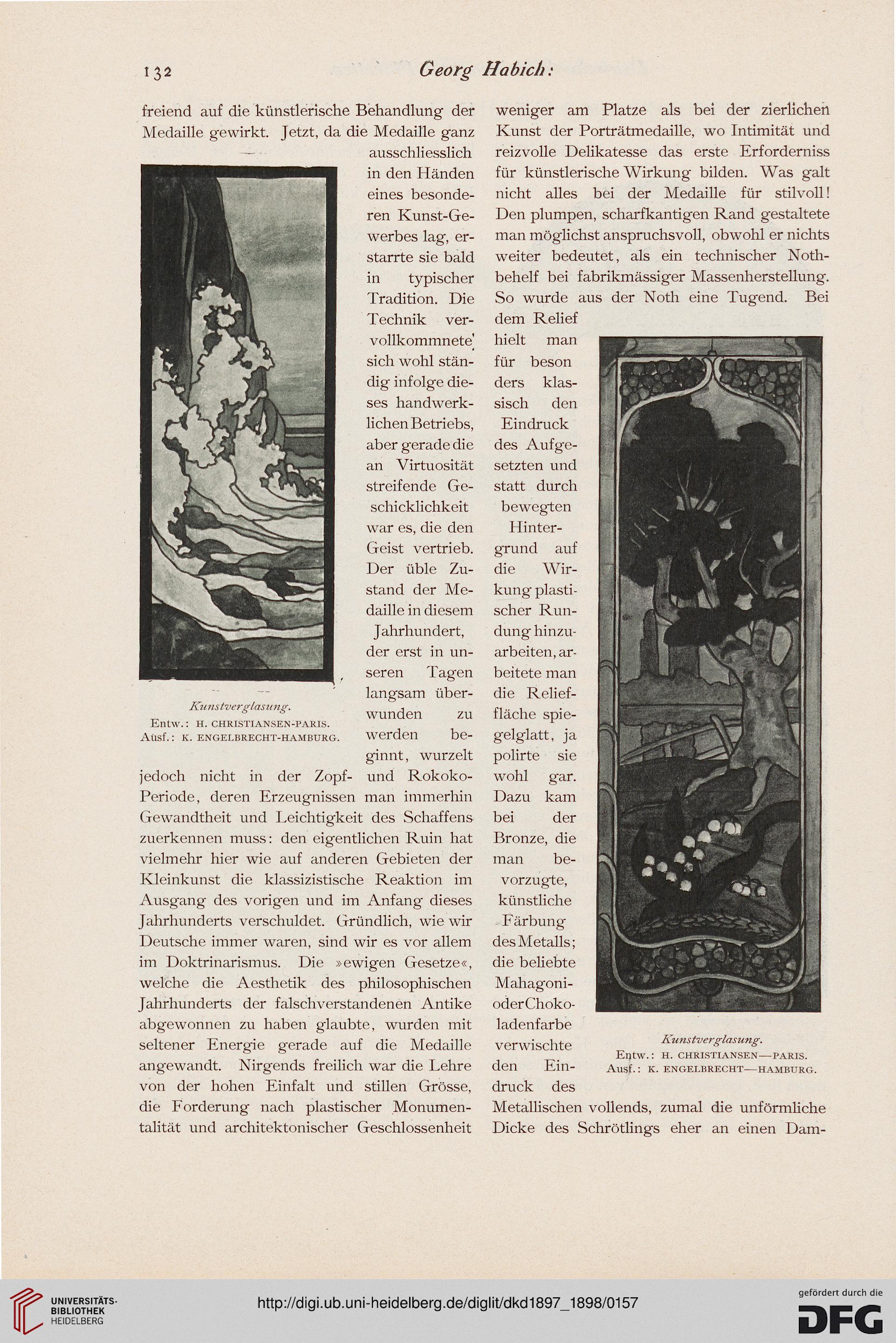132
Georg Habicli:
freiend auf die künstlerische Behandlung der
Medaille gewirkt. Jetzt, da die Medaille ganz
ausschliesslich
in den Händen
eines besonde-
ren Kunst-Ge-
werbes lag, er-
starrte sie bald
in typischer
Tradition. Die
Technik ver-
vollkommnete
sich wohl stän-
dig infolge die-
ses handwerk-
lichen Betriebs,
aber gerade die
an Virtuosität
streifende Ge-
schicklichkeit
war es, die den
Geist vertrieb.
Der üble Zu-
stand der Me-
daille in diesem
Jahrhundert,
der erst in un-
seren Tagen
langsam über-
wunden zu
werden be-
ginnt, wurzelt
jedoch nicht in der Zopf- und Rokoko-
Periode, deren Erzeugnissen man immerhin
Gewandtheit und Leichtigkeit des Schaffens
zuerkennen muss: den eigentlichen Ruin hat
vielmehr hier wie auf anderen Gebieten der
Kleinkunst die klassizistische Reaktion im
Ausgang des vorigen und im Anfang dieses
Jahrhunderts verschuldet. Gründlich, wie wir
Deutsche immer waren, sind wir es vor allem
im Doktrinarismus. Die »ewigen Gesetze«,
welche die Aesthetik des philosophischen
Jahrhunderts der falschverstandenen Antike
abgewonnen zu haben glaubte, wurden mit
seltener Energie gerade auf die Medaille
angewandt. Nirgends freilich war die Lehre
von der hohen Einfalt und stillen Grösse,
die Forderung nach plastischer Monumen-
talität und architektonischer Geschlossenheit
Kunatverglasung.
Entw. : H. CHRISTIANSEN-PARIS.
Aüsf.: K. ENGELBRECHT-HAMBURG.
weniger am Platze als bei der zierlichen
Kunst der Porträtmedaille, wo Intimität und
reizvolle Delikatesse das erste Erforderniss
für künstlerische Wirkung bilden. Was galt
nicht alles bei der Medaille für stilvoll!
Den plumpen, scharfkantigen Rand gestaltete
man möglichst anspruchsvoll, obwohl er nichts
weiter bedeutet, als ein technischer Noth-
behelf bei fabrikmässiger Massenherstellung.
So wurde aus der Noth eine Tugend. Bei
dem Relief
hielt man
für beson
ders klas-
sisch den
Eindruck
des Aufge-
setzten und
statt durch
bewegten
Hinter-
grund auf
die Wir-
kung plasti-
scher Run-
dung hinzu-
arbeiten, ar-
beitete man
die Relief-
fläche spie-
gelglatt, ja
polirte sie
wohl gar.
Dazu kam
bei der
Bronze, die
man be-
vorzugte,
künstliche
Färbung
des Metalls;
die beliebte
Mahagoni-
oderChoko-
ladenfarbe
verwischte
den Ein-
druck des
Metallischen vollends, zumal die unförmliche
Dicke des Schrödings eher an einen Dam-
Kunstverglasung.
Entw. : H. CHRISTIANSEN — PARIS.
Ausf. : K. ENGEI.BRECHT-HAMBURG.
Georg Habicli:
freiend auf die künstlerische Behandlung der
Medaille gewirkt. Jetzt, da die Medaille ganz
ausschliesslich
in den Händen
eines besonde-
ren Kunst-Ge-
werbes lag, er-
starrte sie bald
in typischer
Tradition. Die
Technik ver-
vollkommnete
sich wohl stän-
dig infolge die-
ses handwerk-
lichen Betriebs,
aber gerade die
an Virtuosität
streifende Ge-
schicklichkeit
war es, die den
Geist vertrieb.
Der üble Zu-
stand der Me-
daille in diesem
Jahrhundert,
der erst in un-
seren Tagen
langsam über-
wunden zu
werden be-
ginnt, wurzelt
jedoch nicht in der Zopf- und Rokoko-
Periode, deren Erzeugnissen man immerhin
Gewandtheit und Leichtigkeit des Schaffens
zuerkennen muss: den eigentlichen Ruin hat
vielmehr hier wie auf anderen Gebieten der
Kleinkunst die klassizistische Reaktion im
Ausgang des vorigen und im Anfang dieses
Jahrhunderts verschuldet. Gründlich, wie wir
Deutsche immer waren, sind wir es vor allem
im Doktrinarismus. Die »ewigen Gesetze«,
welche die Aesthetik des philosophischen
Jahrhunderts der falschverstandenen Antike
abgewonnen zu haben glaubte, wurden mit
seltener Energie gerade auf die Medaille
angewandt. Nirgends freilich war die Lehre
von der hohen Einfalt und stillen Grösse,
die Forderung nach plastischer Monumen-
talität und architektonischer Geschlossenheit
Kunatverglasung.
Entw. : H. CHRISTIANSEN-PARIS.
Aüsf.: K. ENGELBRECHT-HAMBURG.
weniger am Platze als bei der zierlichen
Kunst der Porträtmedaille, wo Intimität und
reizvolle Delikatesse das erste Erforderniss
für künstlerische Wirkung bilden. Was galt
nicht alles bei der Medaille für stilvoll!
Den plumpen, scharfkantigen Rand gestaltete
man möglichst anspruchsvoll, obwohl er nichts
weiter bedeutet, als ein technischer Noth-
behelf bei fabrikmässiger Massenherstellung.
So wurde aus der Noth eine Tugend. Bei
dem Relief
hielt man
für beson
ders klas-
sisch den
Eindruck
des Aufge-
setzten und
statt durch
bewegten
Hinter-
grund auf
die Wir-
kung plasti-
scher Run-
dung hinzu-
arbeiten, ar-
beitete man
die Relief-
fläche spie-
gelglatt, ja
polirte sie
wohl gar.
Dazu kam
bei der
Bronze, die
man be-
vorzugte,
künstliche
Färbung
des Metalls;
die beliebte
Mahagoni-
oderChoko-
ladenfarbe
verwischte
den Ein-
druck des
Metallischen vollends, zumal die unförmliche
Dicke des Schrödings eher an einen Dam-
Kunstverglasung.
Entw. : H. CHRISTIANSEN — PARIS.
Ausf. : K. ENGEI.BRECHT-HAMBURG.