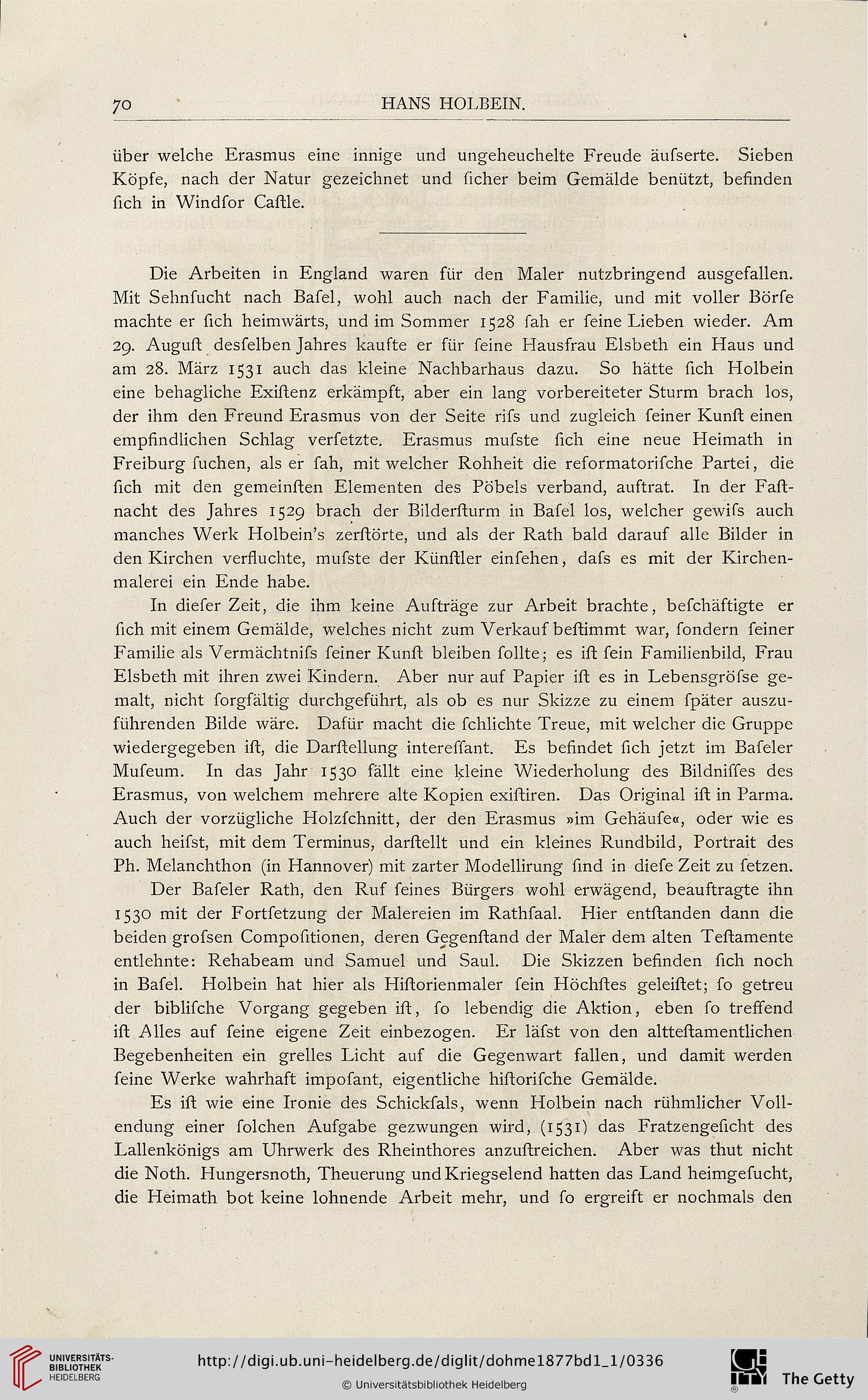/o
HANS HOLBEIN.
über welche Erasmus eine innige und ungeheuchelte Freude äusserte. Sieben
Köpfe, nach der Natur gezeichnet und sicher beim Gemälde benützt, befinden
sleh in Windsor Casfle.
Die Arbeiten in England waren für den Maler nutzbringend ausgefallen.
Mit Sehnsucht nach Basel, wohl auch nach der Familie, und mit voller Börse
machte er sich heimwärts, und im Sommer 1528 sah er seine Lieben wieder. Am
2p. August desselben Jahres kaufte er für seine Hausfrau Elsbeth ein Haus und
am 28. März 1531 auch das kleine Nachbarhaus dazu. So hätte sich Holbein
eine behagliche Existenz erkämpft, aber ein lang vorbereiteter Sturm brach los,
der ihm den Freund Erasmus von der Seite riss und zugleich seiner Kunst einen
empfindlichen Schlag versetzte. Erasmus musste sich eine neue Heimath in
Freiburg suchen, als er sah, mit welcher Rohheit die reformatorische Partei, die
sich mit den gemeinsten Elementen des Pöbels verband, auftrat. In der Fasl-
nacht des Jahres 132p brach der Bilderslurm in Basel los, welcher gewiss auch
manches Werk Holbein's zerslörte, und als der Rath bald darauf alle Bilder in
den Kirchen verfluchte, musste der KünsHer einsehen, dass es mit der Kirchen-
malerei ein Ende habe.
In dieser Zeit, die ihm keine Aufträge zur Arbeit brachte, beschäftigte er
sich mit einem Gemälde, welches nicht zum Verkauf bestimmt war, sondern seiner
Familie als Vermächtniss seiner Kunsl bleiben sollte; es isl sein Familienbild, Frau
Elsbeth mit ihren zwei Kindern. Aber nur auf Papier ist es in Lebensgrösse ge-
malt, nicht sorgfältig durchgeführt, als ob es nur Skizze zu einem später auszu-
führenden Bilde wäre. Dafür macht die schlichte Treue, mit welcher die Gruppe
wiedergegeben isl, die Darstellung interessant. Es befindet sleh jetzt im Baseler
Museum. In das Jahr 1330 fällt eine kleine Wiederholung des Bildnisses des
Erasmus, von welchem mehrere alte Kopien existiren. Das Original isl in Parma.
Auch der vorzügliche Holzschnitt, der den Erasmus Hm Gehäuse«, oder wie es
auch heisst, mit dem Terminus, darslellt und ein kleines Rundbild, Portrait des
Ph. Melanchthon (in Hannover) mit zarter Modellirung sind in diese Zeit zu setzen.
Der Baseler Rath, den Ruf seines Bürgers wohl erwägend, beauftragte ihn
1330 mit der Fortsetzung der Malereien im Rathsaal. Hier entslanden dann die
beiden grossen Compositionen, deren Gegenstand der Maler dem alten Teslamente
entlehnte: Rehabeam und Samuel und Saul. Die Skizzen befinden sleh noch
in Basel. Holbein hat hier als Hislorienmaler sein Höchsles geleislet; so getreu
der biblische Vorgang gegeben isl, so lebendig die Aktion, eben so treffend
isl Alles auf seine eigene Zeit einbezogen. Er lässt von den altteslamentlichen
Begebenheiten ein grelles Eicht auf die Gegenwart fallen, und damit werden
seine Werke wahrhaft imposant, eigentliche hislorische Gemälde.
Es isl wie eine Ironie des Schicksals, wenn Holbein nach rühmlicher Voll-
endung einer solchen Aufgabe gezwungen wird, (1531) das Fratzengesicht des
Lallenkönigs am Uhrwerk des Rheinthores anzuslreichen. Aber was thut nicht
die Noth. Hungersnoth, Theuerung und Kriegselend hatten das Land heimgesucht,
die Heimath bot keine lohnende Arbeit mehr, und so ergreift er nochmals den
HANS HOLBEIN.
über welche Erasmus eine innige und ungeheuchelte Freude äusserte. Sieben
Köpfe, nach der Natur gezeichnet und sicher beim Gemälde benützt, befinden
sleh in Windsor Casfle.
Die Arbeiten in England waren für den Maler nutzbringend ausgefallen.
Mit Sehnsucht nach Basel, wohl auch nach der Familie, und mit voller Börse
machte er sich heimwärts, und im Sommer 1528 sah er seine Lieben wieder. Am
2p. August desselben Jahres kaufte er für seine Hausfrau Elsbeth ein Haus und
am 28. März 1531 auch das kleine Nachbarhaus dazu. So hätte sich Holbein
eine behagliche Existenz erkämpft, aber ein lang vorbereiteter Sturm brach los,
der ihm den Freund Erasmus von der Seite riss und zugleich seiner Kunst einen
empfindlichen Schlag versetzte. Erasmus musste sich eine neue Heimath in
Freiburg suchen, als er sah, mit welcher Rohheit die reformatorische Partei, die
sich mit den gemeinsten Elementen des Pöbels verband, auftrat. In der Fasl-
nacht des Jahres 132p brach der Bilderslurm in Basel los, welcher gewiss auch
manches Werk Holbein's zerslörte, und als der Rath bald darauf alle Bilder in
den Kirchen verfluchte, musste der KünsHer einsehen, dass es mit der Kirchen-
malerei ein Ende habe.
In dieser Zeit, die ihm keine Aufträge zur Arbeit brachte, beschäftigte er
sich mit einem Gemälde, welches nicht zum Verkauf bestimmt war, sondern seiner
Familie als Vermächtniss seiner Kunsl bleiben sollte; es isl sein Familienbild, Frau
Elsbeth mit ihren zwei Kindern. Aber nur auf Papier ist es in Lebensgrösse ge-
malt, nicht sorgfältig durchgeführt, als ob es nur Skizze zu einem später auszu-
führenden Bilde wäre. Dafür macht die schlichte Treue, mit welcher die Gruppe
wiedergegeben isl, die Darstellung interessant. Es befindet sleh jetzt im Baseler
Museum. In das Jahr 1330 fällt eine kleine Wiederholung des Bildnisses des
Erasmus, von welchem mehrere alte Kopien existiren. Das Original isl in Parma.
Auch der vorzügliche Holzschnitt, der den Erasmus Hm Gehäuse«, oder wie es
auch heisst, mit dem Terminus, darslellt und ein kleines Rundbild, Portrait des
Ph. Melanchthon (in Hannover) mit zarter Modellirung sind in diese Zeit zu setzen.
Der Baseler Rath, den Ruf seines Bürgers wohl erwägend, beauftragte ihn
1330 mit der Fortsetzung der Malereien im Rathsaal. Hier entslanden dann die
beiden grossen Compositionen, deren Gegenstand der Maler dem alten Teslamente
entlehnte: Rehabeam und Samuel und Saul. Die Skizzen befinden sleh noch
in Basel. Holbein hat hier als Hislorienmaler sein Höchsles geleislet; so getreu
der biblische Vorgang gegeben isl, so lebendig die Aktion, eben so treffend
isl Alles auf seine eigene Zeit einbezogen. Er lässt von den altteslamentlichen
Begebenheiten ein grelles Eicht auf die Gegenwart fallen, und damit werden
seine Werke wahrhaft imposant, eigentliche hislorische Gemälde.
Es isl wie eine Ironie des Schicksals, wenn Holbein nach rühmlicher Voll-
endung einer solchen Aufgabe gezwungen wird, (1531) das Fratzengesicht des
Lallenkönigs am Uhrwerk des Rheinthores anzuslreichen. Aber was thut nicht
die Noth. Hungersnoth, Theuerung und Kriegselend hatten das Land heimgesucht,
die Heimath bot keine lohnende Arbeit mehr, und so ergreift er nochmals den