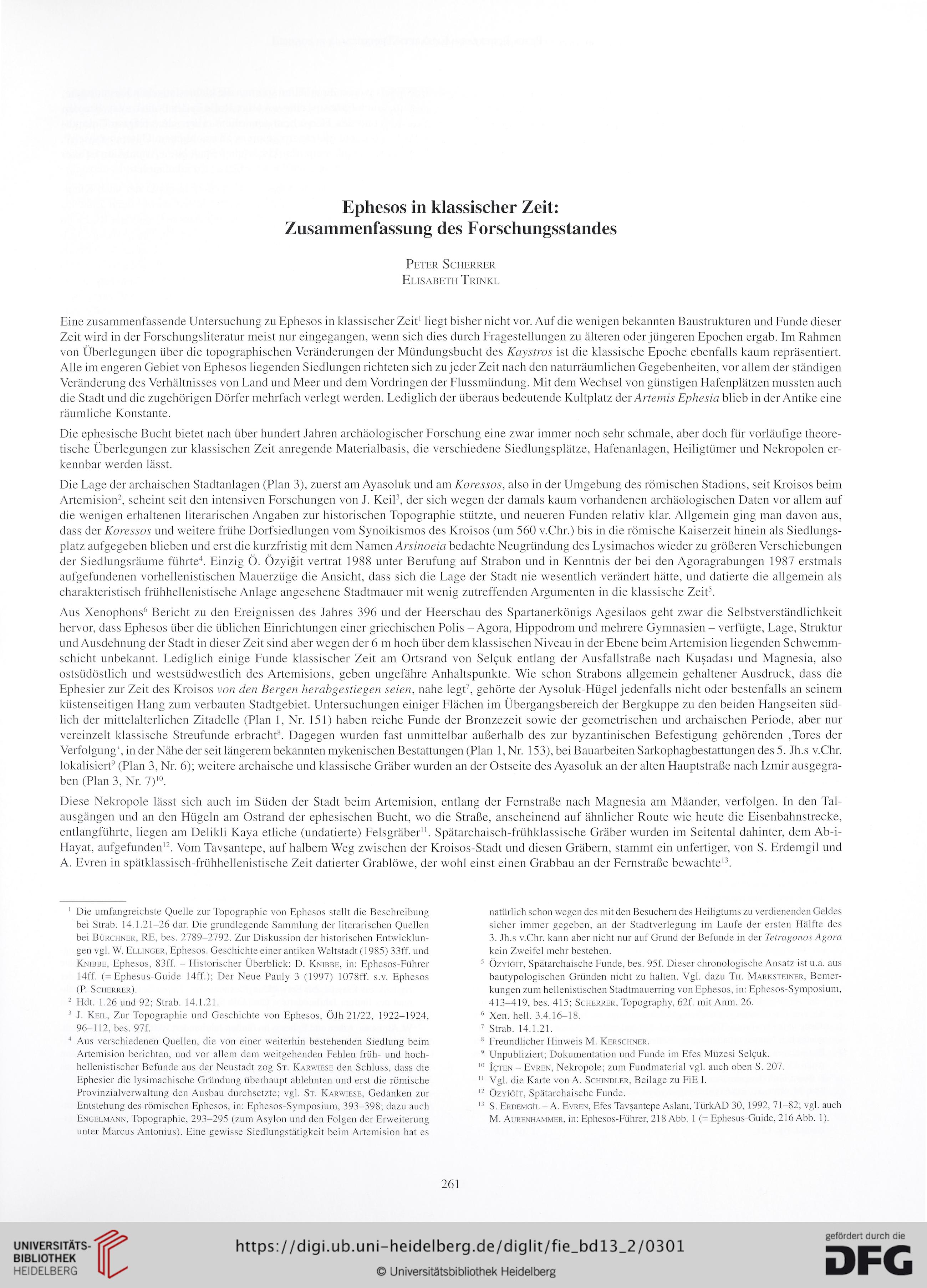Ephesos in klassischer Zeit:
Zusammenfassung des Forschungsstandes
Peter Scherrer
Elisabeth Trinke
Eine zusammenfassende Untersuchung zu Ephesos in klassischer Zeit1 liegt bisher nicht vor. Auf die wenigen bekannten Baustrukturen und Funde dieser
Zeit wird in der Forschungsliteratur meist nur eingegangen, wenn sich dies durch Fragestellungen zu älteren oder jüngeren Epochen ergab. Im Rahmen
von Überlegungen über die topographischen Veränderungen der Mündungsbucht des Kaystros ist die klassische Epoche ebenfalls kaum repräsentiert.
Alle im engeren Gebiet von Ephesos liegenden Siedlungen richteten sich zu jeder Zeit nach den naturräumlichen Gegebenheiten, vor allem der ständigen
Veränderung des Verhältnisses von Land und Meer und dem Vordringen der Flussmündung. Mit dem Wechsel von günstigen Hafenplätzen mussten auch
die Stadt und die zugehörigen Dörfer mehrfach verlegt werden. Lediglich der überaus bedeutende Kultplatz der Artemis Ephesia blieb in der Antike eine
räumliche Konstante.
Die ephesische Bucht bietet nach über hundert Jahren archäologischer Forschung eine zwar immer noch sehr schmale, aber doch für vorläufige theore-
tische Überlegungen zur klassischen Zeit anregende Materialbasis, die verschiedene Siedlungsplätze, Hafenanlagen, Heiligtümer und Nekropolen er-
kennbar werden lässt.
Die Lage der archaischen Stadtanlagen (Plan 3), zuerst am Ayasoluk und am Koressos, also in der Umgebung des römischen Stadions, seit Kroisos beim
Artemision2, scheint seit den intensiven Forschungen von J. Keil3, der sich wegen der damals kaum vorhandenen archäologischen Daten vor allem auf
die wenigen erhaltenen literarischen Angaben zur historischen Topographie stützte, und neueren Funden relativ klar. Allgemein ging man davon aus,
dass der Koressos und weitere frühe Dorfsiedlungen vom Synoikismos des Kroisos (um 560 v.Chr.) bis in die römische Kaiserzeit hinein als Siedlungs-
platz aufgegeben blieben und erst die kurzfristig mit dem Namen Arsinoeia bedachte Neugründung des Lysimachos wieder zu größeren Verschiebungen
der Siedlungsräume führte4. Einzig Ö. Özyigit vertrat 1988 unter Berufung auf Strabon und in Kenntnis der bei den Agoragrabungen 1987 erstmals
aufgefundenen vorhellenistischen Mauerzüge die Ansicht, dass sich die Lage der Stadt nie wesentlich verändert hätte, und datierte die allgemein als
charakteristisch frühhellenistische Anlage angesehene Stadtmauer mit wenig zutreffenden Argumenten in die klassische Zeit5.
Aus Xenophons6 Bericht zu den Ereignissen des Jahres 396 und der Heerschau des Spartanerkönigs Agesilaos geht zwar die Selbstverständlichkeit
hervor, dass Ephesos über die üblichen Einrichtungen einer griechischen Polis - Agora, Hippodrom und mehrere Gymnasien - verfügte, Lage, Struktur
und Ausdehnung der Stadt in dieser Zeit sind aber wegen der 6 m hoch über dem klassischen Niveau in der Ebene beim Artemision liegenden Schwemm-
schicht unbekannt. Lediglich einige Funde klassischer Zeit am Ortsrand von Selpuk entlang der Ausfallstraße nach Kusadasi und Magnesia, also
ostsüdöstlich und westsüdwestlich des Artemisions, geben ungefähre Anhaltspunkte. Wie schon Strabons allgemein gehaltener Ausdruck, dass die
Ephesier zur Zeit des Kroisos von den Bergen herabgestiegen seien, nahe legt7, gehörte der Aysoluk-Hügel jedenfalls nicht oder bestenfalls an seinem
küstenseitigen Hang zum verbauten Stadtgebiet. Untersuchungen einiger Flächen im Übergangsbereich der Bergkuppe zu den beiden Hangseiten süd-
lich der mittelalterlichen Zitadelle (Plan 1, Nr. 151) haben reiche Funde der Bronzezeit sowie der geometrischen und archaischen Periode, aber nur
vereinzelt klassische Streufunde erbracht8. Dagegen wurden fast unmittelbar außerhalb des zur byzantinischen Befestigung gehörenden ,Tores der
Verfolgung4, in der Nähe der seit längerem bekannten mykenischen Bestattungen (Plan 1, Nr. 153), bei Bauarbeiten Sarkophagbestattungen des 5. Jh.s v.Chr.
lokalisiert9 (Plan 3, Nr. 6); weitere archaische und klassische Gräber wurden an der Ostseite des Ayasoluk an der alten Hauptstraße nach Izmir ausgegra-
ben (Plan 3, Nr. 7)10.
Diese Nekropole lässt sich auch im Süden der Stadt beim Artemision, entlang der Fernstraße nach Magnesia am Mäander, verfolgen. In den Tal-
ausgängen und an den Hügeln am Ostrand der ephesischen Bucht, wo die Straße, anscheinend auf ähnlicher Route wie heute die Eisenbahnstrecke,
entlangführte, liegen am Delikli Kaya etliche (undatierte) Felsgräber11. Spätarchaisch-frühklassische Gräber wurden im Seitental dahinter, dem Ab-i-
Hayat, aufgefunden12. Vom Tavsantepe, auf halbem Weg zwischen der Kroisos-Stadt und diesen Gräbern, stammt ein unfertiger, von S. Erdemgil und
A. Evren in spätklassisch-frühhellenistische Zeit datierter Grablöwe, der wohl einst einen Grabbau an der Fernstraße bewachte13.
1 Die umfangreichste Quelle zur Topographie von Ephesos stellt die Beschreibung
bei Strab. 14.1.21-26 dar. Die grundlegende Sammlung der literarischen Quellen
bei Bürchner. RE, bes. 2789-2792. Zur Diskussion der historischen Entwicklun-
gen vgl. W. Ellinger, Ephesos. Geschichte einer antiken Weltstadt (1985) 33ff. und
Knibbe, Ephesos, 83ff. - Historischer Überblick: D. Knibbe, in: Ephesos-Führer
14ff. (= Ephesus-Guide 14ff.); Der Neue Pauly 3 (1997) 1078ff. s.v. Ephesos
(P. Scherrer).
2 Hdt. 1.26 und 92; Strab. 14.1.21.
3 J. Keil, Zur Topographie und Geschichte von Ephesos, ÖJh 21/22, 1922-1924,
96-112, bes. 97f.
4 Aus verschiedenen Quellen, die von einer weiterhin bestehenden Siedlung beim
Artemision berichten, und vor allem dem weitgehenden Fehlen früh- und hoch-
hellenistischer Befunde aus der Neustadt zog St. Karwiese den Schluss, dass die
Ephesier die lysimachische Gründung überhaupt ablehnten und erst die römische
Provinzialverwaltung den Ausbau durchsetzte; vgl. St. Karwiese, Gedanken zur
Entstehung des römischen Ephesos, in: Ephesos-Symposium, 393-398; dazu auch
Engelmann, Topographie, 293-295 (zum Asylon und den Folgen der Erweiterung
unter Marcus Antonius). Eine gewisse Siedlungstätigkeit beim Artemision hat es
natürlich schon wegen des mit den Besuchern des Heiligtums zu verdienenden Geldes
sicher immer gegeben, an der Stadtverlegung im Laufe der ersten Hälfte des
3. Jh.s v.Chr. kann aber nicht nur auf Grund der Befunde in der Tetragonos Agora
kein Zweifel mehr bestehen.
5 ÖzYiGiT, Spätarchaische Funde, bes. 95f. Dieser chronologische Ansatz ist u.a. aus
bautypologischen Gründen nicht zu halten. Vgl. dazu Th. Marksteiner, Bemer-
kungen zum hellenistischen Stadtmauerring von Ephesos, in: Ephesos-Symposium,
413-419, bes. 415; Scherrer, Topography, 62f. mit Anm. 26.
6 Xen. hell. 3.4.16-18.
7 Strab. 14.1.21.
8 Freundlicher Hinweis M. Kerschner.
9 Unpubliziert; Dokumentation und Funde im Efes Müzesi Selpuk.
10 Iqten - Evren, Nekropole; zum Fundmaterial vgl. auch oben S. 207.
11 Vgl. die Karte von A. Schindler, Beilage zu FiE I.
12 Özyigit, Spätarchaische Funde.
13 S. Erdemgil-A. Evren, Efes Tavsantepe Aslam, TürkAD 30, 1992, 71-82; vgl. auch
M. Aurenhammer, in: Ephesos-Führer, 218 Abb. 1 (= Ephesus-Guide, 216 Abb. 1).
261
Zusammenfassung des Forschungsstandes
Peter Scherrer
Elisabeth Trinke
Eine zusammenfassende Untersuchung zu Ephesos in klassischer Zeit1 liegt bisher nicht vor. Auf die wenigen bekannten Baustrukturen und Funde dieser
Zeit wird in der Forschungsliteratur meist nur eingegangen, wenn sich dies durch Fragestellungen zu älteren oder jüngeren Epochen ergab. Im Rahmen
von Überlegungen über die topographischen Veränderungen der Mündungsbucht des Kaystros ist die klassische Epoche ebenfalls kaum repräsentiert.
Alle im engeren Gebiet von Ephesos liegenden Siedlungen richteten sich zu jeder Zeit nach den naturräumlichen Gegebenheiten, vor allem der ständigen
Veränderung des Verhältnisses von Land und Meer und dem Vordringen der Flussmündung. Mit dem Wechsel von günstigen Hafenplätzen mussten auch
die Stadt und die zugehörigen Dörfer mehrfach verlegt werden. Lediglich der überaus bedeutende Kultplatz der Artemis Ephesia blieb in der Antike eine
räumliche Konstante.
Die ephesische Bucht bietet nach über hundert Jahren archäologischer Forschung eine zwar immer noch sehr schmale, aber doch für vorläufige theore-
tische Überlegungen zur klassischen Zeit anregende Materialbasis, die verschiedene Siedlungsplätze, Hafenanlagen, Heiligtümer und Nekropolen er-
kennbar werden lässt.
Die Lage der archaischen Stadtanlagen (Plan 3), zuerst am Ayasoluk und am Koressos, also in der Umgebung des römischen Stadions, seit Kroisos beim
Artemision2, scheint seit den intensiven Forschungen von J. Keil3, der sich wegen der damals kaum vorhandenen archäologischen Daten vor allem auf
die wenigen erhaltenen literarischen Angaben zur historischen Topographie stützte, und neueren Funden relativ klar. Allgemein ging man davon aus,
dass der Koressos und weitere frühe Dorfsiedlungen vom Synoikismos des Kroisos (um 560 v.Chr.) bis in die römische Kaiserzeit hinein als Siedlungs-
platz aufgegeben blieben und erst die kurzfristig mit dem Namen Arsinoeia bedachte Neugründung des Lysimachos wieder zu größeren Verschiebungen
der Siedlungsräume führte4. Einzig Ö. Özyigit vertrat 1988 unter Berufung auf Strabon und in Kenntnis der bei den Agoragrabungen 1987 erstmals
aufgefundenen vorhellenistischen Mauerzüge die Ansicht, dass sich die Lage der Stadt nie wesentlich verändert hätte, und datierte die allgemein als
charakteristisch frühhellenistische Anlage angesehene Stadtmauer mit wenig zutreffenden Argumenten in die klassische Zeit5.
Aus Xenophons6 Bericht zu den Ereignissen des Jahres 396 und der Heerschau des Spartanerkönigs Agesilaos geht zwar die Selbstverständlichkeit
hervor, dass Ephesos über die üblichen Einrichtungen einer griechischen Polis - Agora, Hippodrom und mehrere Gymnasien - verfügte, Lage, Struktur
und Ausdehnung der Stadt in dieser Zeit sind aber wegen der 6 m hoch über dem klassischen Niveau in der Ebene beim Artemision liegenden Schwemm-
schicht unbekannt. Lediglich einige Funde klassischer Zeit am Ortsrand von Selpuk entlang der Ausfallstraße nach Kusadasi und Magnesia, also
ostsüdöstlich und westsüdwestlich des Artemisions, geben ungefähre Anhaltspunkte. Wie schon Strabons allgemein gehaltener Ausdruck, dass die
Ephesier zur Zeit des Kroisos von den Bergen herabgestiegen seien, nahe legt7, gehörte der Aysoluk-Hügel jedenfalls nicht oder bestenfalls an seinem
küstenseitigen Hang zum verbauten Stadtgebiet. Untersuchungen einiger Flächen im Übergangsbereich der Bergkuppe zu den beiden Hangseiten süd-
lich der mittelalterlichen Zitadelle (Plan 1, Nr. 151) haben reiche Funde der Bronzezeit sowie der geometrischen und archaischen Periode, aber nur
vereinzelt klassische Streufunde erbracht8. Dagegen wurden fast unmittelbar außerhalb des zur byzantinischen Befestigung gehörenden ,Tores der
Verfolgung4, in der Nähe der seit längerem bekannten mykenischen Bestattungen (Plan 1, Nr. 153), bei Bauarbeiten Sarkophagbestattungen des 5. Jh.s v.Chr.
lokalisiert9 (Plan 3, Nr. 6); weitere archaische und klassische Gräber wurden an der Ostseite des Ayasoluk an der alten Hauptstraße nach Izmir ausgegra-
ben (Plan 3, Nr. 7)10.
Diese Nekropole lässt sich auch im Süden der Stadt beim Artemision, entlang der Fernstraße nach Magnesia am Mäander, verfolgen. In den Tal-
ausgängen und an den Hügeln am Ostrand der ephesischen Bucht, wo die Straße, anscheinend auf ähnlicher Route wie heute die Eisenbahnstrecke,
entlangführte, liegen am Delikli Kaya etliche (undatierte) Felsgräber11. Spätarchaisch-frühklassische Gräber wurden im Seitental dahinter, dem Ab-i-
Hayat, aufgefunden12. Vom Tavsantepe, auf halbem Weg zwischen der Kroisos-Stadt und diesen Gräbern, stammt ein unfertiger, von S. Erdemgil und
A. Evren in spätklassisch-frühhellenistische Zeit datierter Grablöwe, der wohl einst einen Grabbau an der Fernstraße bewachte13.
1 Die umfangreichste Quelle zur Topographie von Ephesos stellt die Beschreibung
bei Strab. 14.1.21-26 dar. Die grundlegende Sammlung der literarischen Quellen
bei Bürchner. RE, bes. 2789-2792. Zur Diskussion der historischen Entwicklun-
gen vgl. W. Ellinger, Ephesos. Geschichte einer antiken Weltstadt (1985) 33ff. und
Knibbe, Ephesos, 83ff. - Historischer Überblick: D. Knibbe, in: Ephesos-Führer
14ff. (= Ephesus-Guide 14ff.); Der Neue Pauly 3 (1997) 1078ff. s.v. Ephesos
(P. Scherrer).
2 Hdt. 1.26 und 92; Strab. 14.1.21.
3 J. Keil, Zur Topographie und Geschichte von Ephesos, ÖJh 21/22, 1922-1924,
96-112, bes. 97f.
4 Aus verschiedenen Quellen, die von einer weiterhin bestehenden Siedlung beim
Artemision berichten, und vor allem dem weitgehenden Fehlen früh- und hoch-
hellenistischer Befunde aus der Neustadt zog St. Karwiese den Schluss, dass die
Ephesier die lysimachische Gründung überhaupt ablehnten und erst die römische
Provinzialverwaltung den Ausbau durchsetzte; vgl. St. Karwiese, Gedanken zur
Entstehung des römischen Ephesos, in: Ephesos-Symposium, 393-398; dazu auch
Engelmann, Topographie, 293-295 (zum Asylon und den Folgen der Erweiterung
unter Marcus Antonius). Eine gewisse Siedlungstätigkeit beim Artemision hat es
natürlich schon wegen des mit den Besuchern des Heiligtums zu verdienenden Geldes
sicher immer gegeben, an der Stadtverlegung im Laufe der ersten Hälfte des
3. Jh.s v.Chr. kann aber nicht nur auf Grund der Befunde in der Tetragonos Agora
kein Zweifel mehr bestehen.
5 ÖzYiGiT, Spätarchaische Funde, bes. 95f. Dieser chronologische Ansatz ist u.a. aus
bautypologischen Gründen nicht zu halten. Vgl. dazu Th. Marksteiner, Bemer-
kungen zum hellenistischen Stadtmauerring von Ephesos, in: Ephesos-Symposium,
413-419, bes. 415; Scherrer, Topography, 62f. mit Anm. 26.
6 Xen. hell. 3.4.16-18.
7 Strab. 14.1.21.
8 Freundlicher Hinweis M. Kerschner.
9 Unpubliziert; Dokumentation und Funde im Efes Müzesi Selpuk.
10 Iqten - Evren, Nekropole; zum Fundmaterial vgl. auch oben S. 207.
11 Vgl. die Karte von A. Schindler, Beilage zu FiE I.
12 Özyigit, Spätarchaische Funde.
13 S. Erdemgil-A. Evren, Efes Tavsantepe Aslam, TürkAD 30, 1992, 71-82; vgl. auch
M. Aurenhammer, in: Ephesos-Führer, 218 Abb. 1 (= Ephesus-Guide, 216 Abb. 1).
261