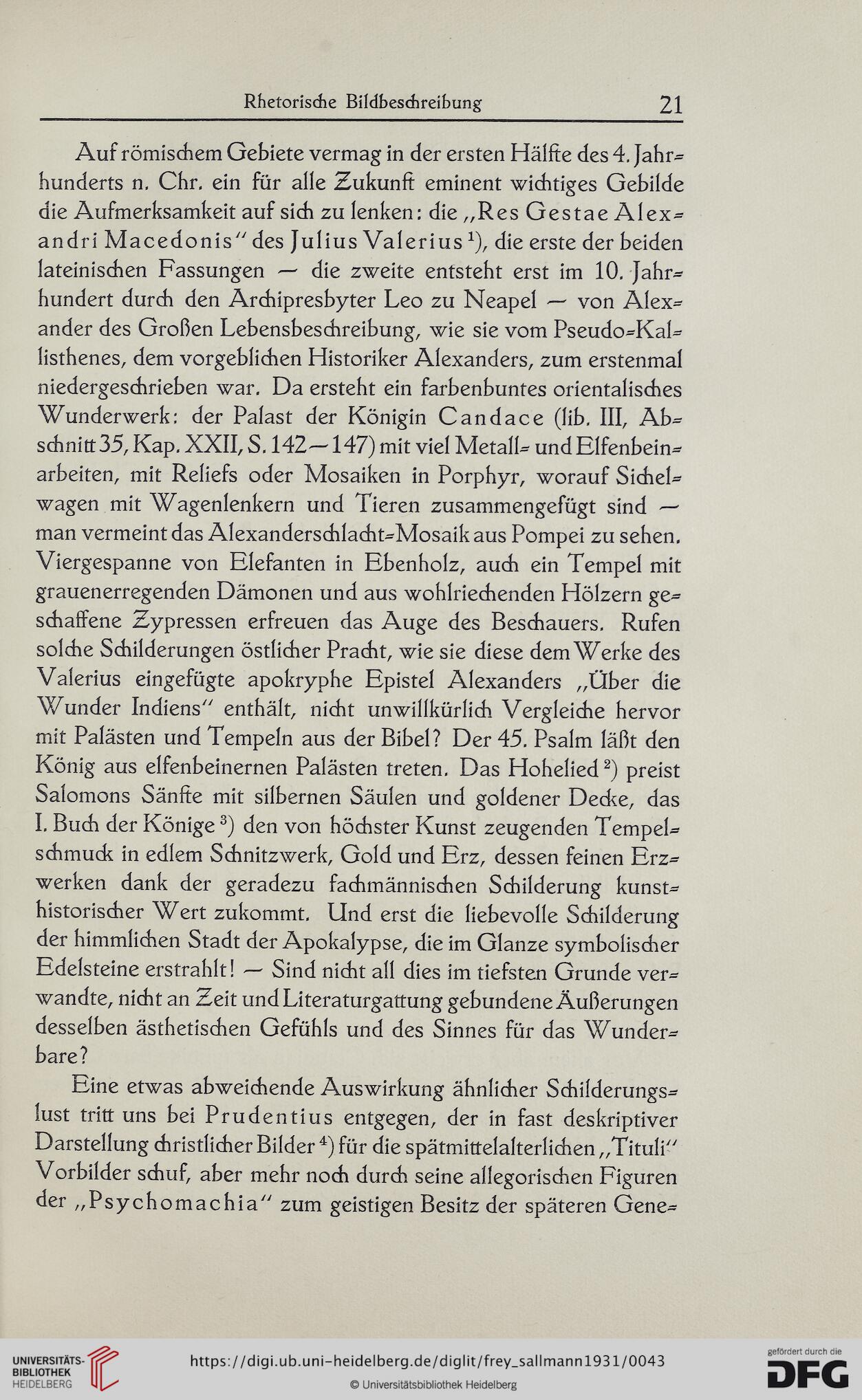Rhetorische Bildbeschreibung
21
Auf römischem Gebiete vermag in der ersten Hälfte des 4, Jahr-
hunderts n. Chr. ein für alle Zukunft eminent wichtiges Gebilde
die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken :die„ResGestaeAlex-
andri Macedonis" des Julius Valerius V die erste der beiden
lateinischen Fassungen —' die zweite entsteht erst im 10. Jahr-
hundert durch den Archipresbyter Leo zu Neapel — von Alex-
ander des Großen Lebensbeschreibung, wie sie vom Pseudo-KaL
listhenes, dem vorgeblichen Historiker Alexanders, zum erstenmal
niedergeschrieben war. Da ersteht ein farbenbuntes orientalisches
Wunderwerk: der Palast der Königin Candace (lib. III, Ab-
schnitt 35, Kap. XXII, S. 142—147) mit viel MetalL und Elfenbein-
arbeiten, mit Reliefs oder Mosaiken in Porphyr, worauf SicfteL
wagen mit Wagenlenkern und Tieren zusammengefügt sind —
man vermeint das Alexanderschlacht=Mosaikaus Pompei zu sehen.
Viergespanne von Elefanten in Ebenholz, auch ein Tempel mit
grauenerregenden Dämonen und aus wohlriechenden Hölzern ge-
schaffene Zypressen erfreuen das Auge des Beschauers, Rufen
solche Schilderungen östlicher Pracht, wie sie diese dem Werke des
Valerius eingefügte apokryphe Epistel Alexanders „Über die
Wunder Indiens" enthält, nicht unwillkürlich Vergleiche hervor
mit Palästen und Tempeln aus der Bibel? Der 45. Psalm läßt den
König aus elfenbeinernen Palästen treten. Das Hohelied2) preist
Salomons Sänfte mit silbernen Säulen und goldener Decke, das
I. Buch der Könige3) den von höchster Kunst zeugenden TempeL
schmuck in edlem Schnitzwerk, Gold und Erz, dessen feinen Erz«
werken dank der geradezu fachmännischen Schilderung kunst-
historischer Wert zukommt. Und erst die liebevolle Schilderung
der himmlichen Stadt der Apokalypse, die im Glanze symbolischer
Edelsteine erstrahlt! — Sind nicht all dies im tiefsten Grunde ver-
wandte, nicht an Zeit und Literaturgattung gebundene Äußerungen
desselben ästhetischen Gefühls und des Sinnes für das Wunder-
bare?
Eine etwas abweichende Auswirkung ähnlicher Schilderungs-
lust tritt uns bei Prudentius entgegen, der in fast deskriptiver
Darstellung christlicher Bilder 4) für die spätmittelalterlichen „Tituli"
Vorbilder schuf, aber mehr noch durch seine allegorischen Figuren
der „Psychomachia" zum geistigen Besitz der späteren Gene«
21
Auf römischem Gebiete vermag in der ersten Hälfte des 4, Jahr-
hunderts n. Chr. ein für alle Zukunft eminent wichtiges Gebilde
die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken :die„ResGestaeAlex-
andri Macedonis" des Julius Valerius V die erste der beiden
lateinischen Fassungen —' die zweite entsteht erst im 10. Jahr-
hundert durch den Archipresbyter Leo zu Neapel — von Alex-
ander des Großen Lebensbeschreibung, wie sie vom Pseudo-KaL
listhenes, dem vorgeblichen Historiker Alexanders, zum erstenmal
niedergeschrieben war. Da ersteht ein farbenbuntes orientalisches
Wunderwerk: der Palast der Königin Candace (lib. III, Ab-
schnitt 35, Kap. XXII, S. 142—147) mit viel MetalL und Elfenbein-
arbeiten, mit Reliefs oder Mosaiken in Porphyr, worauf SicfteL
wagen mit Wagenlenkern und Tieren zusammengefügt sind —
man vermeint das Alexanderschlacht=Mosaikaus Pompei zu sehen.
Viergespanne von Elefanten in Ebenholz, auch ein Tempel mit
grauenerregenden Dämonen und aus wohlriechenden Hölzern ge-
schaffene Zypressen erfreuen das Auge des Beschauers, Rufen
solche Schilderungen östlicher Pracht, wie sie diese dem Werke des
Valerius eingefügte apokryphe Epistel Alexanders „Über die
Wunder Indiens" enthält, nicht unwillkürlich Vergleiche hervor
mit Palästen und Tempeln aus der Bibel? Der 45. Psalm läßt den
König aus elfenbeinernen Palästen treten. Das Hohelied2) preist
Salomons Sänfte mit silbernen Säulen und goldener Decke, das
I. Buch der Könige3) den von höchster Kunst zeugenden TempeL
schmuck in edlem Schnitzwerk, Gold und Erz, dessen feinen Erz«
werken dank der geradezu fachmännischen Schilderung kunst-
historischer Wert zukommt. Und erst die liebevolle Schilderung
der himmlichen Stadt der Apokalypse, die im Glanze symbolischer
Edelsteine erstrahlt! — Sind nicht all dies im tiefsten Grunde ver-
wandte, nicht an Zeit und Literaturgattung gebundene Äußerungen
desselben ästhetischen Gefühls und des Sinnes für das Wunder-
bare?
Eine etwas abweichende Auswirkung ähnlicher Schilderungs-
lust tritt uns bei Prudentius entgegen, der in fast deskriptiver
Darstellung christlicher Bilder 4) für die spätmittelalterlichen „Tituli"
Vorbilder schuf, aber mehr noch durch seine allegorischen Figuren
der „Psychomachia" zum geistigen Besitz der späteren Gene«