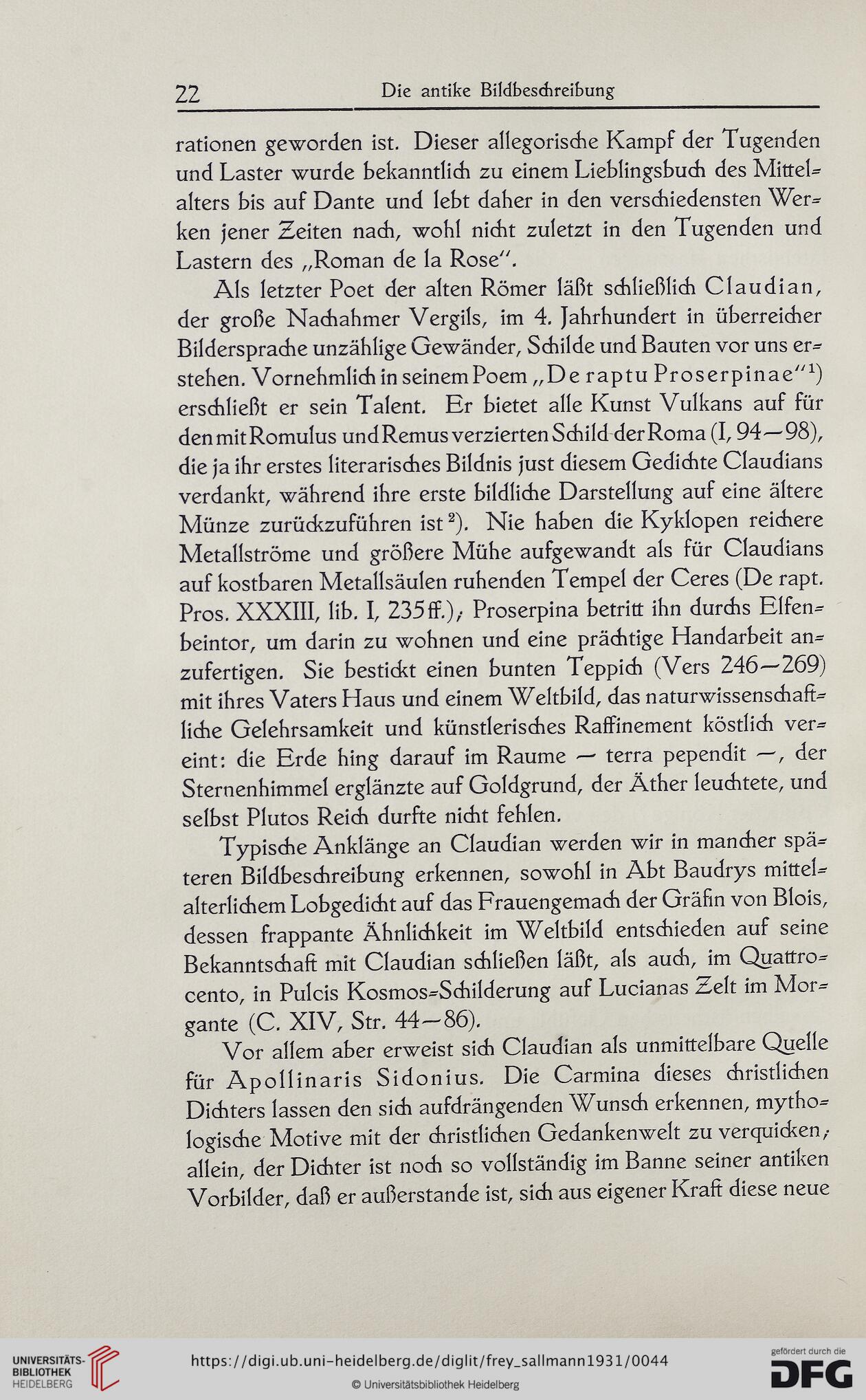22
Die antike Bildbeschreibung
rationen geworden ist. Dieser allegorische Kampf der Tugenden
und Laster wurde bekanntlich zu einem Lieblingsbuch des MitteL
alters bis auf Dante und lebt daher in den verschiedensten Wer-
ken jener Zeiten nach, wohl nicht zuletzt in den Tugenden und
Lastern des „Roman de la Rose".
Als letzter Poet der alten Römer läßt schließlich CI au di an,
der große Nachahmer Vergils, im 4. Jahrhundert in überreicher
Bildersprache unzählige Gewänder, Schilde und Bauten vor uns er-
stehen. Vornehmlich in seinemPoem „De raptu Proserpinae"1)
erschließt er sein Talent. Er bietet alle Kunst Vulkans auf für
denmitRomulus undRemus verzierten Schild der Roma (1,94—98),
die ja ihr erstes literarisches Bildnis just diesem Gedichte Claudians
verdankt, während ihre erste bildliche Darstellung auf eine ältere
Münze zurückzuführen ist2). Nie haben die Kyklopen reichere
Metallströme und größere Mühe aufgewandt als für Claudians
auf kostbaren Metallsäulen ruhenden Tempel der Ceres (De rapt.
Pros. XXXIII, lib. I, 235ff.),- Proserpina betritt ihn durchs Elfen^
beintor, um darin zu wohnen und eine prächtige Handarbeit an-
zufertigen. Sie bestickt einen bunten Teppich (Vers 246—269)
mit ihres Vaters Haus und einem Weltbild, das naturwissenschaft-
liche Gelehrsamkeit und künstlerisches Raffinement köstlich ver-
eint: die Erde hing darauf im Raume — terra pependit —, der
Sternenhimmel erglänzte auf Goldgrund, der Äther leuchtete, und
selbst Plutos Reich durfte nicht fehlen.
Typische Anklänge an Claudian werden wir in mancher spä-
teren Bildbeschreibung erkennen, sowohl in Abt Baudrys mittels
alterlichem Lobgedicht auf das Frauengemach der Gräfin von Blois,
dessen frappante Ähnlichkeit im Weltbild entschieden auf seine
Bekanntschaft mit Claudian schließen läßt, als auch, im Quattro-
cento, in Pulcis Kosmos-Schilderung auf Lucianas Zelt im Mor-
gante (C. XIV, Str. 44-86).
Vor allem aber erweist sich Claudian als unmittelbare Quelle
für Apollinaris Sidonius. Die Carmina dieses christlichen
Dichters lassen den sich aufdrängenden Wunsch erkennen, mytho^
logische Motive mit der christlichen Gedankenwelt zu verquicken,-
allein, der Dichter ist noch so vollständig im Banne seiner antiken
Vorbilder, daß er außerstande ist, sich aus eigener Kraft diese neue
Die antike Bildbeschreibung
rationen geworden ist. Dieser allegorische Kampf der Tugenden
und Laster wurde bekanntlich zu einem Lieblingsbuch des MitteL
alters bis auf Dante und lebt daher in den verschiedensten Wer-
ken jener Zeiten nach, wohl nicht zuletzt in den Tugenden und
Lastern des „Roman de la Rose".
Als letzter Poet der alten Römer läßt schließlich CI au di an,
der große Nachahmer Vergils, im 4. Jahrhundert in überreicher
Bildersprache unzählige Gewänder, Schilde und Bauten vor uns er-
stehen. Vornehmlich in seinemPoem „De raptu Proserpinae"1)
erschließt er sein Talent. Er bietet alle Kunst Vulkans auf für
denmitRomulus undRemus verzierten Schild der Roma (1,94—98),
die ja ihr erstes literarisches Bildnis just diesem Gedichte Claudians
verdankt, während ihre erste bildliche Darstellung auf eine ältere
Münze zurückzuführen ist2). Nie haben die Kyklopen reichere
Metallströme und größere Mühe aufgewandt als für Claudians
auf kostbaren Metallsäulen ruhenden Tempel der Ceres (De rapt.
Pros. XXXIII, lib. I, 235ff.),- Proserpina betritt ihn durchs Elfen^
beintor, um darin zu wohnen und eine prächtige Handarbeit an-
zufertigen. Sie bestickt einen bunten Teppich (Vers 246—269)
mit ihres Vaters Haus und einem Weltbild, das naturwissenschaft-
liche Gelehrsamkeit und künstlerisches Raffinement köstlich ver-
eint: die Erde hing darauf im Raume — terra pependit —, der
Sternenhimmel erglänzte auf Goldgrund, der Äther leuchtete, und
selbst Plutos Reich durfte nicht fehlen.
Typische Anklänge an Claudian werden wir in mancher spä-
teren Bildbeschreibung erkennen, sowohl in Abt Baudrys mittels
alterlichem Lobgedicht auf das Frauengemach der Gräfin von Blois,
dessen frappante Ähnlichkeit im Weltbild entschieden auf seine
Bekanntschaft mit Claudian schließen läßt, als auch, im Quattro-
cento, in Pulcis Kosmos-Schilderung auf Lucianas Zelt im Mor-
gante (C. XIV, Str. 44-86).
Vor allem aber erweist sich Claudian als unmittelbare Quelle
für Apollinaris Sidonius. Die Carmina dieses christlichen
Dichters lassen den sich aufdrängenden Wunsch erkennen, mytho^
logische Motive mit der christlichen Gedankenwelt zu verquicken,-
allein, der Dichter ist noch so vollständig im Banne seiner antiken
Vorbilder, daß er außerstande ist, sich aus eigener Kraft diese neue