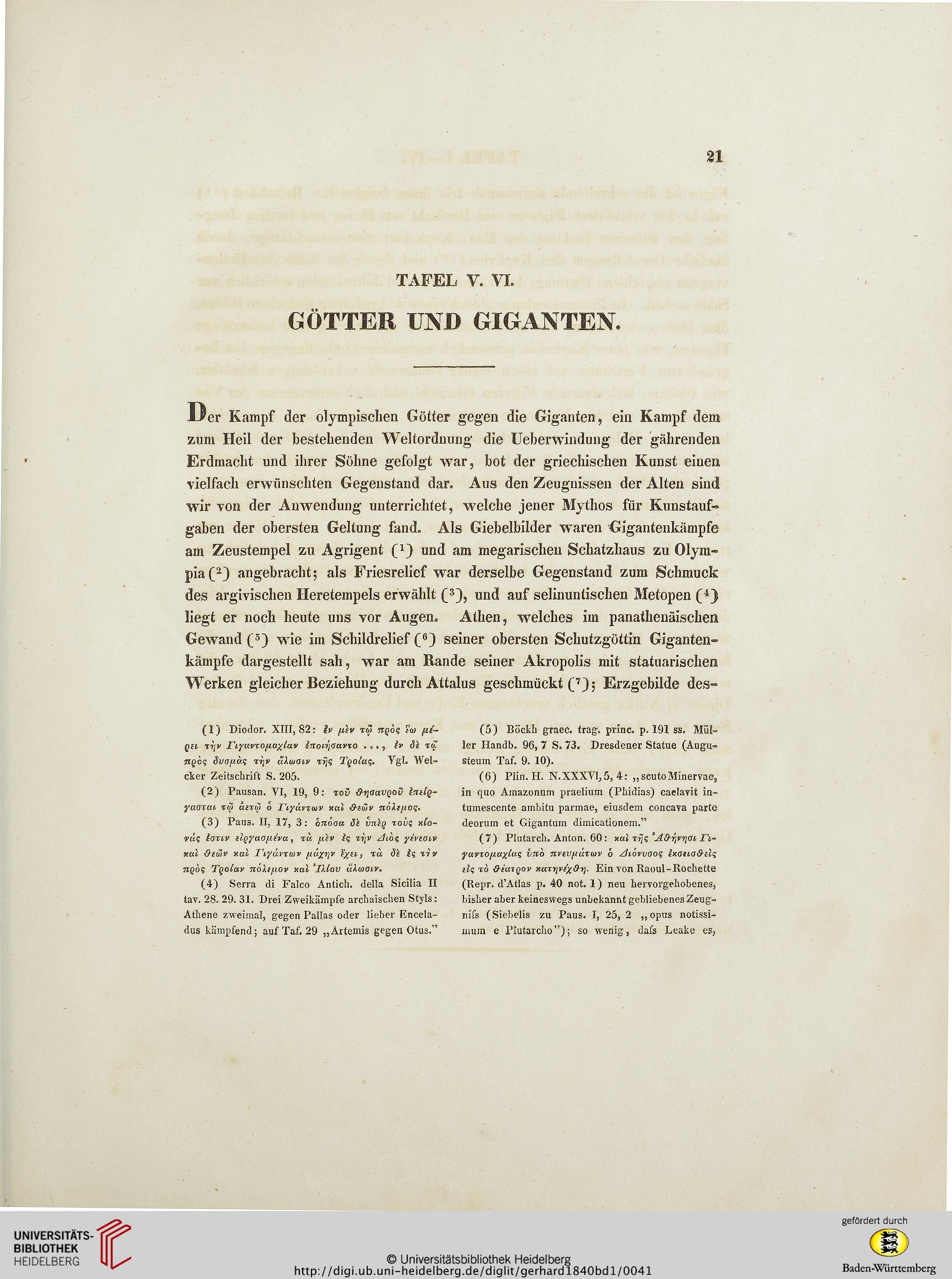21
TAFEL V. VI.
GÖTTER UND GIGANTEN,
Oer Kampf der olympischen Götter gegen die Giganten, ein Kampf dem
zum Heil der bestehenden Weltordnung die Ueberwindung der gährenden
Erdmaclit und ihrer Söhne gefolgt war, bot der griechischen Kunst einen
vielfach erwünschten Gegenstand dar. Aus den Zeugnissen der Alten sind
wir von der Anwendung unterrichtet, welche jener Mythos für Kunstauf-
gaben der obersten Geltung fand. Als Giebelbilder waren Gigantenkämpfe
am Zeustempel zu Agrigent (!) und am megarischen Schatzhaus zu Olym-
pia (1 2) angebracht; als Friesrelief war derselbe Gegenstand zum Schmuck
des argivischen Ileretempels erwählt (3}, und auf selinuntischen Metopen (4)
liegt er noch heute uns vor Augen. Athen, welches im panathenäischen
Gewand (5) wie im Schildrelief (6) seiner obersten Schutzgöttin Giganten-
kämpfe dargestellt sah, war am Rande seiner Akropolis mit statuarischen
Werken gleicher Beziehung durch Attalus geschmückt (7); Erzgebilde des-
(1) Diodor. XIII, 82: b> phv toi nqbq "w fil-
Qti tj]V riyuvTOfitt/tav lnoii]OavTO . .., Iv Sh tu
nq'oq 8vo/.iuq rrjv äXojotx ri]q Tqoluq. Vgl. Wel-
cher Zeitschrift S. 205.
(2) Pausan. VI, 19, 9: tov &i\aaVQOv Indq-
yaOTai toi «£tw o riyuvToiv )tui &ioiv noXi/.coq.
(3) Paus. II, 17, 3: onoaa 8h vnhq rovq xlo-
vuq Iotlv ilqyao^tha, tu fihv iq rijv zhoq yhvtoiv
xal &iwv xal JTiy uvtojv [xüyijv , tu 8h lq tt v
ziQoq Tqotav noXffiov xal ‘iXiov uXwaiv.
(4) Serra di Falco Antich. della Sicilia II
tav. 28. 29. 31. Drei Zweikämpfe archaischen Styls:
Athene zweimal, gegen Pallas oder lieber Encela-
dus kämpfend; auf Taf. 29 „Artemis gegen Otus.”
(5) Böckh graec. trag, princ. p. 191 ss. Mül-
ler Handb. 96, 7 S. 73. Dresdener Statue (Augu-
steum Taf. 9. 10).
(6) Plin. H. N.XXXVI,5, 4: „scutoMinervae,
in quo Amazonum praelium (Phidias) caelayit in-
tumescente ambitu parmae, eiusdem concava parte
deorum et Gigantum dimicationem.”
(7) Plutarch. Anton. 60: xal rijq ’A&tyriai ri-
yavTO[iuxtaq vnb nvev^ütoiv b ZUovvaoq Ixona&elq
dq t6 &euiQov xutijv^x&tj. Ein von Raoul-Rochette
(Repr. d’Atlas p. 40 not. 1) neu hervorgehobenes,
bisher aber keineswegs unbekannt gebliebenes Zeug-
nifs (Siebelis zu Paus. I, 25, 2 „opus notissi-
muin e Plutarcho”); so wenig, dafs Leake es,
TAFEL V. VI.
GÖTTER UND GIGANTEN,
Oer Kampf der olympischen Götter gegen die Giganten, ein Kampf dem
zum Heil der bestehenden Weltordnung die Ueberwindung der gährenden
Erdmaclit und ihrer Söhne gefolgt war, bot der griechischen Kunst einen
vielfach erwünschten Gegenstand dar. Aus den Zeugnissen der Alten sind
wir von der Anwendung unterrichtet, welche jener Mythos für Kunstauf-
gaben der obersten Geltung fand. Als Giebelbilder waren Gigantenkämpfe
am Zeustempel zu Agrigent (!) und am megarischen Schatzhaus zu Olym-
pia (1 2) angebracht; als Friesrelief war derselbe Gegenstand zum Schmuck
des argivischen Ileretempels erwählt (3}, und auf selinuntischen Metopen (4)
liegt er noch heute uns vor Augen. Athen, welches im panathenäischen
Gewand (5) wie im Schildrelief (6) seiner obersten Schutzgöttin Giganten-
kämpfe dargestellt sah, war am Rande seiner Akropolis mit statuarischen
Werken gleicher Beziehung durch Attalus geschmückt (7); Erzgebilde des-
(1) Diodor. XIII, 82: b> phv toi nqbq "w fil-
Qti tj]V riyuvTOfitt/tav lnoii]OavTO . .., Iv Sh tu
nq'oq 8vo/.iuq rrjv äXojotx ri]q Tqoluq. Vgl. Wel-
cher Zeitschrift S. 205.
(2) Pausan. VI, 19, 9: tov &i\aaVQOv Indq-
yaOTai toi «£tw o riyuvToiv )tui &ioiv noXi/.coq.
(3) Paus. II, 17, 3: onoaa 8h vnhq rovq xlo-
vuq Iotlv ilqyao^tha, tu fihv iq rijv zhoq yhvtoiv
xal &iwv xal JTiy uvtojv [xüyijv , tu 8h lq tt v
ziQoq Tqotav noXffiov xal ‘iXiov uXwaiv.
(4) Serra di Falco Antich. della Sicilia II
tav. 28. 29. 31. Drei Zweikämpfe archaischen Styls:
Athene zweimal, gegen Pallas oder lieber Encela-
dus kämpfend; auf Taf. 29 „Artemis gegen Otus.”
(5) Böckh graec. trag, princ. p. 191 ss. Mül-
ler Handb. 96, 7 S. 73. Dresdener Statue (Augu-
steum Taf. 9. 10).
(6) Plin. H. N.XXXVI,5, 4: „scutoMinervae,
in quo Amazonum praelium (Phidias) caelayit in-
tumescente ambitu parmae, eiusdem concava parte
deorum et Gigantum dimicationem.”
(7) Plutarch. Anton. 60: xal rijq ’A&tyriai ri-
yavTO[iuxtaq vnb nvev^ütoiv b ZUovvaoq Ixona&elq
dq t6 &euiQov xutijv^x&tj. Ein von Raoul-Rochette
(Repr. d’Atlas p. 40 not. 1) neu hervorgehobenes,
bisher aber keineswegs unbekannt gebliebenes Zeug-
nifs (Siebelis zu Paus. I, 25, 2 „opus notissi-
muin e Plutarcho”); so wenig, dafs Leake es,