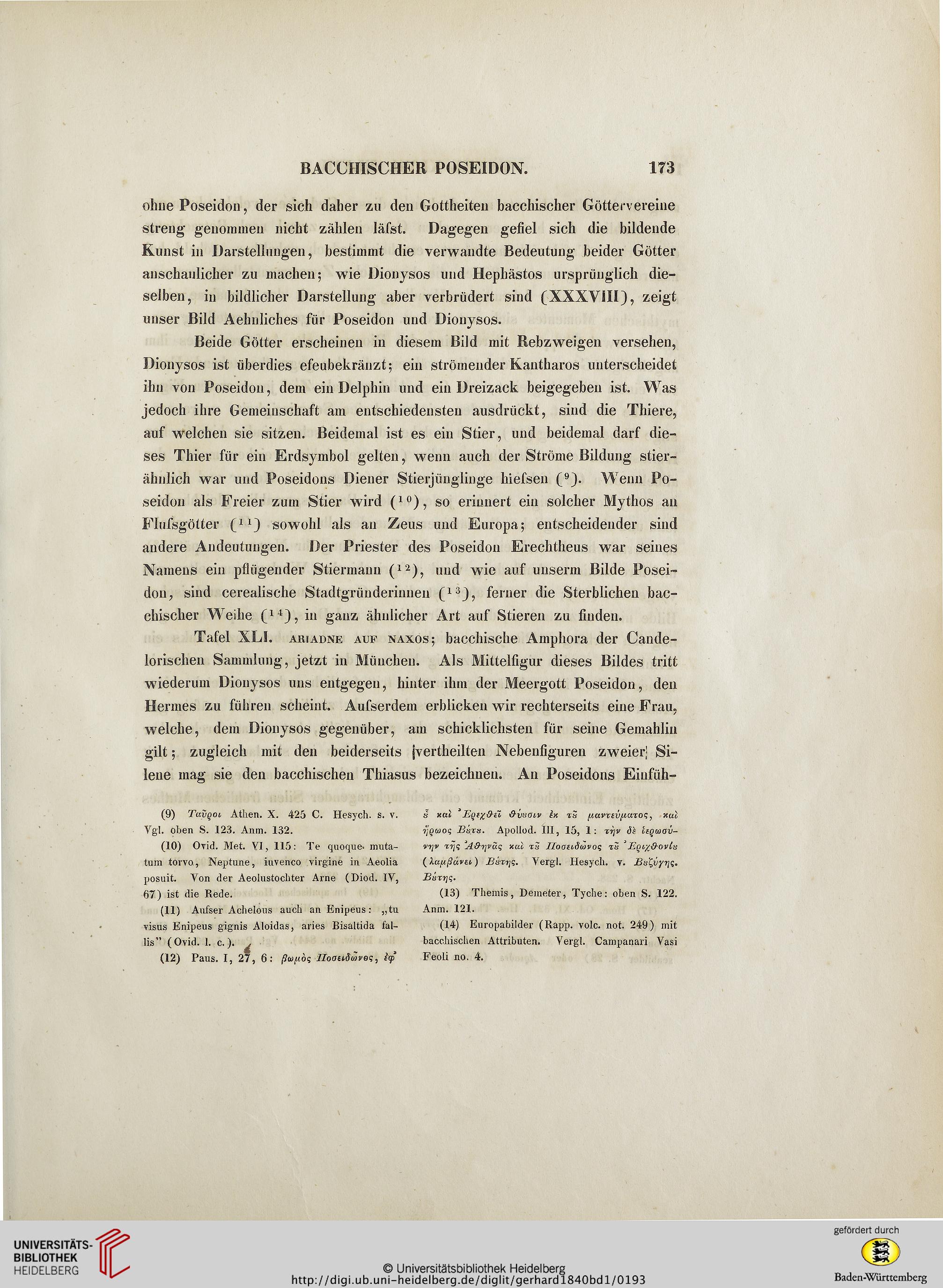BACCHISCHER POSEIDON.
173
ohne Poseidon, der sich daher zu den Gottheiten bacchischer Göttervereine
streng genommen nicht zählen läfst. Dagegen gefiel sich die bildende
Kunst in Darstellungen, bestimmt die verwandte Bedeutung beider Götter
anschaulicher zu machen; wie Dionysos und Hephästos ursprünglich die-
selben, in bildlicher Darstellung aber verbrüdert sind (XXXVIII), zeigt
unser Bild Aehnliches für Poseidon und Dionysos.
Beide Götter erscheinen in diesem Bild mit Rebzweigen versehen,
Dionysos ist überdies efeubekränzt; ein strömender Kantharos unterscheidet
ihn von Poseidon, dem ein Delphin und ein Dreizack beigegeben ist. Was
jedoch ihre Gemeinschaft am entschiedensten ausdrückt, sind die Thiere,
auf welchen sie sitzen. Beidemal ist es ein Stier, und beidemal darf die-
ses Thier für ein Erdsymbol gelten, wenn auch der Ströme Bildung stier-
ähnlich war und Poseidons Diener Stierjünglinge hiefsen (9). Wenn Po-
seidon als Freier zum Stier wird (10), so erinnert ein solcher Mythos an
Flufsgötter f11) sowohl als an Zeus und Europa; entscheidender sind
andere Andeutungen. Der Priester des Poseidon Erechtheus war seines
Namens ein pflügender Stiermann (12), und wie auf unserm Bilde Posei-
don, sind cerealische Stadtgründerinnen (13), ferner die Sterblichen bac-
chischer Weihe (14), in ganz ähnlicher Art auf Stieren zu finden.
Tafel XLI. ariadne auf naxos; baccliische Amphora der Cande-
lorischen Sammlung, jetzt in München. Als Mittelfigur dieses Bildes tritt
wiederum Dionysos uns entgegen, hinter ihm der Meergott Poseidon, den
Hermes zu führen scheint. Aufserdem erblicken wir rechterseits eine Frau,
welche, dem Dionysos gegenüber, am schicklichsten für seine Gemahlin
gilt; zugleich mit den beiderseits jvertheilten Nebenfiguren zweier,' Si-
lene mag sie den bacchischen Thiasus bezeichnen. An Poseidons Eiufüh—
(9) Tuvqol Athen. X. 425 C. Hesych. s. v.
Vgl. oben S. 123. Anm. 132.
(10) Ovid. Met. VI, 115: Te quoque« muta-
tum torvo, Neptune, iuvenco virgine in Aeolia
posuit. Von der Aeolustochter Arne (Diod. IV,
67) ist die Rede.
(11) Aufser Achelous auch an Enipeus : „tu
visus Enipeus gignis Aloidas, aries Bisaltida fal-
lis” (Ovid. 1. c.). ^
(12) Paus. I, 27, 6: ßu>fAo<; HoaeiÖMvei;, ixp
s xal Eqix&ü &vnoiv Ix %5 /.iavTev[.tUT;ot;, xul
rtQu)oc, Apollod. III, 15, 1: rrjv öh leQuaii-
vijv A&t]ruq xul t5 Uooti,öu)voq tS Eqo/&ov(a
(Xupßuvet,) B3Tr[<;. Vergl. Hesych. v. Bn^vyt]<;.
Btriri<;.
(13) Themis, Demeter, Tyche: oben S. 122.
Anm. 121.
(14) Europabilder (Rapp. volc. not. 249) mit
bacchischen Attributen. Vergl. Campanari Vasi
Feoli no. 4.
173
ohne Poseidon, der sich daher zu den Gottheiten bacchischer Göttervereine
streng genommen nicht zählen läfst. Dagegen gefiel sich die bildende
Kunst in Darstellungen, bestimmt die verwandte Bedeutung beider Götter
anschaulicher zu machen; wie Dionysos und Hephästos ursprünglich die-
selben, in bildlicher Darstellung aber verbrüdert sind (XXXVIII), zeigt
unser Bild Aehnliches für Poseidon und Dionysos.
Beide Götter erscheinen in diesem Bild mit Rebzweigen versehen,
Dionysos ist überdies efeubekränzt; ein strömender Kantharos unterscheidet
ihn von Poseidon, dem ein Delphin und ein Dreizack beigegeben ist. Was
jedoch ihre Gemeinschaft am entschiedensten ausdrückt, sind die Thiere,
auf welchen sie sitzen. Beidemal ist es ein Stier, und beidemal darf die-
ses Thier für ein Erdsymbol gelten, wenn auch der Ströme Bildung stier-
ähnlich war und Poseidons Diener Stierjünglinge hiefsen (9). Wenn Po-
seidon als Freier zum Stier wird (10), so erinnert ein solcher Mythos an
Flufsgötter f11) sowohl als an Zeus und Europa; entscheidender sind
andere Andeutungen. Der Priester des Poseidon Erechtheus war seines
Namens ein pflügender Stiermann (12), und wie auf unserm Bilde Posei-
don, sind cerealische Stadtgründerinnen (13), ferner die Sterblichen bac-
chischer Weihe (14), in ganz ähnlicher Art auf Stieren zu finden.
Tafel XLI. ariadne auf naxos; baccliische Amphora der Cande-
lorischen Sammlung, jetzt in München. Als Mittelfigur dieses Bildes tritt
wiederum Dionysos uns entgegen, hinter ihm der Meergott Poseidon, den
Hermes zu führen scheint. Aufserdem erblicken wir rechterseits eine Frau,
welche, dem Dionysos gegenüber, am schicklichsten für seine Gemahlin
gilt; zugleich mit den beiderseits jvertheilten Nebenfiguren zweier,' Si-
lene mag sie den bacchischen Thiasus bezeichnen. An Poseidons Eiufüh—
(9) Tuvqol Athen. X. 425 C. Hesych. s. v.
Vgl. oben S. 123. Anm. 132.
(10) Ovid. Met. VI, 115: Te quoque« muta-
tum torvo, Neptune, iuvenco virgine in Aeolia
posuit. Von der Aeolustochter Arne (Diod. IV,
67) ist die Rede.
(11) Aufser Achelous auch an Enipeus : „tu
visus Enipeus gignis Aloidas, aries Bisaltida fal-
lis” (Ovid. 1. c.). ^
(12) Paus. I, 27, 6: ßu>fAo<; HoaeiÖMvei;, ixp
s xal Eqix&ü &vnoiv Ix %5 /.iavTev[.tUT;ot;, xul
rtQu)oc, Apollod. III, 15, 1: rrjv öh leQuaii-
vijv A&t]ruq xul t5 Uooti,öu)voq tS Eqo/&ov(a
(Xupßuvet,) B3Tr[<;. Vergl. Hesych. v. Bn^vyt]<;.
Btriri<;.
(13) Themis, Demeter, Tyche: oben S. 122.
Anm. 121.
(14) Europabilder (Rapp. volc. not. 249) mit
bacchischen Attributen. Vergl. Campanari Vasi
Feoli no. 4.