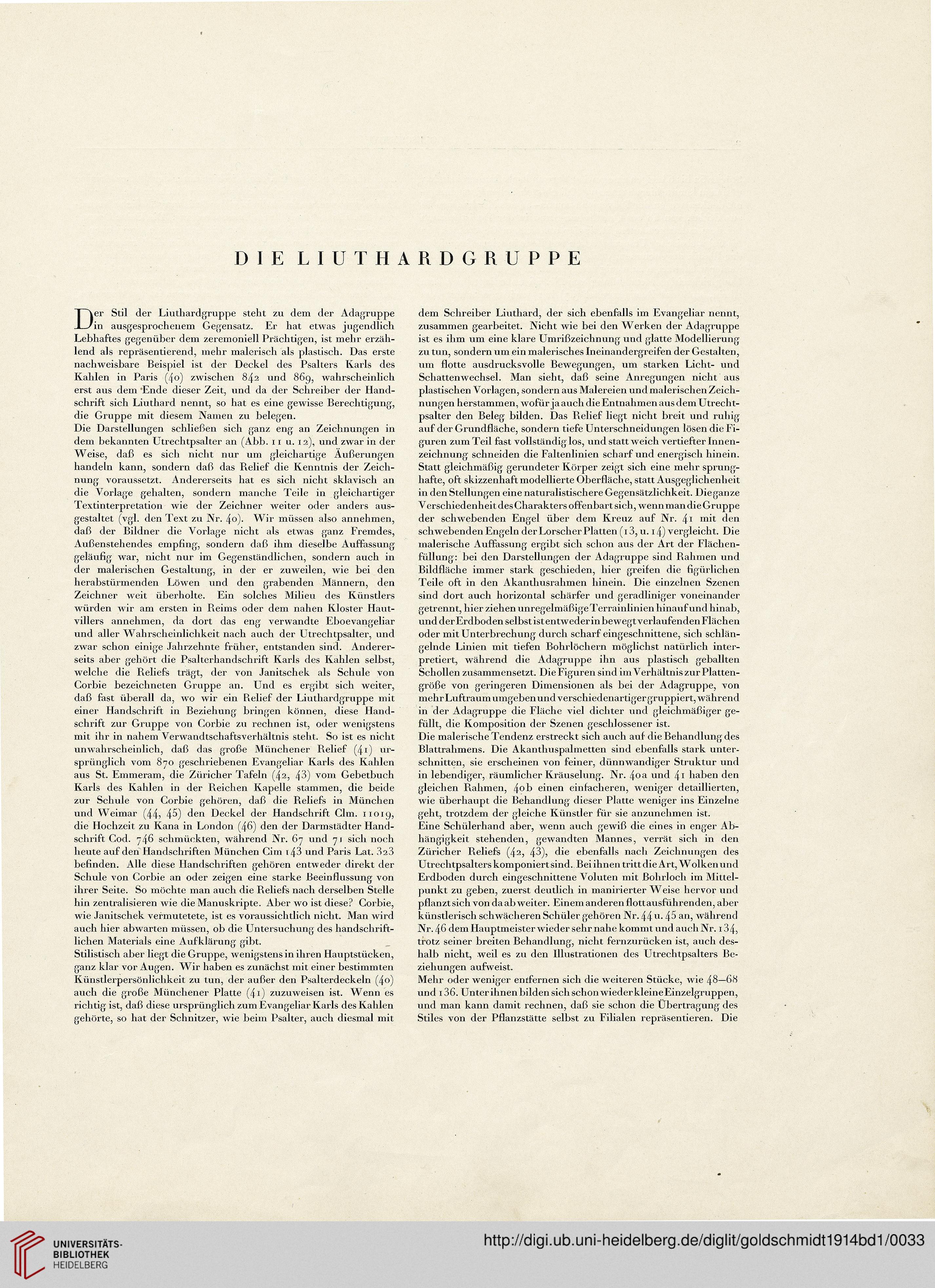DIE L1UTHARDGRUPPE
Der Stil der Liuthardgruppe steht zu dem der Adagruppe
in ausgesprochenem Gegensatz. Er hat etwas jugendlich
Lebhaftes gegenüber dem zeremoniell Prächtigen, ist mehr erzäh-
lend als repräsentierend, mehr malerisch als plastisch. Das erste
nachweisbare Beispiel ist der Deckel des Psalters Karls des
Kahlen in Paris (4o) zwischen 842 und 869, wahrscheinlich
erst aus dem Ende dieser Zeit, und da der Schreiber der Hand-
schrift sich Liuthard nennt, so hat es eine gewisse Berechtigung,
die Gruppe mit diesem Namen zu belegen.
Die Darstellungen schließen sich ganz eng an Zeichnungen in
dem bekannten Utrechtpsalter an (Abb. 11 u. 12), und zwar in der
Weise, daß es sich nicht nur um gleichartige Äußerungen
handeln kann, sondern daß das Belief die Kenntnis der Zeich-
nung voraussetzt. Andererseits hat es sich nicht sklavisch an
die Vorlage gehalten, sondern manche Teile in gleichartiger
Textinterpretation wie der Zeichner weiter oder anders aus-
gestaltet (vgl. den Text zu Nr. 4o). Wir müssen also annehmen,
daß der Bildner die Vorlage nicht als etwas ganz Fremdes,
Außenstehendes empfing, sondern daß ihm dieselbe Auffassung
geläufig war, nicht nur im Gegenständlichen, sondern auch in
der malerischen Gestaltung, in der er zuweilen, wie bei den
herabstürmenden Löwen und den grabenden Männern, den
Zeichner weit überholte. Ein solches Milieu des Künstlers
würden wir am ersten in Keims oder dem nahen Kloster Haut-
villers annehmen, da dort das eng verwandte Eboevangeliar
und aller Wahrscheinlichkeit nach auch der Utrechtpsalter, und
zwar schon einige Jahrzehnte früher, entstanden sind. Anderer-
seits aber gehört die Psalterhandschrift Karls des Kahlen selbst,
welche die Beliefs trägt, der von Janitschek als Schnle von
Corbie bezeichneten Gruppe an. Und es ergibt sich weiter,
daß fast überall da, wo wir ein Relief der Liuthardgruppe mit
einer Handschrift in Beziehung bringen können, diese Hand-
schrift zur Gruppe von Corbie zu rechnen ist, oder wenigstens
mit ihr in nahem Verwandtschaftsverhältnis steht. So ist es nicht
unwahrscheinlich, daß das große Münchener Relief (4i) ur-
sprünglich vom 870 geschriebenen Evangeliar Karls des Kahlen
aus St. Emmeram, die Züricher Tafeln (42, 43) vom Gebetbuch
Karls des Kahlen in der Reichen Kapelle stammen, die beide
zur Schule von Corbie gehören, daß die Beliefs in München
und Weimar (44, 4^) den Deckel der Handschrift Clm. 11019,
die Hochzeit zu Kana in London (46) den der Darmstädter Hand-
schrift Cod. y46 schmückten, während Nr. 67 und 71 sich noch
heute auf den Handschriften München Cim 143 und Paris Lat. 323
befinden. Alle diese Handschriften gehören entweder direkt der
Schule von Corbie an oder zeigen eine starke Beeinflussung von
ihrer Seite. So möchte man auch die Beliefs nach derselben Stelle
hin zentralisieren wie die Manuskripte. Aber wo ist diese? Corbie,
wie Janitschek vermutetete, ist es voraussichtlich nicht. Man wird
auch hier abwarten müssen, ob die Untersuchung des handschrift-
lichen Materials eine Aufklärung gibt.
Stilistisch aber liegt die Gruppe, wenigstens in ihren Hauptstücken,
ganz klar vor Augen. Wir haben es zunächst mit einer bestimmten
Künstlerpersönlichkeit zu tun, der außer den Psalterdeckeln (4o)
auch die große Münchener Platte (4.1) zuzuweisen ist. Wenn es
richtig ist, daß diese ursprünglich zum Evangeliar Karls des Kahlen
gehörte, so hat der Schnitzer, wie beim Psalter, auch diesmal mit
dem Schreiber Liuthard, der sich ebenfalls im Evangeliar nennt,
zusammen gearbeitet. Nicht wie bei den Werken der Adagruppe
ist es ihm um eine klare Umrißzeichnung und glatte Modellierung
zu tun, sondern um ein malerisches Ineinandergreifen der Gestalten,
um flotte ausdrucksvolle Bewegungen, um starken Licht- und
Schattenwechsel. Alan sieht, daß seine Anregungen nicht aus
plastischen Vorlagen, sondern aus Malereien und malerischen Zeich-
nungen herstammen, wofür ja auch die Entnahmen aus dem Utrecht-
psalter den Beleg bilden. Das Relief liegt nicht breit und ruhig
auf der Grundfläche, sondern tiefe Unterschneidungen lösen die Fi-
guren zum Teil fast vollständig los, und statt weich vertiefter Innen-
zeichnung schneiden die Faltenlinien scharf und energisch hinein.
Statt gleichmäßig gerundeter Körper zeigt sich eine mehr sprung-
hafte, oft skizzenhaft modellierte Oberfläche, statt Ausgeglichenheit
in den Stellungen eine naturalistischere Gegensätzlichkeit. Dieganze
Verschiedenheit des Charakters offenbart sich, wenn man die Gruppe
der schwebenden Engel über dem Kreuz auf Nr. 41 init den
schwebenden Engeln der Lorscher Platten (13, u. 14) vergleicht. Die
malerische Auffassung ergibt sich schon aus der Art der Flächen-
füllung: bei den Darstellungen der Adagruppe sind Bahmen und
Bildfläche immer stark geschieden, hier greifen die figürlichen
Teile oft in den Akanthusrahmen hinein. Die einzelnen Szenen
sind dort auch horizontal schärfer und geradliniger voneinander
getrennt, hier ziehen unregelmäßige Terrainlinien hinauf und hinab,
und der Erdboden selbst ist entweder in beweg t verlaufenden Flächen
oder mit Unterbrechung durch scharf eingeschnittene, sich schlän-
gelnde Linien mit tiefen Bohrlöchern möglichst natürlich inter-
pretiert, während die Adagruppe ihn aus plastisch geballten
Schollen zusammensetzt. Die Figuren sind im Verhältnis zur Platten-
größe von geringeren Dimensionen als bei der Adagruppe, von
mehr Luftraum umgeben und verschiedenartiger gruppiert, während
in der Adagruppe die Fläche viel dichter und gleichmäßiger ge-
füllt, die Komposition der Szenen geschlossener ist.
Die malerische Tendenz erstreckt sich auch auf die Behandlung des
Blattrahmens. Die Akanthuspalmetten sind ebenfalls stark unter-
schnitten, sie erscheinen von feiner, dünnwandiger Struktur und
in lebendiger, räumlicher Kräuselung. Nr. 4oa und /[ i haben den
gleichen Rahmen, 4°b einen einfacheren, weniger detaillierten,
wie überhaupt die Behandlung dieser Platte weniger ins Einzelne
geht, trotzdem der gleiche Künstler für sie anzunehmen ist.
Eine Schülerhand aber, wenn auch gewiß die eines in enger Ab-
hängigkeit stehenden, gewandten Alannes, verrät sich in den
Züricher Beliefs (42, 43), die ebenfalls nach Zeichnungen des
Utrechtpsalters komponiert sind. Bei ihnen tritt die Art, Wolken und
Erdboden durch eingeschnittene Voluten mit Bohrloch im Mittel-
punkt zu geben, zuerst deutlich in manirierter Weise hervor und
pflanzt sich von da ab weiter. Einem anderen flott ausführenden, aber
künstlerisch schwächeren Schüler gehören Nr. 44 u- 4^ an, während
Nr. 46 dem Hauptmeister wieder sehr nahe kommt und auch Nr. 134,
trotz seiner breiten Behandlung, nicht fernzurücken ist, auch des-
halb nicht, weil es zu den Illustrationen des Utrechtpsalters Be-
ziehungen aufweist.
Mehr oder weniger entfernen sich die weiteren Stücke, wie 48—68
und 136. Unter ihnen bilden sich schon wieder kleineEinzelgruppen,
und man kann damit rechnen, daß sie schon die Übertragung des
Stiles von der Pflanzstätte selbst zu Filialen repräsentieren. Die
Der Stil der Liuthardgruppe steht zu dem der Adagruppe
in ausgesprochenem Gegensatz. Er hat etwas jugendlich
Lebhaftes gegenüber dem zeremoniell Prächtigen, ist mehr erzäh-
lend als repräsentierend, mehr malerisch als plastisch. Das erste
nachweisbare Beispiel ist der Deckel des Psalters Karls des
Kahlen in Paris (4o) zwischen 842 und 869, wahrscheinlich
erst aus dem Ende dieser Zeit, und da der Schreiber der Hand-
schrift sich Liuthard nennt, so hat es eine gewisse Berechtigung,
die Gruppe mit diesem Namen zu belegen.
Die Darstellungen schließen sich ganz eng an Zeichnungen in
dem bekannten Utrechtpsalter an (Abb. 11 u. 12), und zwar in der
Weise, daß es sich nicht nur um gleichartige Äußerungen
handeln kann, sondern daß das Belief die Kenntnis der Zeich-
nung voraussetzt. Andererseits hat es sich nicht sklavisch an
die Vorlage gehalten, sondern manche Teile in gleichartiger
Textinterpretation wie der Zeichner weiter oder anders aus-
gestaltet (vgl. den Text zu Nr. 4o). Wir müssen also annehmen,
daß der Bildner die Vorlage nicht als etwas ganz Fremdes,
Außenstehendes empfing, sondern daß ihm dieselbe Auffassung
geläufig war, nicht nur im Gegenständlichen, sondern auch in
der malerischen Gestaltung, in der er zuweilen, wie bei den
herabstürmenden Löwen und den grabenden Männern, den
Zeichner weit überholte. Ein solches Milieu des Künstlers
würden wir am ersten in Keims oder dem nahen Kloster Haut-
villers annehmen, da dort das eng verwandte Eboevangeliar
und aller Wahrscheinlichkeit nach auch der Utrechtpsalter, und
zwar schon einige Jahrzehnte früher, entstanden sind. Anderer-
seits aber gehört die Psalterhandschrift Karls des Kahlen selbst,
welche die Beliefs trägt, der von Janitschek als Schnle von
Corbie bezeichneten Gruppe an. Und es ergibt sich weiter,
daß fast überall da, wo wir ein Relief der Liuthardgruppe mit
einer Handschrift in Beziehung bringen können, diese Hand-
schrift zur Gruppe von Corbie zu rechnen ist, oder wenigstens
mit ihr in nahem Verwandtschaftsverhältnis steht. So ist es nicht
unwahrscheinlich, daß das große Münchener Relief (4i) ur-
sprünglich vom 870 geschriebenen Evangeliar Karls des Kahlen
aus St. Emmeram, die Züricher Tafeln (42, 43) vom Gebetbuch
Karls des Kahlen in der Reichen Kapelle stammen, die beide
zur Schule von Corbie gehören, daß die Beliefs in München
und Weimar (44, 4^) den Deckel der Handschrift Clm. 11019,
die Hochzeit zu Kana in London (46) den der Darmstädter Hand-
schrift Cod. y46 schmückten, während Nr. 67 und 71 sich noch
heute auf den Handschriften München Cim 143 und Paris Lat. 323
befinden. Alle diese Handschriften gehören entweder direkt der
Schule von Corbie an oder zeigen eine starke Beeinflussung von
ihrer Seite. So möchte man auch die Beliefs nach derselben Stelle
hin zentralisieren wie die Manuskripte. Aber wo ist diese? Corbie,
wie Janitschek vermutetete, ist es voraussichtlich nicht. Man wird
auch hier abwarten müssen, ob die Untersuchung des handschrift-
lichen Materials eine Aufklärung gibt.
Stilistisch aber liegt die Gruppe, wenigstens in ihren Hauptstücken,
ganz klar vor Augen. Wir haben es zunächst mit einer bestimmten
Künstlerpersönlichkeit zu tun, der außer den Psalterdeckeln (4o)
auch die große Münchener Platte (4.1) zuzuweisen ist. Wenn es
richtig ist, daß diese ursprünglich zum Evangeliar Karls des Kahlen
gehörte, so hat der Schnitzer, wie beim Psalter, auch diesmal mit
dem Schreiber Liuthard, der sich ebenfalls im Evangeliar nennt,
zusammen gearbeitet. Nicht wie bei den Werken der Adagruppe
ist es ihm um eine klare Umrißzeichnung und glatte Modellierung
zu tun, sondern um ein malerisches Ineinandergreifen der Gestalten,
um flotte ausdrucksvolle Bewegungen, um starken Licht- und
Schattenwechsel. Alan sieht, daß seine Anregungen nicht aus
plastischen Vorlagen, sondern aus Malereien und malerischen Zeich-
nungen herstammen, wofür ja auch die Entnahmen aus dem Utrecht-
psalter den Beleg bilden. Das Relief liegt nicht breit und ruhig
auf der Grundfläche, sondern tiefe Unterschneidungen lösen die Fi-
guren zum Teil fast vollständig los, und statt weich vertiefter Innen-
zeichnung schneiden die Faltenlinien scharf und energisch hinein.
Statt gleichmäßig gerundeter Körper zeigt sich eine mehr sprung-
hafte, oft skizzenhaft modellierte Oberfläche, statt Ausgeglichenheit
in den Stellungen eine naturalistischere Gegensätzlichkeit. Dieganze
Verschiedenheit des Charakters offenbart sich, wenn man die Gruppe
der schwebenden Engel über dem Kreuz auf Nr. 41 init den
schwebenden Engeln der Lorscher Platten (13, u. 14) vergleicht. Die
malerische Auffassung ergibt sich schon aus der Art der Flächen-
füllung: bei den Darstellungen der Adagruppe sind Bahmen und
Bildfläche immer stark geschieden, hier greifen die figürlichen
Teile oft in den Akanthusrahmen hinein. Die einzelnen Szenen
sind dort auch horizontal schärfer und geradliniger voneinander
getrennt, hier ziehen unregelmäßige Terrainlinien hinauf und hinab,
und der Erdboden selbst ist entweder in beweg t verlaufenden Flächen
oder mit Unterbrechung durch scharf eingeschnittene, sich schlän-
gelnde Linien mit tiefen Bohrlöchern möglichst natürlich inter-
pretiert, während die Adagruppe ihn aus plastisch geballten
Schollen zusammensetzt. Die Figuren sind im Verhältnis zur Platten-
größe von geringeren Dimensionen als bei der Adagruppe, von
mehr Luftraum umgeben und verschiedenartiger gruppiert, während
in der Adagruppe die Fläche viel dichter und gleichmäßiger ge-
füllt, die Komposition der Szenen geschlossener ist.
Die malerische Tendenz erstreckt sich auch auf die Behandlung des
Blattrahmens. Die Akanthuspalmetten sind ebenfalls stark unter-
schnitten, sie erscheinen von feiner, dünnwandiger Struktur und
in lebendiger, räumlicher Kräuselung. Nr. 4oa und /[ i haben den
gleichen Rahmen, 4°b einen einfacheren, weniger detaillierten,
wie überhaupt die Behandlung dieser Platte weniger ins Einzelne
geht, trotzdem der gleiche Künstler für sie anzunehmen ist.
Eine Schülerhand aber, wenn auch gewiß die eines in enger Ab-
hängigkeit stehenden, gewandten Alannes, verrät sich in den
Züricher Beliefs (42, 43), die ebenfalls nach Zeichnungen des
Utrechtpsalters komponiert sind. Bei ihnen tritt die Art, Wolken und
Erdboden durch eingeschnittene Voluten mit Bohrloch im Mittel-
punkt zu geben, zuerst deutlich in manirierter Weise hervor und
pflanzt sich von da ab weiter. Einem anderen flott ausführenden, aber
künstlerisch schwächeren Schüler gehören Nr. 44 u- 4^ an, während
Nr. 46 dem Hauptmeister wieder sehr nahe kommt und auch Nr. 134,
trotz seiner breiten Behandlung, nicht fernzurücken ist, auch des-
halb nicht, weil es zu den Illustrationen des Utrechtpsalters Be-
ziehungen aufweist.
Mehr oder weniger entfernen sich die weiteren Stücke, wie 48—68
und 136. Unter ihnen bilden sich schon wieder kleineEinzelgruppen,
und man kann damit rechnen, daß sie schon die Übertragung des
Stiles von der Pflanzstätte selbst zu Filialen repräsentieren. Die