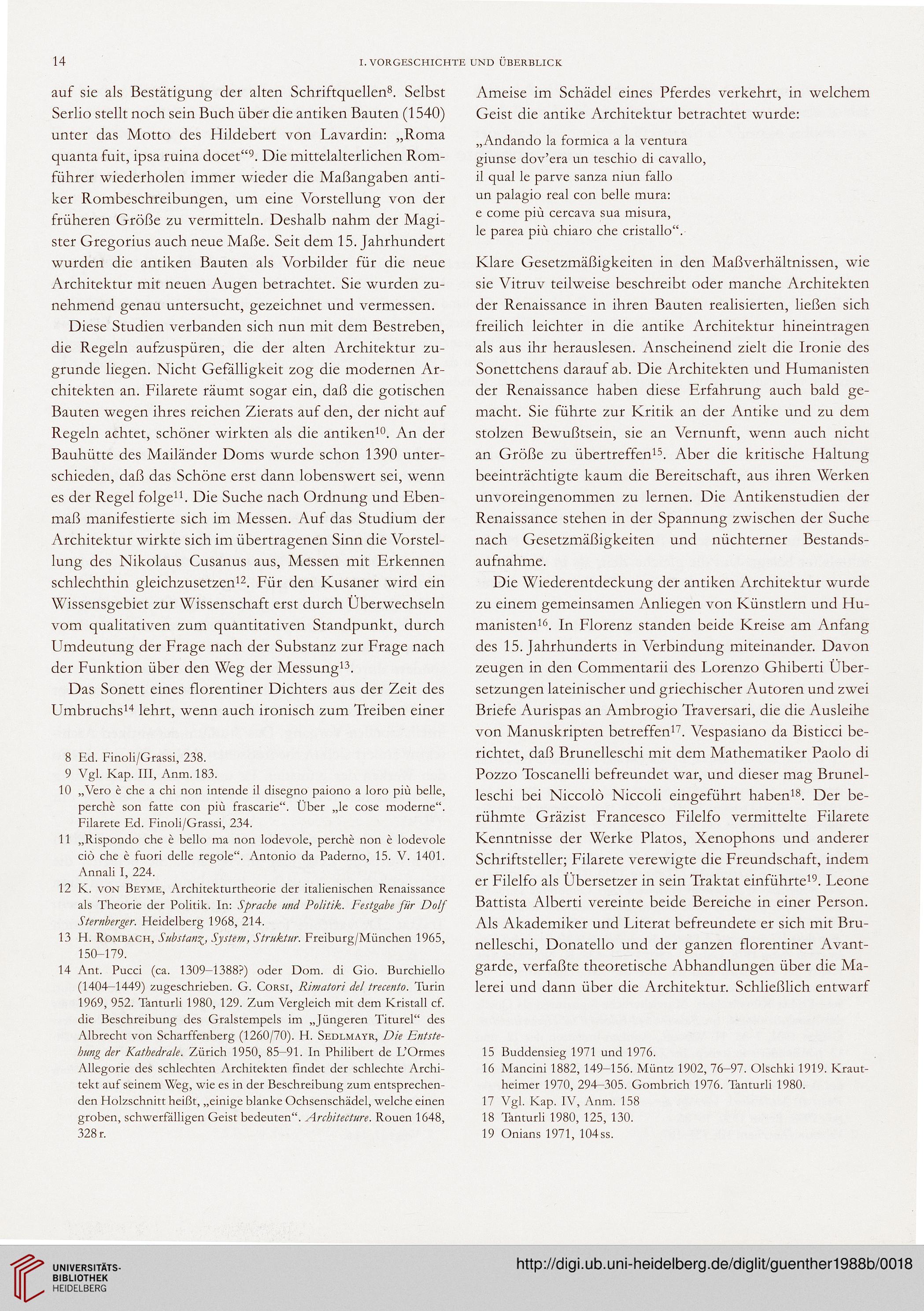14
i. vorgeschichte und überblick
auf sie als Bestätigung der alten Schriftquellen8. Selbst
Serlio stellt noch sein Buch über die antiken Bauten (1540)
unter das Motto des Hildebert von Lavardin: „Roma
quanta fuit, ipsa ruina docet"9. Die mittelalterlichen Rom-
führer wiederholen immer wieder die Maßangaben anti-
ker Rombeschreibungen, um eine Vorstellung von der
früheren Größe zu vermitteln. Deshalb nahm der Magi-
ster Gregorius auch neue Maße. Seit dem 15. Jahrhundert
wurden die antiken Bauten als Vorbilder für die neue
Architektur mit neuen Augen betrachtet. Sie wurden zu-
nehmend genau untersucht, gezeichnet und vermessen.
Diese Studien verbanden sich nun mit dem Bestreben,
die Regeln aufzuspüren, die der alten Architektur zu-
grunde liegen. Nicht Gefälligkeit zog die modernen Ar-
chitekten an. Filarete räumt sogar ein, daß die gotischen
Bauten wegen ihres reichen Zierats auf den, der nicht auf
Regeln achtet, schöner wirkten als die antiken10. An der
Bauhütte des Mailänder Doms wurde schon 1390 unter-
schieden, daß das Schöne erst dann lobenswert sei, wenn
es der Regel folge11. Die Suche nach Ordnung und Eben-
maß manifestierte sich im Messen. Auf das Studium der
Architektur wirkte sich im übertragenen Sinn die Vorstel-
lung des Nikolaus Cusanus aus, Messen mit Erkennen
schlechthin gleichzusetzen12. Für den Kusaner wird ein
Wissensgebiet zur Wissenschaft erst durch Überwechseln
vom qualitativen zum quantitativen Standpunkt, durch
Umdeutung der Frage nach der Substanz zur Frage nach
der Funktion über den Weg der Messung13.
Das Sonett eines florentiner Dichters aus der Zeit des
Umbruchs14 lehrt, wenn auch ironisch zum Treiben einer
8 Ed. Finoli/Grassi, 238.
9 Vgl. Kap. III, Anm.183.
10 „Vero e che a chi non intende il disegno paiono a loro piü belle,
perche son fatte con piü frascarie". Über „le cose moderne".
Filarete Ed. Finoli/Grassi, 234.
11 „Rispondo che e bello ma non lodevole, perche non e lodevole
ciö che e fuori delle regole". Antonio da Paderno, 15. V. 1401.
Annali I, 224.
12 K. von Beyme, Architekturtheorie der italienischen Renaissance
als Theorie der Politik. In: Sprache und Politik. Festgabe für Dolf
Sternberger. Heidelberg 1968, 214.
13 H. Rombach, Substan^, System, Struktur. Freiburg/München 1965,
150-179.
14 Ant. Pucci (ca. 1309-1388?) oder Dom. di Gio. Burchiello
(1404-1449) zugeschrieben. G. Corsi, Rimatori del trecento. Turin
1969, 952. Tanturli 1980, 129. Zum Vergleich mit dem Kristall cf.
die Beschreibung des Gralstempels im „jüngeren Titurel" des
Albrecht von Scharffenberg (1260/70). H. Sedlmayr, Die Entste-
hung der Kathedrale. Zürich 1950, 85-91. In Philibert de L'Ormes
Allegorie des schlechten Architekten findet der schlechte Archi-
tekt auf seinem Weg, wie es in der Beschreibung zum entsprechen-
den Holzschnitt heißt, „einige blanke Ochsenschädel, welche einen
groben, schwerfalligen Geist bedeuten". Architecture. Rouen 1648,
328 r.
Ameise im Schädel eines Pferdes verkehrt, in welchem
Geist die antike Architektur betrachtet wurde:
„Andando la formica a la Ventura
giunse dov'era un teschio di cavallo,
il qual le parve sanza niun fallo
un palagio real con belle mura:
e come piü cercava sua misura,
le parea piü chiaro che cristallo".
Klare Gesetzmäßigkeiten in den Maßverhältnissen, wie
sie Vitruv teilweise beschreibt oder manche Architekten
der Renaissance in ihren Bauten realisierten, ließen sich
freilich leichter in die antike Architektur hineintragen
als aus ihr herauslesen. Anscheinend zielt die Ironie des
Sonettchens darauf ab. Die Architekten und Humanisten
der Renaissance haben diese Erfahrung auch bald ge-
macht. Sie führte zur Kritik an der Antike und zu dem
stolzen Bewußtsein, sie an Vernunft, wenn auch nicht
an Größe zu übertreffen15. Aber die kritische Haltung
beeinträchtigte kaum die Bereitschaft, aus ihren Werken
unvoreingenommen zu lernen. Die Antikenstudien der
Renaissance stehen in der Spannung zwischen der Suche
nach Gesetzmäßigkeiten und nüchterner Bestands-
aufnahme.
Die Wiederentdeckung der antiken Architektur wurde
zu einem gemeinsamen Anliegen von Künstlern und Hu-
manisten16. In Florenz standen beide Kreise am Anfang
des 15. Jahrhunderts in Verbindung miteinander. Davon
zeugen in den Commentarii des Lorenzo Ghiberti Über-
setzungen lateinischer und griechischer Autoren und zwei
Briefe Aurispas an Ambrogio Traversari, die die Ausleihe
von Manuskripten betreffen17. Vespasiano da Bisticci be-
richtet, daß Brunelleschi mit dem Mathematiker Paolo di
Pozzo Toscanelli befreundet war, und dieser mag Brunel-
leschi bei Niccolö Niccoli eingeführt haben18. Der be-
rühmte Gräzist Francesco Filelfo vermittelte Filarete
Kenntnisse der Werke Piatos, Xenophons und anderer
Schriftsteller; Filarete verewigte die Freundschaft, indem
er Filelfo als Übersetzer in sein Traktat einführte19. Leone
Battista Alberti vereinte beide Bereiche in einer Person.
Als Akademiker und Literat befreundete er sich mit Bru-
nelleschi, Donatello und der ganzen florentiner Avant-
garde, verfaßte theoretische Abhandlungen über die Ma-
lerei und dann über die Architektur. Schließlich entwarf
15 Buddensieg 1971 und 1976.
16 Mancini 1882, 149-156. Müntz 1902, 76-97. Olschki 1919. Kraut-
heimer 1970, 294-305. Gombrich 1976. Tanturli 1980.
17 Vgl. Kap. IV, Anm. 158
18 Tanturli 1980, 125, 130.
19 Onians 1971, 104ss.
i. vorgeschichte und überblick
auf sie als Bestätigung der alten Schriftquellen8. Selbst
Serlio stellt noch sein Buch über die antiken Bauten (1540)
unter das Motto des Hildebert von Lavardin: „Roma
quanta fuit, ipsa ruina docet"9. Die mittelalterlichen Rom-
führer wiederholen immer wieder die Maßangaben anti-
ker Rombeschreibungen, um eine Vorstellung von der
früheren Größe zu vermitteln. Deshalb nahm der Magi-
ster Gregorius auch neue Maße. Seit dem 15. Jahrhundert
wurden die antiken Bauten als Vorbilder für die neue
Architektur mit neuen Augen betrachtet. Sie wurden zu-
nehmend genau untersucht, gezeichnet und vermessen.
Diese Studien verbanden sich nun mit dem Bestreben,
die Regeln aufzuspüren, die der alten Architektur zu-
grunde liegen. Nicht Gefälligkeit zog die modernen Ar-
chitekten an. Filarete räumt sogar ein, daß die gotischen
Bauten wegen ihres reichen Zierats auf den, der nicht auf
Regeln achtet, schöner wirkten als die antiken10. An der
Bauhütte des Mailänder Doms wurde schon 1390 unter-
schieden, daß das Schöne erst dann lobenswert sei, wenn
es der Regel folge11. Die Suche nach Ordnung und Eben-
maß manifestierte sich im Messen. Auf das Studium der
Architektur wirkte sich im übertragenen Sinn die Vorstel-
lung des Nikolaus Cusanus aus, Messen mit Erkennen
schlechthin gleichzusetzen12. Für den Kusaner wird ein
Wissensgebiet zur Wissenschaft erst durch Überwechseln
vom qualitativen zum quantitativen Standpunkt, durch
Umdeutung der Frage nach der Substanz zur Frage nach
der Funktion über den Weg der Messung13.
Das Sonett eines florentiner Dichters aus der Zeit des
Umbruchs14 lehrt, wenn auch ironisch zum Treiben einer
8 Ed. Finoli/Grassi, 238.
9 Vgl. Kap. III, Anm.183.
10 „Vero e che a chi non intende il disegno paiono a loro piü belle,
perche son fatte con piü frascarie". Über „le cose moderne".
Filarete Ed. Finoli/Grassi, 234.
11 „Rispondo che e bello ma non lodevole, perche non e lodevole
ciö che e fuori delle regole". Antonio da Paderno, 15. V. 1401.
Annali I, 224.
12 K. von Beyme, Architekturtheorie der italienischen Renaissance
als Theorie der Politik. In: Sprache und Politik. Festgabe für Dolf
Sternberger. Heidelberg 1968, 214.
13 H. Rombach, Substan^, System, Struktur. Freiburg/München 1965,
150-179.
14 Ant. Pucci (ca. 1309-1388?) oder Dom. di Gio. Burchiello
(1404-1449) zugeschrieben. G. Corsi, Rimatori del trecento. Turin
1969, 952. Tanturli 1980, 129. Zum Vergleich mit dem Kristall cf.
die Beschreibung des Gralstempels im „jüngeren Titurel" des
Albrecht von Scharffenberg (1260/70). H. Sedlmayr, Die Entste-
hung der Kathedrale. Zürich 1950, 85-91. In Philibert de L'Ormes
Allegorie des schlechten Architekten findet der schlechte Archi-
tekt auf seinem Weg, wie es in der Beschreibung zum entsprechen-
den Holzschnitt heißt, „einige blanke Ochsenschädel, welche einen
groben, schwerfalligen Geist bedeuten". Architecture. Rouen 1648,
328 r.
Ameise im Schädel eines Pferdes verkehrt, in welchem
Geist die antike Architektur betrachtet wurde:
„Andando la formica a la Ventura
giunse dov'era un teschio di cavallo,
il qual le parve sanza niun fallo
un palagio real con belle mura:
e come piü cercava sua misura,
le parea piü chiaro che cristallo".
Klare Gesetzmäßigkeiten in den Maßverhältnissen, wie
sie Vitruv teilweise beschreibt oder manche Architekten
der Renaissance in ihren Bauten realisierten, ließen sich
freilich leichter in die antike Architektur hineintragen
als aus ihr herauslesen. Anscheinend zielt die Ironie des
Sonettchens darauf ab. Die Architekten und Humanisten
der Renaissance haben diese Erfahrung auch bald ge-
macht. Sie führte zur Kritik an der Antike und zu dem
stolzen Bewußtsein, sie an Vernunft, wenn auch nicht
an Größe zu übertreffen15. Aber die kritische Haltung
beeinträchtigte kaum die Bereitschaft, aus ihren Werken
unvoreingenommen zu lernen. Die Antikenstudien der
Renaissance stehen in der Spannung zwischen der Suche
nach Gesetzmäßigkeiten und nüchterner Bestands-
aufnahme.
Die Wiederentdeckung der antiken Architektur wurde
zu einem gemeinsamen Anliegen von Künstlern und Hu-
manisten16. In Florenz standen beide Kreise am Anfang
des 15. Jahrhunderts in Verbindung miteinander. Davon
zeugen in den Commentarii des Lorenzo Ghiberti Über-
setzungen lateinischer und griechischer Autoren und zwei
Briefe Aurispas an Ambrogio Traversari, die die Ausleihe
von Manuskripten betreffen17. Vespasiano da Bisticci be-
richtet, daß Brunelleschi mit dem Mathematiker Paolo di
Pozzo Toscanelli befreundet war, und dieser mag Brunel-
leschi bei Niccolö Niccoli eingeführt haben18. Der be-
rühmte Gräzist Francesco Filelfo vermittelte Filarete
Kenntnisse der Werke Piatos, Xenophons und anderer
Schriftsteller; Filarete verewigte die Freundschaft, indem
er Filelfo als Übersetzer in sein Traktat einführte19. Leone
Battista Alberti vereinte beide Bereiche in einer Person.
Als Akademiker und Literat befreundete er sich mit Bru-
nelleschi, Donatello und der ganzen florentiner Avant-
garde, verfaßte theoretische Abhandlungen über die Ma-
lerei und dann über die Architektur. Schließlich entwarf
15 Buddensieg 1971 und 1976.
16 Mancini 1882, 149-156. Müntz 1902, 76-97. Olschki 1919. Kraut-
heimer 1970, 294-305. Gombrich 1976. Tanturli 1980.
17 Vgl. Kap. IV, Anm. 158
18 Tanturli 1980, 125, 130.
19 Onians 1971, 104ss.