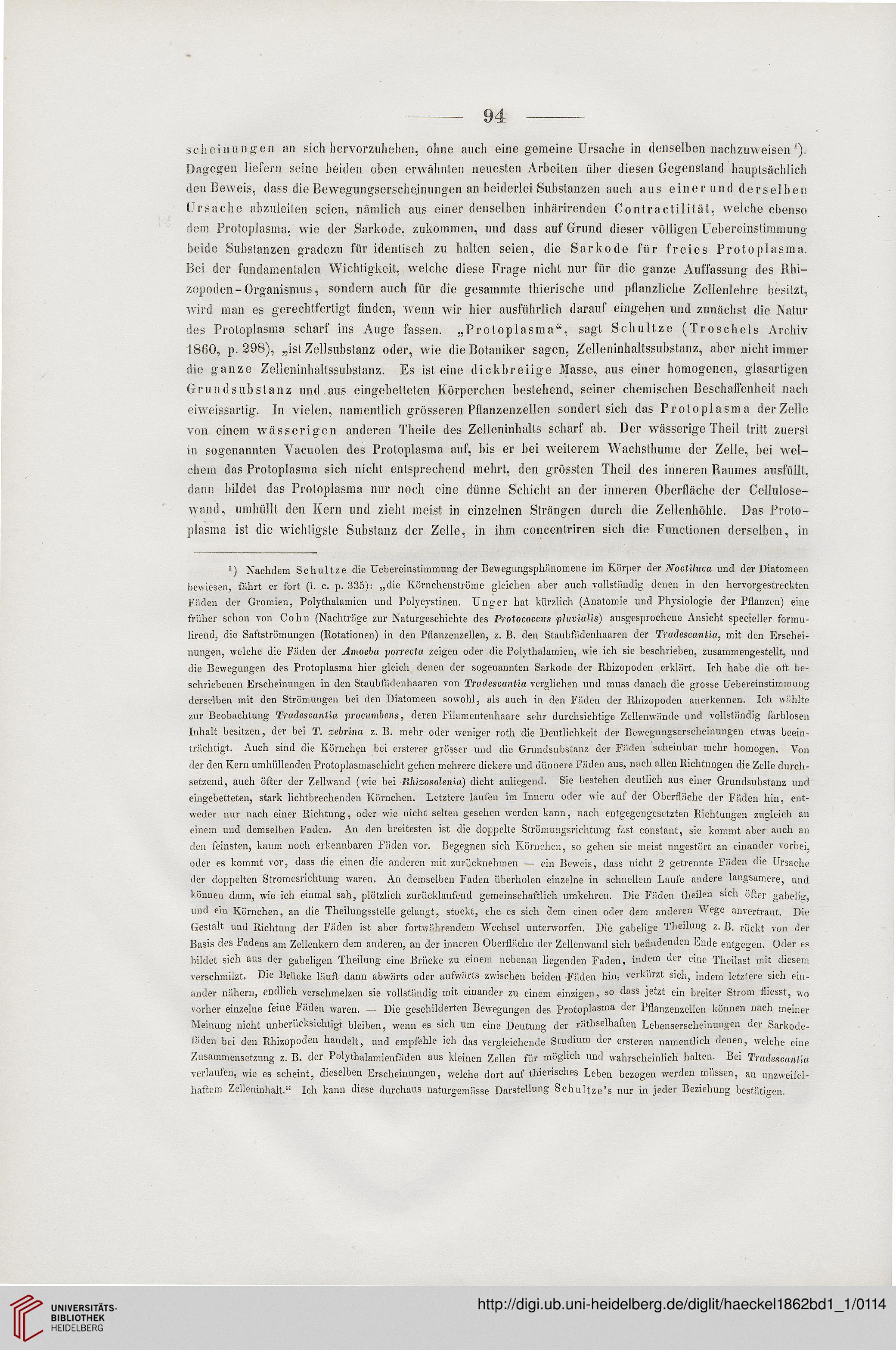94
sciieinungen an sich hervorzuheben, ohne auch eine gemeine Ursache in denselben nachzuweisen *).
Dagegen liefern seine beiden oben erwähnten neuesten Arbeiten über diesen Gegenstand hauptsächlich
den Beweis, dass die Bewegungserschejnungen an beiderlei Substanzen auch aus einerund derselben
Ursache abzuleiten seien, nämlich aus einer denselben inhärirenden Contractilität, welche ebenso
dem Protoplasma, wie der Sarkode, zukommen, und dass auf Grund dieser völligen Uebereinstimmung
beide Substanzen gradezu für identisch zu halten seien, die Sarkode für freies Protoplasma.
Bei der fundamentalen Wichtigkeit, welche diese Frage nicht nur für die ganze Auffassung des Rhi-
zopoden-Organismus, sondern auch für die gesammte thierische und pflanzliche Zellenlehre besitzt,
wird man es gerechtfertigt finden, wenn wir hier ausführlich darauf eingehen und zunächst die Natur
des Protoplasma scharf ins Auge fassen. „Protoplasma“, sagt Schultze (Troschels Archiv
1860, p. 298), „ist Zellsubstanz oder, wie die Botaniker sagen, Zelleninhaltssubstanz, aber nicht immer
die ganze Zelleninhaltssubstanz. Es ist eine dickbreiige Masse, aus einer homogenen, glasartigen
Grundsubstanz und aus eingebetteten Körperchen bestehend, seiner chemischen Beschaffenheit nach
eiweissartig. In vielen, namentlich grösseren Pflanzenzellen sondert sich das Protoplasma der Zelle
von einem wässerigen anderen Theile des Zelleninhalts scharf ah. Der wässerige Theil tritt zuerst
in sogenannten Vacuolen des Protoplasma auf, bis er hei weiterem Wachsthume der Zelle, bei wel-
chem das Protoplasma sich nicht entsprechend mehrt, den grössten Theil des inneren Raumes ausfüllt,
dann bildet das Protoplasma nur noch eine dünne Schicht an der inneren Oberfläche der Cellulose-
wand, umhüllt den Kern und zieht meist in einzelnen Strängen durch die Zellenhöhle. Das Proto-
plasma ist die wichtigste Substanz der Zelle, in ihm concentriren sich die Functionen derselben, in i)
i) Nachdem Schultze die Uebereinstimmung der Bewegungsphänomene im Körper der Nodiluca und der Diatomeen
bewiesen, fährt er fort (1. c. p. 335): „die Körnchenströme gleichen aber auch vollständig denen in den hervorgestreckten
Fäden der Gromien, Polythalamien und Polycystinen. Unger hat kürzlich (Anatomie und Physiologie der Pflanzen) eine
früher schon von Cohn (Nachträge zur Naturgeschichte des Protococcus pluvialis) ausgesprochene Ansicht specteller formu-
lirend, die Saftströmungen (Rotationen) in den Pflanzenzellen, z. B. den Staubfädenhaaren der Tradescantia, mit den Erschei-
nungen, welche die Fäden der Amoebu porrecta zeigen oder die Polythalamien, wie ich sie beschrieben, zusammengestellt, und
die Bewegungen des Protoplasma hier gleich denen der sogenannten Sarkode der Rhizopoden erklärt. Ich habe die oft be-
schriebenen Erscheinungen in den Staubfädenhaaren von Tradescantia verglichen und muss danach die grosse Uebereinstimmung
derselben mit den Strömungen bei den Diatomeen sowohl, als auch in den Fäden der Rhizopoden anerkennen. Ich wählte
zur Beobachtung Tradescantia procumbens, deren Filamentenhaare sehr durchsichtige Zellenwände und vollständig farblosen
Inhalt besitzen, der bei T. zebrina z. B. mehr oder weniger roth die Deutlichkeit der Bewegungserscheinungen etwas beein-
trächtigt. Auch sind die Körnchen bei ersterer grösser und die Grundsubstanz der Fäden scheinbar mehr homogen. Von
der den Kern umhüllenden Protoplasmaschicht gehen mehrere dickere und dünnere Fäden aus, nach allen Richtungen die Zelle durch-
setzend, auch öfter der Zellwand (wie bei Rhizosolenia) dicht anliegend. Sie bestehen deutlich aus einer Grundsubstanz und
eingebetteten, stark lichtbrechenden Körnchen. Letztere laufen im Innern oder wie auf der Oberfläche der Fäden hin, ent-
weder nur nach einer Richtung, oder wie nicht selten gesehen werden kann, nach entgegengesetzten Richtungen zugleich an
einem und demselben Faden. An den breitesten ist die doppelte Strömungsrichtung fast constant, sie kommt aber auch au
den feinsten, kaum noch erkennbaren Fäden vor. Begegnen sich Körnchen, so gehen sie meist ungestört an einander vorbei,
oder es kommt vor, dass die einen die anderen mit zurücknehmen — ein Beweis, dass nicht 2 getrennte Fäden die Ursache
der doppelten Stromesrichtung waren. An demselben Faden überholen einzelne in schnellem Laufe andere langsamere, und
können dann, wie ich einmal sah, plötzlich zurücklaufend gemeinschaftlich nmkehren. Die Fäden theilen sich öfter gabelig,
und ein Körnchen, an die Theilungsstelle gelangt, stockt, ehe es sich dem einen oder dem anderen Wege anvertraut. Die
Gestalt und Richtung der Fäden ist aber fortwährendem "Wechsel unterworfen. Die gabelige Theilung z. B. rückt von der
Basis des Fadens am Zellenkern dem anderen, an der inneren Oberfläche der Zellenwand sich befindenden Ende entgegen. Oder es
bildet sich aus der gabeligen Theilung eine Brücke zu einem nebenan liegenden Faden, indem der eine Theilast mit diesem
verschmilzt. Die Brücke läuft dann abwärts oder aufwärts zwischen beiden 'Fäden hin, verkürzt sich, indem letztere sich ein-
ander nähern, endlich verschmelzen sie vollständig mit einander zu einem einzigen, so dass jetzt ein breiter Strom fliesst, wo
vorher einzelne feine Fäden waren. — Die geschilderten Bewegungen des Protoplasma der Pflanzenzellen können nach meiner
Meinung nicht unberücksichtigt bleiben, wenn es sich um eine Deutung der räthselhaften Lebenserscheinungen der Sarkode-
fädeu bei den Rhizopoden handelt, und empfehle ich das vergleichende Studium der ersteren namentlich denen, welche eine
Zusammensetzung z. B. der Polythalamienfäden aus kleinen Zellen für möglich und wahrscheinlich halten. Bei Tradescantia
verlaufen, wie es scheint, dieselben Erscheinungen, welche dort auf thierisches Leben bezogen werden müssen, an unzweifel-
haftem Zelleninhalt.“ Ich kann diese durchaus naturgemässe Darstellung Schultze’s nur in jeder Beziehung bestätigen.
sciieinungen an sich hervorzuheben, ohne auch eine gemeine Ursache in denselben nachzuweisen *).
Dagegen liefern seine beiden oben erwähnten neuesten Arbeiten über diesen Gegenstand hauptsächlich
den Beweis, dass die Bewegungserschejnungen an beiderlei Substanzen auch aus einerund derselben
Ursache abzuleiten seien, nämlich aus einer denselben inhärirenden Contractilität, welche ebenso
dem Protoplasma, wie der Sarkode, zukommen, und dass auf Grund dieser völligen Uebereinstimmung
beide Substanzen gradezu für identisch zu halten seien, die Sarkode für freies Protoplasma.
Bei der fundamentalen Wichtigkeit, welche diese Frage nicht nur für die ganze Auffassung des Rhi-
zopoden-Organismus, sondern auch für die gesammte thierische und pflanzliche Zellenlehre besitzt,
wird man es gerechtfertigt finden, wenn wir hier ausführlich darauf eingehen und zunächst die Natur
des Protoplasma scharf ins Auge fassen. „Protoplasma“, sagt Schultze (Troschels Archiv
1860, p. 298), „ist Zellsubstanz oder, wie die Botaniker sagen, Zelleninhaltssubstanz, aber nicht immer
die ganze Zelleninhaltssubstanz. Es ist eine dickbreiige Masse, aus einer homogenen, glasartigen
Grundsubstanz und aus eingebetteten Körperchen bestehend, seiner chemischen Beschaffenheit nach
eiweissartig. In vielen, namentlich grösseren Pflanzenzellen sondert sich das Protoplasma der Zelle
von einem wässerigen anderen Theile des Zelleninhalts scharf ah. Der wässerige Theil tritt zuerst
in sogenannten Vacuolen des Protoplasma auf, bis er hei weiterem Wachsthume der Zelle, bei wel-
chem das Protoplasma sich nicht entsprechend mehrt, den grössten Theil des inneren Raumes ausfüllt,
dann bildet das Protoplasma nur noch eine dünne Schicht an der inneren Oberfläche der Cellulose-
wand, umhüllt den Kern und zieht meist in einzelnen Strängen durch die Zellenhöhle. Das Proto-
plasma ist die wichtigste Substanz der Zelle, in ihm concentriren sich die Functionen derselben, in i)
i) Nachdem Schultze die Uebereinstimmung der Bewegungsphänomene im Körper der Nodiluca und der Diatomeen
bewiesen, fährt er fort (1. c. p. 335): „die Körnchenströme gleichen aber auch vollständig denen in den hervorgestreckten
Fäden der Gromien, Polythalamien und Polycystinen. Unger hat kürzlich (Anatomie und Physiologie der Pflanzen) eine
früher schon von Cohn (Nachträge zur Naturgeschichte des Protococcus pluvialis) ausgesprochene Ansicht specteller formu-
lirend, die Saftströmungen (Rotationen) in den Pflanzenzellen, z. B. den Staubfädenhaaren der Tradescantia, mit den Erschei-
nungen, welche die Fäden der Amoebu porrecta zeigen oder die Polythalamien, wie ich sie beschrieben, zusammengestellt, und
die Bewegungen des Protoplasma hier gleich denen der sogenannten Sarkode der Rhizopoden erklärt. Ich habe die oft be-
schriebenen Erscheinungen in den Staubfädenhaaren von Tradescantia verglichen und muss danach die grosse Uebereinstimmung
derselben mit den Strömungen bei den Diatomeen sowohl, als auch in den Fäden der Rhizopoden anerkennen. Ich wählte
zur Beobachtung Tradescantia procumbens, deren Filamentenhaare sehr durchsichtige Zellenwände und vollständig farblosen
Inhalt besitzen, der bei T. zebrina z. B. mehr oder weniger roth die Deutlichkeit der Bewegungserscheinungen etwas beein-
trächtigt. Auch sind die Körnchen bei ersterer grösser und die Grundsubstanz der Fäden scheinbar mehr homogen. Von
der den Kern umhüllenden Protoplasmaschicht gehen mehrere dickere und dünnere Fäden aus, nach allen Richtungen die Zelle durch-
setzend, auch öfter der Zellwand (wie bei Rhizosolenia) dicht anliegend. Sie bestehen deutlich aus einer Grundsubstanz und
eingebetteten, stark lichtbrechenden Körnchen. Letztere laufen im Innern oder wie auf der Oberfläche der Fäden hin, ent-
weder nur nach einer Richtung, oder wie nicht selten gesehen werden kann, nach entgegengesetzten Richtungen zugleich an
einem und demselben Faden. An den breitesten ist die doppelte Strömungsrichtung fast constant, sie kommt aber auch au
den feinsten, kaum noch erkennbaren Fäden vor. Begegnen sich Körnchen, so gehen sie meist ungestört an einander vorbei,
oder es kommt vor, dass die einen die anderen mit zurücknehmen — ein Beweis, dass nicht 2 getrennte Fäden die Ursache
der doppelten Stromesrichtung waren. An demselben Faden überholen einzelne in schnellem Laufe andere langsamere, und
können dann, wie ich einmal sah, plötzlich zurücklaufend gemeinschaftlich nmkehren. Die Fäden theilen sich öfter gabelig,
und ein Körnchen, an die Theilungsstelle gelangt, stockt, ehe es sich dem einen oder dem anderen Wege anvertraut. Die
Gestalt und Richtung der Fäden ist aber fortwährendem "Wechsel unterworfen. Die gabelige Theilung z. B. rückt von der
Basis des Fadens am Zellenkern dem anderen, an der inneren Oberfläche der Zellenwand sich befindenden Ende entgegen. Oder es
bildet sich aus der gabeligen Theilung eine Brücke zu einem nebenan liegenden Faden, indem der eine Theilast mit diesem
verschmilzt. Die Brücke läuft dann abwärts oder aufwärts zwischen beiden 'Fäden hin, verkürzt sich, indem letztere sich ein-
ander nähern, endlich verschmelzen sie vollständig mit einander zu einem einzigen, so dass jetzt ein breiter Strom fliesst, wo
vorher einzelne feine Fäden waren. — Die geschilderten Bewegungen des Protoplasma der Pflanzenzellen können nach meiner
Meinung nicht unberücksichtigt bleiben, wenn es sich um eine Deutung der räthselhaften Lebenserscheinungen der Sarkode-
fädeu bei den Rhizopoden handelt, und empfehle ich das vergleichende Studium der ersteren namentlich denen, welche eine
Zusammensetzung z. B. der Polythalamienfäden aus kleinen Zellen für möglich und wahrscheinlich halten. Bei Tradescantia
verlaufen, wie es scheint, dieselben Erscheinungen, welche dort auf thierisches Leben bezogen werden müssen, an unzweifel-
haftem Zelleninhalt.“ Ich kann diese durchaus naturgemässe Darstellung Schultze’s nur in jeder Beziehung bestätigen.