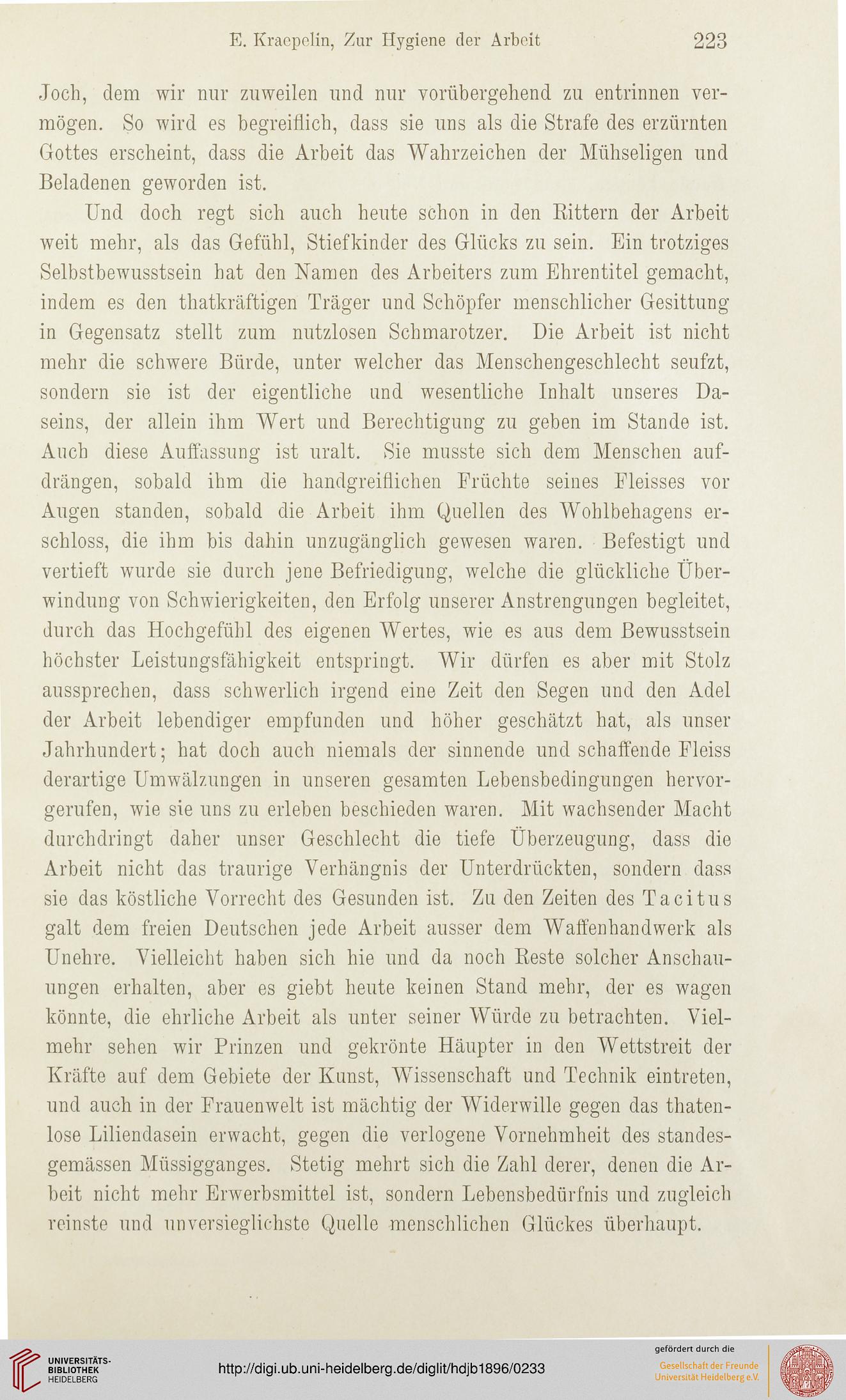E. Kraepelin, Zur Hygiene der Arbeit
223
Joch, clem wir nur zuweilen und nur vorübergehend zu entrinnen ver-
mögen. So wird es begreiflich, dass sie uns als die Strafe des erzürnten
Gottes erscheint, dass die Arbeit das Wahrzeichen der Mühseligen und
Beladenen geworden ist.
Und doch regt sich auch heute schon in den Rittern der Arbeit
weit mehr, als das Gefühl, Stiefkinder des Glücks zu sein. Ein trotziges
Selbstbewusstsein hat den Namen des Arbeiters zum Ehrentitel gemacht,
indem es den thatkräftigen Träger und Schöpfer menschlicher Gesittung
in Gegensatz stellt zum nutzlosen Schmarotzer. Die Arbeit ist nicht
mehr die schwere Bürde, unter welcher das Menschengeschlecht seufzt,
sondern sie ist der eigentliche und wesentliche Inhalt unseres Da-
seins, der allein ihm Wert und Berechtigung zu geben im Stande ist.
Auch diese Auffassung ist uralt. Sie musste sich dem Menschen auf-
drängen, sobald ihm die handgreiflichen Früchte seines Eleisses vor
Augen standen, sobald die Arbeit ihm Quellen des Wohlbehagens er-
schloss, die ihm bis dahin unzugänglich gewesen waren. Befestigt und
vertieft wurde sie durch jene Befriedigung, welche die glückliche Über-
windung von Schwierigkeiten, den Erfolg unserer Anstrengungen begleitet,
durch das Hochgefühl des eigenen Wertes, wie es aus dem Bewusstsein
höchster Leistungsfähigkeit entspringt. Wir dürfen es aber mit Stolz
aussprechen, dass schwerlich irgend eine Zeit den Segen und den Adel
der Arbeit lebendiger empfunden und höher geschätzt hat, als unser
Jahrhundert; hat doch auch niemals der sinnende und schaffende Fleiss
derartige Umwälzungen in unseren gesamten Lebensbedingungen hervor-
gerufen, wie sie uns zu erleben bescbieden waren. Mit wachsender Macht
durchdringt daher unser Geschlecht die tiefe Überzeugung, dass die
Arbeit nicht das traurige Verhängnis der Unterdrückten, sondern dass
sie das köstliche Vorrecht des Gesunden ist. Zu den Zeiten des Tacitus
galt dem freien Deutschen jede Arbeit ausser dem Waffenhandwerk als
Unehre. Vielleicht haben sich hie und da noch Reste solcher Anschau-
ungen erhalten, aber es giebt heute keinen Stand mehr, der es wagen
könnte, die ehrliche Arbeit als unter seiner Würde zu betrachten. Viel-
mehr sehen wir Prinzen und gekrönte Häupter in den Wettstreit der
Kräfte auf dem Gebiete der Kunst, Wissenschaft und Technik eintreten,
und auch in der Frauenwelt ist mächtig der Widerwille gegen das thaten-
lose Liliendasein erwacht, gegen die verlogene Vornehmheit des standes-
gemässen Müssigganges. Stetig mehrt sich die Zahl derer, denen die Ar-
beit nicht mehr Erwerbsmittel ist, sondern Lebensbedürfnis und zugleich
reinste und unversieglichste Quelle menschlichen Glückes überhaupt.
223
Joch, clem wir nur zuweilen und nur vorübergehend zu entrinnen ver-
mögen. So wird es begreiflich, dass sie uns als die Strafe des erzürnten
Gottes erscheint, dass die Arbeit das Wahrzeichen der Mühseligen und
Beladenen geworden ist.
Und doch regt sich auch heute schon in den Rittern der Arbeit
weit mehr, als das Gefühl, Stiefkinder des Glücks zu sein. Ein trotziges
Selbstbewusstsein hat den Namen des Arbeiters zum Ehrentitel gemacht,
indem es den thatkräftigen Träger und Schöpfer menschlicher Gesittung
in Gegensatz stellt zum nutzlosen Schmarotzer. Die Arbeit ist nicht
mehr die schwere Bürde, unter welcher das Menschengeschlecht seufzt,
sondern sie ist der eigentliche und wesentliche Inhalt unseres Da-
seins, der allein ihm Wert und Berechtigung zu geben im Stande ist.
Auch diese Auffassung ist uralt. Sie musste sich dem Menschen auf-
drängen, sobald ihm die handgreiflichen Früchte seines Eleisses vor
Augen standen, sobald die Arbeit ihm Quellen des Wohlbehagens er-
schloss, die ihm bis dahin unzugänglich gewesen waren. Befestigt und
vertieft wurde sie durch jene Befriedigung, welche die glückliche Über-
windung von Schwierigkeiten, den Erfolg unserer Anstrengungen begleitet,
durch das Hochgefühl des eigenen Wertes, wie es aus dem Bewusstsein
höchster Leistungsfähigkeit entspringt. Wir dürfen es aber mit Stolz
aussprechen, dass schwerlich irgend eine Zeit den Segen und den Adel
der Arbeit lebendiger empfunden und höher geschätzt hat, als unser
Jahrhundert; hat doch auch niemals der sinnende und schaffende Fleiss
derartige Umwälzungen in unseren gesamten Lebensbedingungen hervor-
gerufen, wie sie uns zu erleben bescbieden waren. Mit wachsender Macht
durchdringt daher unser Geschlecht die tiefe Überzeugung, dass die
Arbeit nicht das traurige Verhängnis der Unterdrückten, sondern dass
sie das köstliche Vorrecht des Gesunden ist. Zu den Zeiten des Tacitus
galt dem freien Deutschen jede Arbeit ausser dem Waffenhandwerk als
Unehre. Vielleicht haben sich hie und da noch Reste solcher Anschau-
ungen erhalten, aber es giebt heute keinen Stand mehr, der es wagen
könnte, die ehrliche Arbeit als unter seiner Würde zu betrachten. Viel-
mehr sehen wir Prinzen und gekrönte Häupter in den Wettstreit der
Kräfte auf dem Gebiete der Kunst, Wissenschaft und Technik eintreten,
und auch in der Frauenwelt ist mächtig der Widerwille gegen das thaten-
lose Liliendasein erwacht, gegen die verlogene Vornehmheit des standes-
gemässen Müssigganges. Stetig mehrt sich die Zahl derer, denen die Ar-
beit nicht mehr Erwerbsmittel ist, sondern Lebensbedürfnis und zugleich
reinste und unversieglichste Quelle menschlichen Glückes überhaupt.