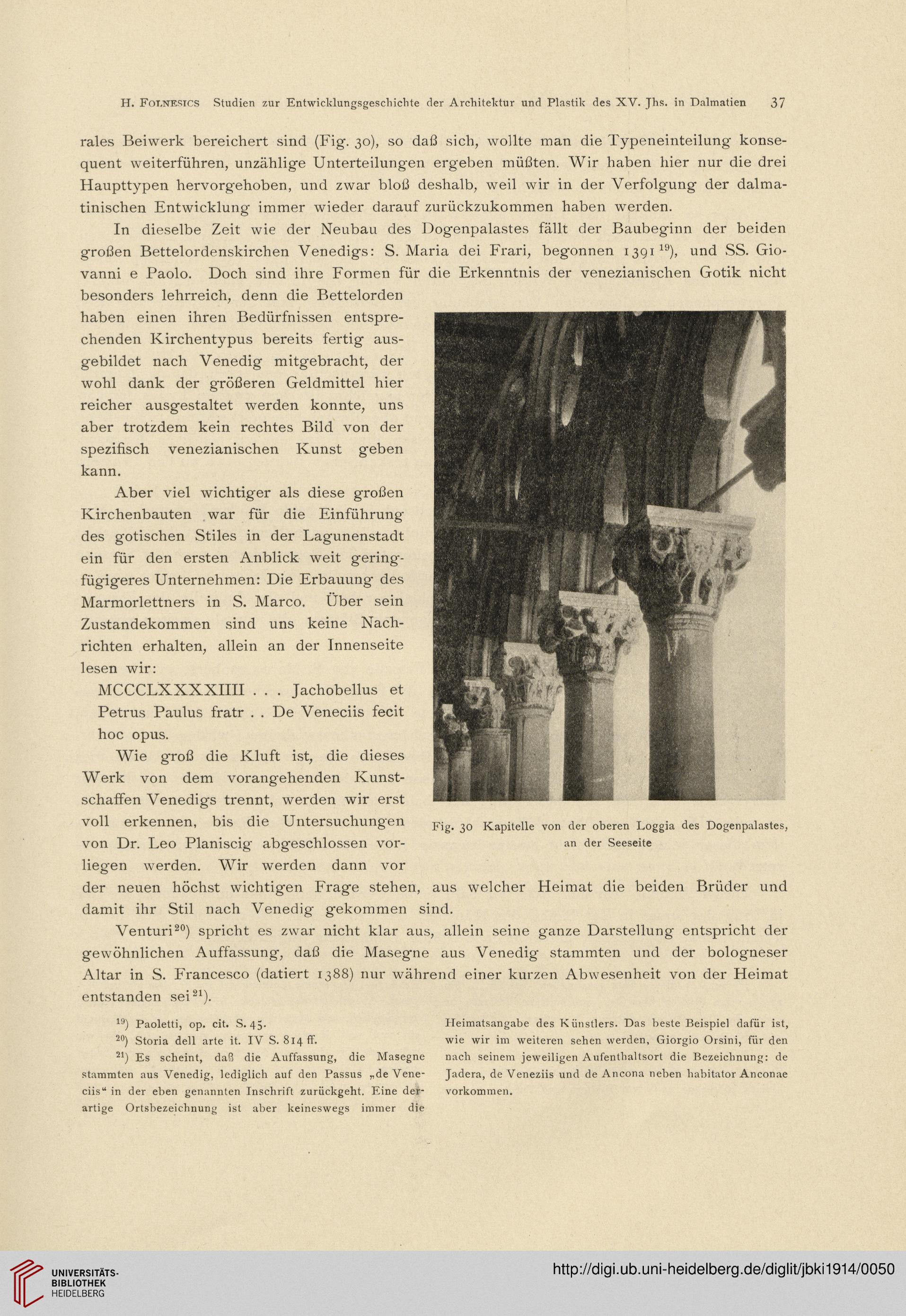H. Folnbsics Studien zur Entwicklungsgeschichte der Architektur und Plastik des XV. Jhs. in Dalmatien 37
rales Beiwerk bereichert sind (Fig. 30), so daß sich, wollte man die Typeneinteilung konse-
quent weiterführen, unzählige Unterteilungen ergeben müßten. Wir haben hier nur die drei
Haupttypen hervorgehoben, und zwar bloß deshalb, weil wir in der Verfolgung der dalma-
tinischen Entwicklung immer wieder darauf zurückzukommen haben werden.
In dieselbe Zeit wie der Neubau des Dogenpalastes fällt der Baubeginn der beiden
großen Bettelordenskirchen Venedigs: S. Maria dei Frari, begonnen 1391 19), und SS. Gio-
vanni e Paolo. Doch sind ihre Formen für die Erkenntnis der venezianischen Gotik nicht
besonders lehrreich, denn die Bettelorden
haben einen ihren Bedürfnissen entspre-
chenden Kirchentypus bereits fertig aus-
gebildet nach Venedig mitgebracht, der
wohl dank der größeren Geldmittel hier
reicher ausgestaltet werden konnte, uns
aber trotzdem kein rechtes Bild von der
spezifisch venezianischen Kunst geben
kann.
Aber viel wichtiger als diese großen
Kirchenbauten war für die Einführung
des gotischen Stiles in der Lagunenstadt
ein für den ersten Anblick weit gering-
fügigeres Unternehmen: Die Erbauung des
Marmorlettners in S. Marco. Über sein
Zustandekommen sind uns keine Nach-
richten erhalten, allein an der Innenseite
lesen wir:
MCCCLXXXXIIII . . . Jachobellus et
Petrus Paulus fratr . . De Veneciis fecit
hoc opus.
Wie groß die Kluft ist, die dieses
Werk von dem vorangehenden Kunst-
schaffen Venedigs trennt, werden wir erst
voll erkennen, bis die Untersuchungen
von Dr. Leo Planiscig abgeschlossen vor-
liegen werden. Wir werden dann vor
der neuen höchst wichtigen Frage stehen, aus welcher Heimat die beiden Brüder und
damit ihr Stil nach Venedig gekommen sind.
Venturi20) spricht es zwar nicht klar aus, allein seine ganze Darstellung entspricht der
gewöhnlichen Auffassung, daß die Masegne aus Venedig stammten und der bologneser
Altar in S. Francesco (datiert 1388) nur während einer kurzen Abwesenheit von der Heimat
entstanden sei21).
Fig. 30 Kapitelle von der oberen Loggia des Dogenpalastes,
an der Seeseite
19) Paoletti, op. cit. S. 45-
20) Storia dell arte it. IV S. 814 ff.
21) Es scheint, daß die Auffassung, die Masegne
stammten aus Yenedig, lediglich auf den Passus „deVene-
ciis“ in der eben genannten Inschrift zurückgeht. Eine def-
artige Ortsbezeichnung ist aber keineswegs immer die
Heimatsangabe des Künstlers. Das beste Beispiel dafür ist,
wie wir im weiteren sehen werden, Giorgio Orsini, fiir den
nach seinem jeweiligen Aufenthaltsort die Bezeichnung: de
Jadera, de Veneziis und de Ancona neben habitator Anconae
vorkommen.
rales Beiwerk bereichert sind (Fig. 30), so daß sich, wollte man die Typeneinteilung konse-
quent weiterführen, unzählige Unterteilungen ergeben müßten. Wir haben hier nur die drei
Haupttypen hervorgehoben, und zwar bloß deshalb, weil wir in der Verfolgung der dalma-
tinischen Entwicklung immer wieder darauf zurückzukommen haben werden.
In dieselbe Zeit wie der Neubau des Dogenpalastes fällt der Baubeginn der beiden
großen Bettelordenskirchen Venedigs: S. Maria dei Frari, begonnen 1391 19), und SS. Gio-
vanni e Paolo. Doch sind ihre Formen für die Erkenntnis der venezianischen Gotik nicht
besonders lehrreich, denn die Bettelorden
haben einen ihren Bedürfnissen entspre-
chenden Kirchentypus bereits fertig aus-
gebildet nach Venedig mitgebracht, der
wohl dank der größeren Geldmittel hier
reicher ausgestaltet werden konnte, uns
aber trotzdem kein rechtes Bild von der
spezifisch venezianischen Kunst geben
kann.
Aber viel wichtiger als diese großen
Kirchenbauten war für die Einführung
des gotischen Stiles in der Lagunenstadt
ein für den ersten Anblick weit gering-
fügigeres Unternehmen: Die Erbauung des
Marmorlettners in S. Marco. Über sein
Zustandekommen sind uns keine Nach-
richten erhalten, allein an der Innenseite
lesen wir:
MCCCLXXXXIIII . . . Jachobellus et
Petrus Paulus fratr . . De Veneciis fecit
hoc opus.
Wie groß die Kluft ist, die dieses
Werk von dem vorangehenden Kunst-
schaffen Venedigs trennt, werden wir erst
voll erkennen, bis die Untersuchungen
von Dr. Leo Planiscig abgeschlossen vor-
liegen werden. Wir werden dann vor
der neuen höchst wichtigen Frage stehen, aus welcher Heimat die beiden Brüder und
damit ihr Stil nach Venedig gekommen sind.
Venturi20) spricht es zwar nicht klar aus, allein seine ganze Darstellung entspricht der
gewöhnlichen Auffassung, daß die Masegne aus Venedig stammten und der bologneser
Altar in S. Francesco (datiert 1388) nur während einer kurzen Abwesenheit von der Heimat
entstanden sei21).
Fig. 30 Kapitelle von der oberen Loggia des Dogenpalastes,
an der Seeseite
19) Paoletti, op. cit. S. 45-
20) Storia dell arte it. IV S. 814 ff.
21) Es scheint, daß die Auffassung, die Masegne
stammten aus Yenedig, lediglich auf den Passus „deVene-
ciis“ in der eben genannten Inschrift zurückgeht. Eine def-
artige Ortsbezeichnung ist aber keineswegs immer die
Heimatsangabe des Künstlers. Das beste Beispiel dafür ist,
wie wir im weiteren sehen werden, Giorgio Orsini, fiir den
nach seinem jeweiligen Aufenthaltsort die Bezeichnung: de
Jadera, de Veneziis und de Ancona neben habitator Anconae
vorkommen.