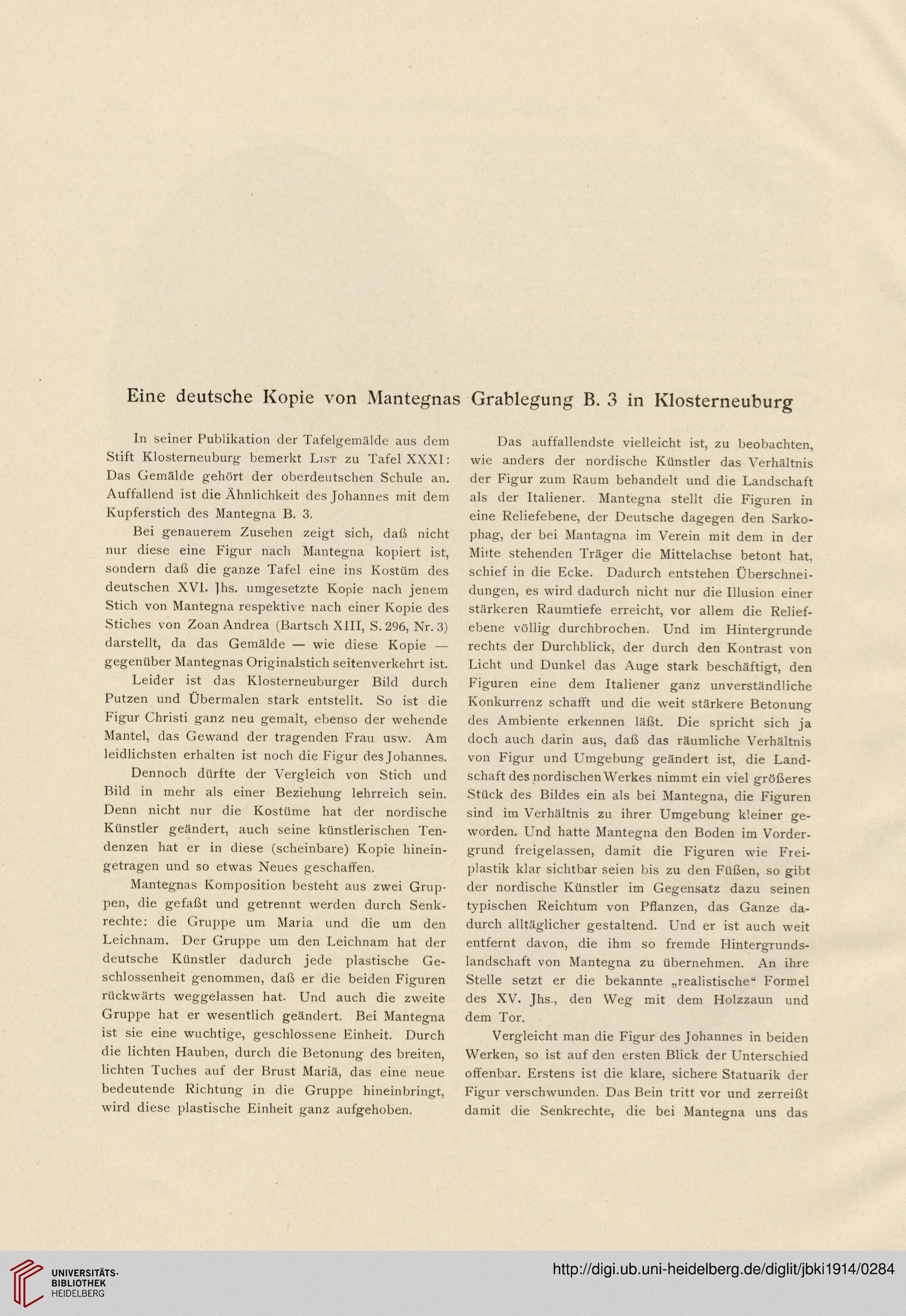Eine deutsche Kopie von Mantegnas Grablegung B. 3 in Klosterneuburg
In seiner Publikation der Tafelgemälde aus dem
Stift Klosterneuburg bemerkt List zu Tafel XXXI:
Das Gemälde gehört der oberdeutschen Schule an.
Auffallend ist die Ähnlichkeit des Johannes mit dem
Kupferstich des Mantegna B. 3.
Bei genauerem Zusehen zeigt sich, daß nicht
nur diese eine Figur nach Mantegna kopiert ist,
sondern daß die ganze Tafel eine ins Kostüm des
deutschen XVI. ]hs. umgesetzte Kopie nach jenem
Stich von Mantegna respektive nach einer Kopie des
Stiches von Zoan Andrea (Bartsch XIII, S. 296, Nr. 3)
darstellt, da das Gemälde — vvie diese Kopie —
gegenüber Mantegnas Originalstich seitenverkehrt ist.
Leider ist das Klosterneuburger Bild durch
Putzen und Übermalen stark entstellt. So ist die
Figur Christi ganz neu gemalt, ebenso der wehende
Mantel, das Gewand der tragenden Frau usw. Am
leidlichsten erhalten ist noch die Figur desjohannes.
Dennoch dürfte der Vergleich von Stich und
Bild in mehr als einer Beziehung lehrreich sein.
Denn nicht nur die Kostüme hat der nordische
Künstler geändert, auch seine künstlerischen Ten-
denzen hat er in diese (scheinbare) Kopie hinein-
getragen und so etwas Neues geschaffen.
Mantegnas Komposition besteht aus zwei Grup-
pen, die gefaßt und getrennt werden durch Senk-
rechte: die Gruppe um Maria und die um den
Leichnam. Der Gruppe um den Leichnam hat der
deutsche Künstler dadurch jede plastische Ge-
schlossenheit genommen, daß er die beiden Figuren
rückwärts weggelassen hat. Und auch die zweite
Gruppe hat er wesentlich geändert. Bei Mantegna
ist sie eine wuchtige, geschlossene Einheit. Durch
die lichten Hauben, durcli die Betonung des breiten,
lichten Tuches auf der Brust Mariä, das eine neue
bedeutende Richtung in die Gruppe hineinbringt,
wird diese plastische Einheit ganz aufgehoben.
Das auffallendste vielleicht ist, zu beobachten,
wie anders der nordische Künstler das Verhältnis
der Figur zum Raum behandelt und die Landschaft
als der Italiener. Mantegna steilt die Figuren in
eine Reliefebene, der Deutsche dagegen den Sarko-
phag, der bei Mantagna im Verein mit dem in der
Mitte stehenden Träger die Mittelachse betont hat,
schief in die Ecke. Dadurch entstehen Überschnei-
dungen, es wird dadurch nicht nur die Illusion einer
stärkeren Raumtiefe erreicht, vor allem die Relief-
ebene völlig durchbrochen. Und im Hintergrunde
rechts der Durchblick, der durch den Kontrast von
Licht und Dunkel das Auge stark beschäftigt, den
Figuren eine dem Italiener ganz unverständliche
Konkurrenz schafft und die weit stärkere Betonung
des Ambiente erkennen läßt. Die spricht sich ja
doch auch darin aus, daß das räumliche Verhältnis
von Figur und Umgebung geändert ist, die Land-
schaft des nordischen Werkes nimmt ein viel größeres
Stück des Bildes ein als bei Mantegna, die Figuren
sind im Verhältnis zu ihrer Umgebung kieiner ge-
worden. Und hatte Mantegna den Boden im Vorder-
grund freigelassen, damit die Figuren wie Frei-
plastik klar sichtbar seien bis zu den Füßen, so gibt
der nordische Künstler im Gegensatz dazu seinen
typischen Reichtum von Pflanzen, das Ganze da-
durch alltäglicher gestaltend. Und er ist auch weit
entfernt davon, die ihm so fremde Hintergrunds-
landschaft von Mantegna zu übernehmen. An ihre
Stelle setzt er die bekannte „realistische“ Formel
des XV. Jhs., den Weg mit dem Holzzaun und
dem Tor.
Vergleicht man die Figur des Johannes in beiden
Werken, so ist auf den ersten Blick der Unterschied
offenbar. Erstens ist die klare, sichere Statuarik der
Figur verschwunden. Das Bein tritt vor und zerreißt
damit die Senkrechte, die bei Mantegna uns das
In seiner Publikation der Tafelgemälde aus dem
Stift Klosterneuburg bemerkt List zu Tafel XXXI:
Das Gemälde gehört der oberdeutschen Schule an.
Auffallend ist die Ähnlichkeit des Johannes mit dem
Kupferstich des Mantegna B. 3.
Bei genauerem Zusehen zeigt sich, daß nicht
nur diese eine Figur nach Mantegna kopiert ist,
sondern daß die ganze Tafel eine ins Kostüm des
deutschen XVI. ]hs. umgesetzte Kopie nach jenem
Stich von Mantegna respektive nach einer Kopie des
Stiches von Zoan Andrea (Bartsch XIII, S. 296, Nr. 3)
darstellt, da das Gemälde — vvie diese Kopie —
gegenüber Mantegnas Originalstich seitenverkehrt ist.
Leider ist das Klosterneuburger Bild durch
Putzen und Übermalen stark entstellt. So ist die
Figur Christi ganz neu gemalt, ebenso der wehende
Mantel, das Gewand der tragenden Frau usw. Am
leidlichsten erhalten ist noch die Figur desjohannes.
Dennoch dürfte der Vergleich von Stich und
Bild in mehr als einer Beziehung lehrreich sein.
Denn nicht nur die Kostüme hat der nordische
Künstler geändert, auch seine künstlerischen Ten-
denzen hat er in diese (scheinbare) Kopie hinein-
getragen und so etwas Neues geschaffen.
Mantegnas Komposition besteht aus zwei Grup-
pen, die gefaßt und getrennt werden durch Senk-
rechte: die Gruppe um Maria und die um den
Leichnam. Der Gruppe um den Leichnam hat der
deutsche Künstler dadurch jede plastische Ge-
schlossenheit genommen, daß er die beiden Figuren
rückwärts weggelassen hat. Und auch die zweite
Gruppe hat er wesentlich geändert. Bei Mantegna
ist sie eine wuchtige, geschlossene Einheit. Durch
die lichten Hauben, durcli die Betonung des breiten,
lichten Tuches auf der Brust Mariä, das eine neue
bedeutende Richtung in die Gruppe hineinbringt,
wird diese plastische Einheit ganz aufgehoben.
Das auffallendste vielleicht ist, zu beobachten,
wie anders der nordische Künstler das Verhältnis
der Figur zum Raum behandelt und die Landschaft
als der Italiener. Mantegna steilt die Figuren in
eine Reliefebene, der Deutsche dagegen den Sarko-
phag, der bei Mantagna im Verein mit dem in der
Mitte stehenden Träger die Mittelachse betont hat,
schief in die Ecke. Dadurch entstehen Überschnei-
dungen, es wird dadurch nicht nur die Illusion einer
stärkeren Raumtiefe erreicht, vor allem die Relief-
ebene völlig durchbrochen. Und im Hintergrunde
rechts der Durchblick, der durch den Kontrast von
Licht und Dunkel das Auge stark beschäftigt, den
Figuren eine dem Italiener ganz unverständliche
Konkurrenz schafft und die weit stärkere Betonung
des Ambiente erkennen läßt. Die spricht sich ja
doch auch darin aus, daß das räumliche Verhältnis
von Figur und Umgebung geändert ist, die Land-
schaft des nordischen Werkes nimmt ein viel größeres
Stück des Bildes ein als bei Mantegna, die Figuren
sind im Verhältnis zu ihrer Umgebung kieiner ge-
worden. Und hatte Mantegna den Boden im Vorder-
grund freigelassen, damit die Figuren wie Frei-
plastik klar sichtbar seien bis zu den Füßen, so gibt
der nordische Künstler im Gegensatz dazu seinen
typischen Reichtum von Pflanzen, das Ganze da-
durch alltäglicher gestaltend. Und er ist auch weit
entfernt davon, die ihm so fremde Hintergrunds-
landschaft von Mantegna zu übernehmen. An ihre
Stelle setzt er die bekannte „realistische“ Formel
des XV. Jhs., den Weg mit dem Holzzaun und
dem Tor.
Vergleicht man die Figur des Johannes in beiden
Werken, so ist auf den ersten Blick der Unterschied
offenbar. Erstens ist die klare, sichere Statuarik der
Figur verschwunden. Das Bein tritt vor und zerreißt
damit die Senkrechte, die bei Mantegna uns das