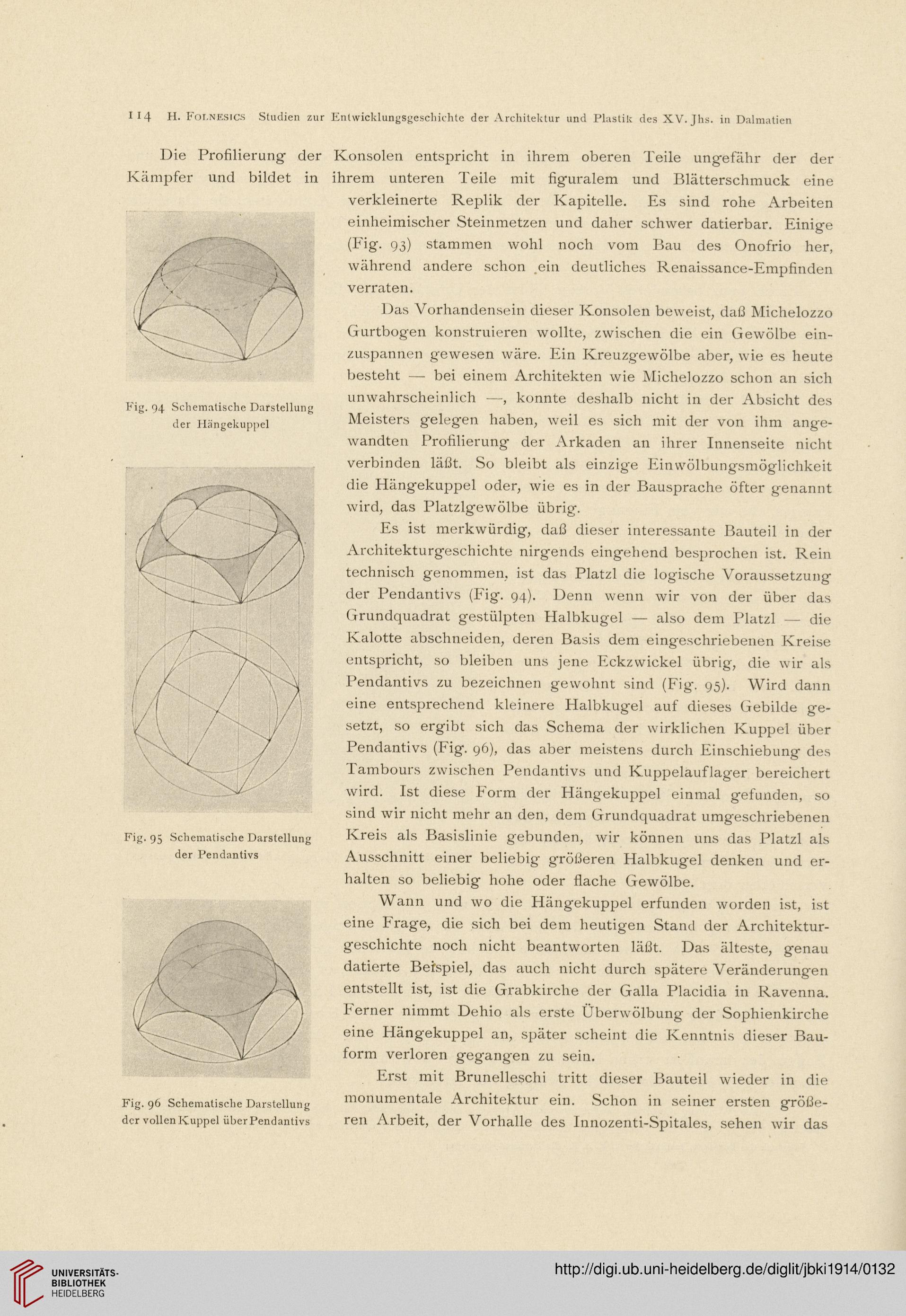I 14 H. Folnesics Studien zur Enlwicklungsgeschichte der Architektur und Plastik des XV. Jhs. in Dalmatien
Die Profilierung- der
Kämpfer und bildet in
Fig. 94 Schematische Darstellung
der Hängekuppel
Fig. 95 Schematische Darstellung
der Pendantivs
Fig. 96 Schematische Darstellung
dcr vollenKuppel überPendantivs
Konsolen entspricht in ihrem oberen Teile ungefähr der der
ihrem unteren Teile mit figuralem und Blätterschmuck eine
verkleinerte Replik der Kapitelle. Es sind rohe Arbeiten
einheimischer Steinmetzen und daher schwer datierbar. Einige
(Fig. 93) stammen wohl noch vom Bau des Onofrio her,
während andere schon .ein deutliches Renaissance-Empfinden
verraten.
Das Vorhandensein dieser Konsolen beweist, daß Michelozzo
Gurtbogen konstruieren wollte, zwischen die ein Gewölbe ein-
zuspannen gewesen wäre. Ein Kreuzgewölbe aber, wie es heute
besteht — bei einem Architekten wie Michelozzo schon an sich
unwahrscheinlich —, konnte deshalb nicht in der Absicht des
Meisters gelegen haben, weil es sich mit der von ihm ange-
wandten Profilierung der Arkaden an ihrer Innenseite nicht
verbinden läßt. So bleibt als einzige Einwölbungsmöglichkeit
die Hängekuppel oder, wie es in der B^iusprache öfter genannt
wird, das Platzlgewölbe übrig.
Es ist merkwürdig, daß dieser interessante Bauteil in der
Architekturgeschichte nirgends eingehend besprochen ist. Rein
technisch genommen, ist das Platzl die logische Voraussetzung
der Pendantivs (Fig. 94). Denn wenn wir von der über das
Grundquadrat gestülpten Halbkugel — also dem Platzl — die
Kalotte abschneiden, deren Basis dem eingeschriebenen Kreise
entspricht, so bleiben uns jene Eckzwickel übrig, die wir als
Pendantivs zu bezeichnen gewohnt sind (Fig. 95). Wird dann
eine entsprechend kleinere Halbkugel auf dieses Gebilde ge-
setzt, so ergibt sich das Schema der wirklichen Kuppei über
Pendantivs (Fig. 96), das aber meistens durch Einschiebung des
Tambours zwischen Pendantivs und Kuppelauflager bereichert
wird. Ist diese Form der Hängekuppel einmal gefunden, so
sind wir nicht mehr an den, dem Grundquadrat umgeschriebenen
Kreis als Basislinie gebunden, wir können uns das Platzl als
Ausschnitt einer beliebig größeren Halbkugel denken und er-
halten so beliebig hohe oder flache Gewölbe.
Wann und wo die Hängekuppel erfunden worden ist, ist
eine Frage, die sich bei dem heutigen Stand der Architektur-
geschichte noch nicht beantworten läßt. Das älteste, genau
datierte Beispiel, das auch nicht durch spätere Veränderungen
entstellt ist, ist die Grabkirche der Galla Placidia in Ravenna.
Ferner nimmt Dehio als erste Überwölbung der Sophienkirche
eine Hängekuppel an, später scheint die Kenntnis dieser Bau-
form verloren gegangen zu sein.
Erst mit Brunelleschi tritt dieser Bauteil wieder in die
monumentale Architektur ein. Schon in seiner ersten größe-
ren Arbeit, der Vorhalle des Innozenti-Spitales, sehen wir das
Die Profilierung- der
Kämpfer und bildet in
Fig. 94 Schematische Darstellung
der Hängekuppel
Fig. 95 Schematische Darstellung
der Pendantivs
Fig. 96 Schematische Darstellung
dcr vollenKuppel überPendantivs
Konsolen entspricht in ihrem oberen Teile ungefähr der der
ihrem unteren Teile mit figuralem und Blätterschmuck eine
verkleinerte Replik der Kapitelle. Es sind rohe Arbeiten
einheimischer Steinmetzen und daher schwer datierbar. Einige
(Fig. 93) stammen wohl noch vom Bau des Onofrio her,
während andere schon .ein deutliches Renaissance-Empfinden
verraten.
Das Vorhandensein dieser Konsolen beweist, daß Michelozzo
Gurtbogen konstruieren wollte, zwischen die ein Gewölbe ein-
zuspannen gewesen wäre. Ein Kreuzgewölbe aber, wie es heute
besteht — bei einem Architekten wie Michelozzo schon an sich
unwahrscheinlich —, konnte deshalb nicht in der Absicht des
Meisters gelegen haben, weil es sich mit der von ihm ange-
wandten Profilierung der Arkaden an ihrer Innenseite nicht
verbinden läßt. So bleibt als einzige Einwölbungsmöglichkeit
die Hängekuppel oder, wie es in der B^iusprache öfter genannt
wird, das Platzlgewölbe übrig.
Es ist merkwürdig, daß dieser interessante Bauteil in der
Architekturgeschichte nirgends eingehend besprochen ist. Rein
technisch genommen, ist das Platzl die logische Voraussetzung
der Pendantivs (Fig. 94). Denn wenn wir von der über das
Grundquadrat gestülpten Halbkugel — also dem Platzl — die
Kalotte abschneiden, deren Basis dem eingeschriebenen Kreise
entspricht, so bleiben uns jene Eckzwickel übrig, die wir als
Pendantivs zu bezeichnen gewohnt sind (Fig. 95). Wird dann
eine entsprechend kleinere Halbkugel auf dieses Gebilde ge-
setzt, so ergibt sich das Schema der wirklichen Kuppei über
Pendantivs (Fig. 96), das aber meistens durch Einschiebung des
Tambours zwischen Pendantivs und Kuppelauflager bereichert
wird. Ist diese Form der Hängekuppel einmal gefunden, so
sind wir nicht mehr an den, dem Grundquadrat umgeschriebenen
Kreis als Basislinie gebunden, wir können uns das Platzl als
Ausschnitt einer beliebig größeren Halbkugel denken und er-
halten so beliebig hohe oder flache Gewölbe.
Wann und wo die Hängekuppel erfunden worden ist, ist
eine Frage, die sich bei dem heutigen Stand der Architektur-
geschichte noch nicht beantworten läßt. Das älteste, genau
datierte Beispiel, das auch nicht durch spätere Veränderungen
entstellt ist, ist die Grabkirche der Galla Placidia in Ravenna.
Ferner nimmt Dehio als erste Überwölbung der Sophienkirche
eine Hängekuppel an, später scheint die Kenntnis dieser Bau-
form verloren gegangen zu sein.
Erst mit Brunelleschi tritt dieser Bauteil wieder in die
monumentale Architektur ein. Schon in seiner ersten größe-
ren Arbeit, der Vorhalle des Innozenti-Spitales, sehen wir das