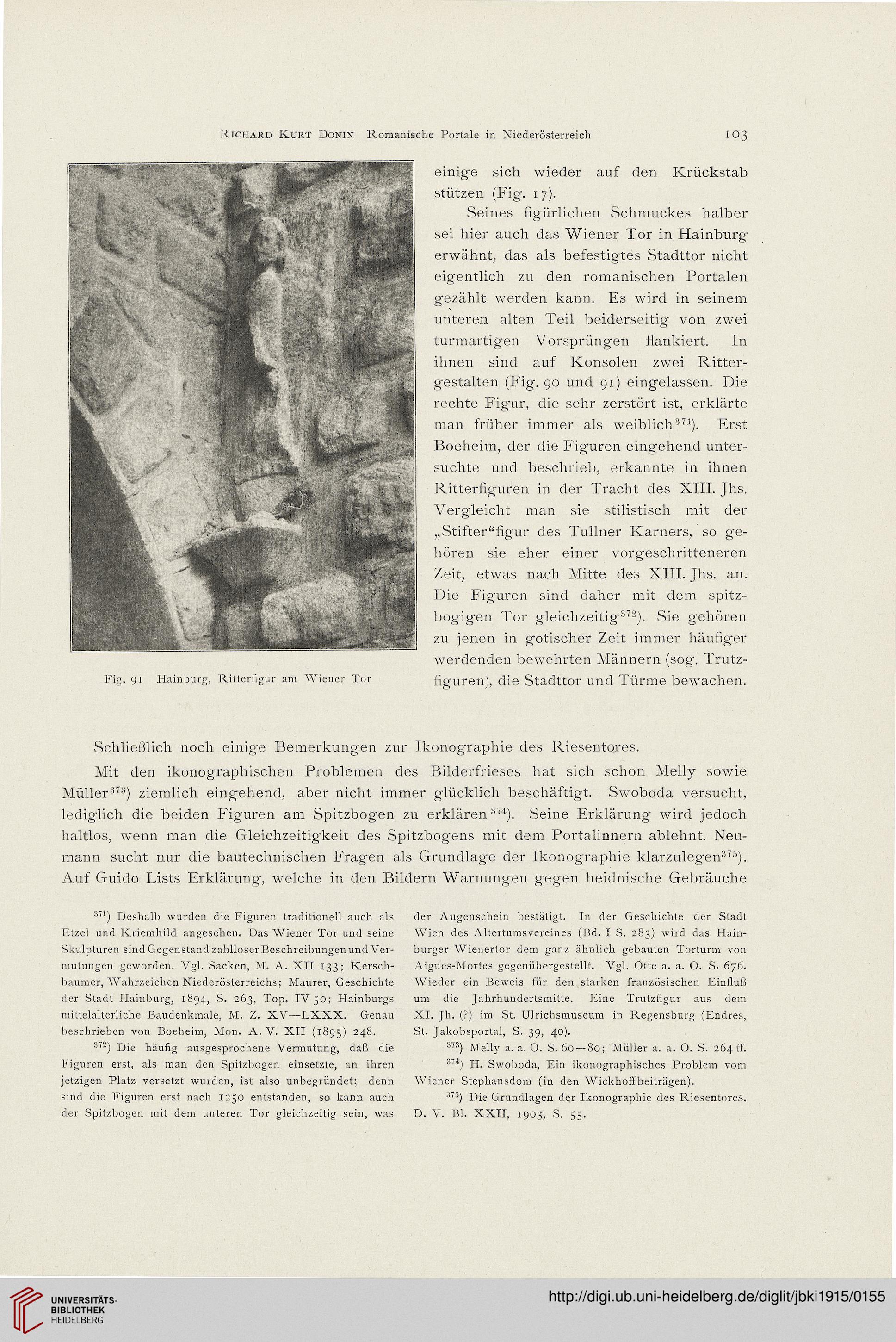HtCHARD KURT DoNIN Romanische Portaie in Xiederösterreicli
103
einige sich wieder auf den Krückstab
stützen (Fig. 1 7).
Seines hgürlichen Schmuckes halber
sei hier auch das Wiener Tor in Hainburg
erwähnt, das als befestigtes Stadttor nicht
eigentlich zu den romanischen Portalen
gezählt werden kann. Es wird in seinem
unteren alten Teil beiderseitig von zwei
turmartigen Vorsprüngen hankiert. In
ihnen sind auf Konsolen zwei Ritter-
gestalten (Fig. 90 und 91) eingelassen. Die
rechte Figur, die sehr zerstört ist, erklärte
man früher immer ais weiblich"*). Erst
Boeheim, der die Figuren eingehend unter-
suchte und beschrieb, erkannte in ihnen
Ritterhguren in der Tracht des XIII. Jhs.
Vergleicht man sie stilistisch mit der
„Stifter"6gur des Tullner Karners, so ge-
hören sie eher einer vorgeschritteneren
Zeit, etwas nach Mitte des XIII. Jhs. an.
Die Figuren sind daher mit dem spitz-
bogigen Tor gleichzeitig^). Sie gehören
zu jenen in gotischer Zeit immer häuhger
werdenden bewehrten Männern (sog. Trutz-
ftguren), die Stadttor und Türme bewachen.
Schließlich noch einige Bemerkungen zur Ikonographie des Riesentores.
Mit den ikonographischen Problemen des Bilderfrieses hat sich schon Melly sowie
Mülier^^^) ziemlich eingehend, aber nicht immer glücklich beschäftigt. Swoboda versucht,
lediglich die beiden Figuren am Spitzbogen zu erkiärenS^j. Seine Erklärung wird jedoch
haltlos, wenn man die Gieichzeitigkeit des Spitzbogens mit dem Portalinnern ablehnt. Neu-
mann sucht nur die bautechnischen Fragen als Grundlage der Ikonographie klarzulegen^^^).
Auf Guido Lists Erkiärung, welche in den Biidern Warnungen gegen heidnische Gebräuche
^'*) Deshalb wurden die Figuren traditioneil auch als
Etzel und Kriemhild angesehen. Das Wiener Tor und seine
Skulpturen sind Gegenstand zahlloserBeschreibungenund Ver-
mutungen geworden. Vgl. Sacken, M. A. XII 133; Kersch-
baumer, WahrzeichenNiederösterreichs; Maurer, Geschichte
der Stadt Hainburg, 1894, S. 263, Top. IV 30; Hainburgs
mittelalterliche Baudenkmale, M. Z. XV—LXXX. Genau
beschriebcn von Boeheim, Mon. A. V. XII (1893) 248-
3*72) Die häuhg ausgesprochene Vermutung, daß die
Tigurcn erst, als man dcn Spitzbogen einsetzte, an ihren
jetzigen Platz versetzt wurden, ist also unbegründet; denn
sind die Figuren erst nach 1230 entstanden, so kann auch
der Spitzbogen mit dem unteren Tor gleichzeitig sein, was
der Augenschein bestätigt. In der Geschichte der Stadt
Wien des Altertumsvereines (Bd. I S. 283) wird das Hain-
burger Wienertor dem ganz ähnlich gebauten Torturm von
Aigues-Mortes gegenübergestellt. Vgl. Otte a. a. O. S. 676.
Wieder ein Beweis für den starken französischen Einfluß
um die Jahrhundertsmitte. Eine Trutzhgur aus dem
XI. Jh. (?) im St. Ulrichsmuseum in Regensburg (Endres,
St. Jakobsportal, S. 39, 40).
373) Melly a. a. O. S. 60-80; Müller a. a. O. S. 264 ff.
3'4) H. Swoboda, Ein ikonographisches Problem vom
Wiener Stephansdom (in den Wickhoffbeiträgen).
37^) Die Grundlagen der Ikonographie des Riesentores.
D. V. Bl. XXII, 1903, S. 33.
103
einige sich wieder auf den Krückstab
stützen (Fig. 1 7).
Seines hgürlichen Schmuckes halber
sei hier auch das Wiener Tor in Hainburg
erwähnt, das als befestigtes Stadttor nicht
eigentlich zu den romanischen Portalen
gezählt werden kann. Es wird in seinem
unteren alten Teil beiderseitig von zwei
turmartigen Vorsprüngen hankiert. In
ihnen sind auf Konsolen zwei Ritter-
gestalten (Fig. 90 und 91) eingelassen. Die
rechte Figur, die sehr zerstört ist, erklärte
man früher immer ais weiblich"*). Erst
Boeheim, der die Figuren eingehend unter-
suchte und beschrieb, erkannte in ihnen
Ritterhguren in der Tracht des XIII. Jhs.
Vergleicht man sie stilistisch mit der
„Stifter"6gur des Tullner Karners, so ge-
hören sie eher einer vorgeschritteneren
Zeit, etwas nach Mitte des XIII. Jhs. an.
Die Figuren sind daher mit dem spitz-
bogigen Tor gleichzeitig^). Sie gehören
zu jenen in gotischer Zeit immer häuhger
werdenden bewehrten Männern (sog. Trutz-
ftguren), die Stadttor und Türme bewachen.
Schließlich noch einige Bemerkungen zur Ikonographie des Riesentores.
Mit den ikonographischen Problemen des Bilderfrieses hat sich schon Melly sowie
Mülier^^^) ziemlich eingehend, aber nicht immer glücklich beschäftigt. Swoboda versucht,
lediglich die beiden Figuren am Spitzbogen zu erkiärenS^j. Seine Erklärung wird jedoch
haltlos, wenn man die Gieichzeitigkeit des Spitzbogens mit dem Portalinnern ablehnt. Neu-
mann sucht nur die bautechnischen Fragen als Grundlage der Ikonographie klarzulegen^^^).
Auf Guido Lists Erkiärung, welche in den Biidern Warnungen gegen heidnische Gebräuche
^'*) Deshalb wurden die Figuren traditioneil auch als
Etzel und Kriemhild angesehen. Das Wiener Tor und seine
Skulpturen sind Gegenstand zahlloserBeschreibungenund Ver-
mutungen geworden. Vgl. Sacken, M. A. XII 133; Kersch-
baumer, WahrzeichenNiederösterreichs; Maurer, Geschichte
der Stadt Hainburg, 1894, S. 263, Top. IV 30; Hainburgs
mittelalterliche Baudenkmale, M. Z. XV—LXXX. Genau
beschriebcn von Boeheim, Mon. A. V. XII (1893) 248-
3*72) Die häuhg ausgesprochene Vermutung, daß die
Tigurcn erst, als man dcn Spitzbogen einsetzte, an ihren
jetzigen Platz versetzt wurden, ist also unbegründet; denn
sind die Figuren erst nach 1230 entstanden, so kann auch
der Spitzbogen mit dem unteren Tor gleichzeitig sein, was
der Augenschein bestätigt. In der Geschichte der Stadt
Wien des Altertumsvereines (Bd. I S. 283) wird das Hain-
burger Wienertor dem ganz ähnlich gebauten Torturm von
Aigues-Mortes gegenübergestellt. Vgl. Otte a. a. O. S. 676.
Wieder ein Beweis für den starken französischen Einfluß
um die Jahrhundertsmitte. Eine Trutzhgur aus dem
XI. Jh. (?) im St. Ulrichsmuseum in Regensburg (Endres,
St. Jakobsportal, S. 39, 40).
373) Melly a. a. O. S. 60-80; Müller a. a. O. S. 264 ff.
3'4) H. Swoboda, Ein ikonographisches Problem vom
Wiener Stephansdom (in den Wickhoffbeiträgen).
37^) Die Grundlagen der Ikonographie des Riesentores.
D. V. Bl. XXII, 1903, S. 33.