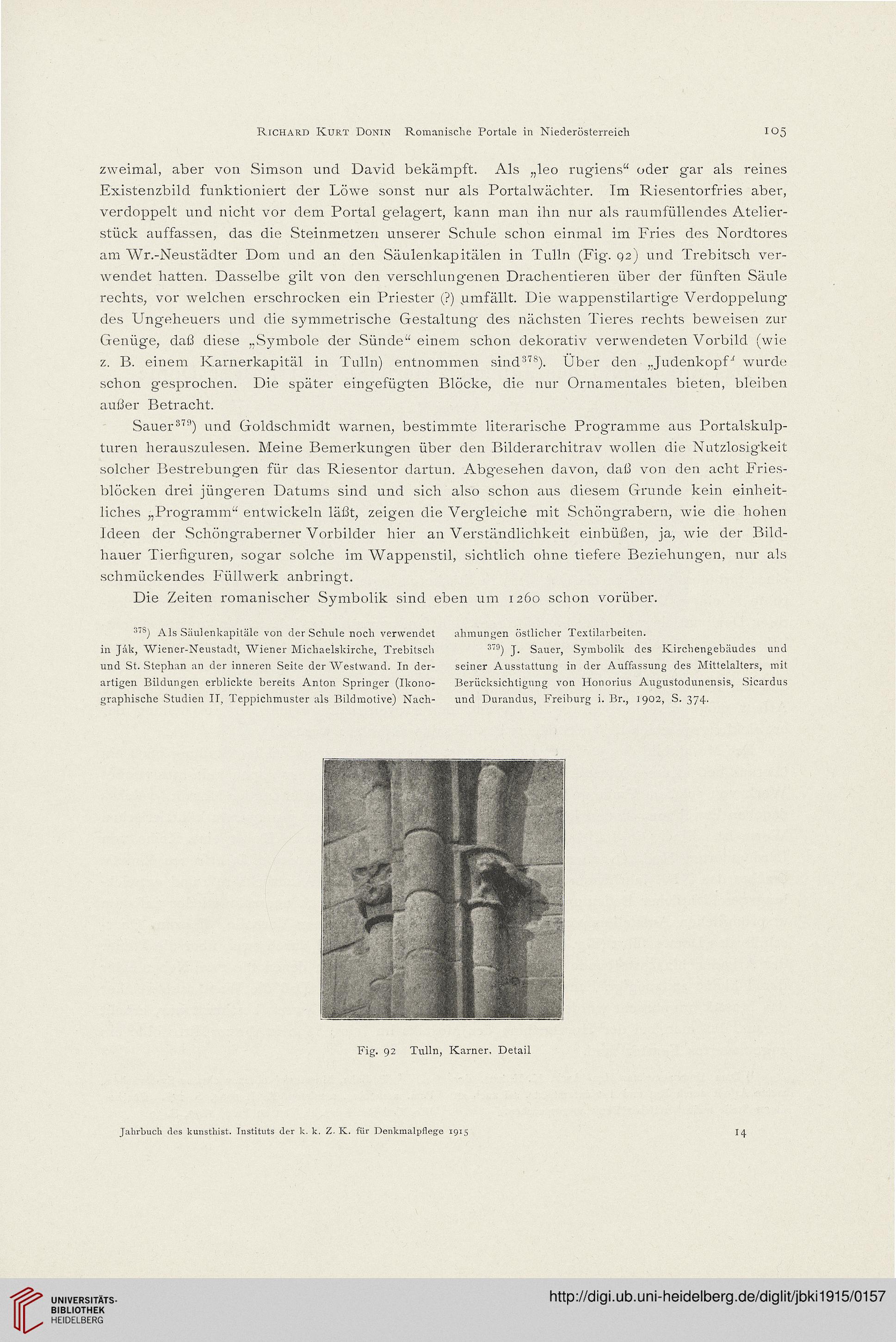RiCHARD KURT DONIN Romanisclie Portale in Niederösterreich
105
zweimal, aber von Simson und David bekämpft. Ais „leo rugiens" oder gar als reines
Existenzbild funktioniert der Löwe sonst nur als Portalwächter. Im Riesentorfries aber,
verdoppelt und nicht vor dem Portal gelagert, kann man ihn nur als raumfüllendes Atelier-
stück auffassen, das die Steinmetzen unserer Schule schon einmal im Fries des Nordtores
am Wr.-Neustädter Dom und an den Säulenkapitälen in Tulln (Fig. Q2) und Trebitsch ver-
wendet hatten. Dasselbe giit von den verschlungenen Drachentieren über der fünften Säule
rechts, vor welchen erschrocken ein Priester (?) pmfällt. Die wappenstilartig'e Verdoppelung
des Ungeheuers und die symmetrische Gestaltung des nächsten Tieres rechts beweisen zur
Genüge, daß diese „Symbole der Sünde" einem schon dekorativ verwendeten Vorbild (wie
z. B. einem Karnerkapitäl in Tulln) entnommen sind^^^). Über den „Judenkopf'* wurde
schon gesprochen. Die später eingefügten Blöcke, die nur Ornamentales bieten, bleiben
außer Betracht.
Sauer^) und Goldschmidt warnen, bestimmte literarische Prog'ramme aus Portalskulp-
turen herauszulesen. Meine Bemerkungen über den Bilderarchitrav wollen die Nutzlosigkeit
solcher Bestrebungen für das Riesentor dartun. Abgesehen davon, daß von den acht Fries-
blöcken drei jüngeren Datums sind und sich also schon aus diesem Grunde kein einheit-
liches „Programm" entwickeln läßt, zeigen die Vergleiche mit Schöngrabern, wie die hohen
ldeen der SchöngrabernerVorbilder hier anVerständlichkeit einbüßen, ja, wie der Bild-
hauer Tierhguren, sogar solche im Wappenstii, sichtlich ohne tiefere Beziehungen, nur als
schmückendes Füllwerk anbringt.
Die Zeiten romanischer Symbolik sind eben um 1260 schon vorüber.
A]s Säuienkapitäle von der Schuie noch verwendet
in Jäk, Wiener-Neustadt, Wiener Michaelskirche, Trebitsch
und St. Stephan an der inneren Seite der Westwand. In der-
artigen Bitdungen erblickte bereits Anton Springer (Ikono-
graphische Studien II, Teppichmuster als Bildmotive) Nach-
ahmungen östlicher Textilarbeiten.
3"9) J. Sauer, Symbolik des Kirchengebäudes und
seiner Ausstattung in der Auffassung des Mittelalters, mit
Berücksichtigung von Honorius Augustodunensis, Sicardus
und Durandus, Freiburg i. Br., 1902, S. 374.
Fig. 92 Tulln, Karner. Detail
14
105
zweimal, aber von Simson und David bekämpft. Ais „leo rugiens" oder gar als reines
Existenzbild funktioniert der Löwe sonst nur als Portalwächter. Im Riesentorfries aber,
verdoppelt und nicht vor dem Portal gelagert, kann man ihn nur als raumfüllendes Atelier-
stück auffassen, das die Steinmetzen unserer Schule schon einmal im Fries des Nordtores
am Wr.-Neustädter Dom und an den Säulenkapitälen in Tulln (Fig. Q2) und Trebitsch ver-
wendet hatten. Dasselbe giit von den verschlungenen Drachentieren über der fünften Säule
rechts, vor welchen erschrocken ein Priester (?) pmfällt. Die wappenstilartig'e Verdoppelung
des Ungeheuers und die symmetrische Gestaltung des nächsten Tieres rechts beweisen zur
Genüge, daß diese „Symbole der Sünde" einem schon dekorativ verwendeten Vorbild (wie
z. B. einem Karnerkapitäl in Tulln) entnommen sind^^^). Über den „Judenkopf'* wurde
schon gesprochen. Die später eingefügten Blöcke, die nur Ornamentales bieten, bleiben
außer Betracht.
Sauer^) und Goldschmidt warnen, bestimmte literarische Prog'ramme aus Portalskulp-
turen herauszulesen. Meine Bemerkungen über den Bilderarchitrav wollen die Nutzlosigkeit
solcher Bestrebungen für das Riesentor dartun. Abgesehen davon, daß von den acht Fries-
blöcken drei jüngeren Datums sind und sich also schon aus diesem Grunde kein einheit-
liches „Programm" entwickeln läßt, zeigen die Vergleiche mit Schöngrabern, wie die hohen
ldeen der SchöngrabernerVorbilder hier anVerständlichkeit einbüßen, ja, wie der Bild-
hauer Tierhguren, sogar solche im Wappenstii, sichtlich ohne tiefere Beziehungen, nur als
schmückendes Füllwerk anbringt.
Die Zeiten romanischer Symbolik sind eben um 1260 schon vorüber.
A]s Säuienkapitäle von der Schuie noch verwendet
in Jäk, Wiener-Neustadt, Wiener Michaelskirche, Trebitsch
und St. Stephan an der inneren Seite der Westwand. In der-
artigen Bitdungen erblickte bereits Anton Springer (Ikono-
graphische Studien II, Teppichmuster als Bildmotive) Nach-
ahmungen östlicher Textilarbeiten.
3"9) J. Sauer, Symbolik des Kirchengebäudes und
seiner Ausstattung in der Auffassung des Mittelalters, mit
Berücksichtigung von Honorius Augustodunensis, Sicardus
und Durandus, Freiburg i. Br., 1902, S. 374.
Fig. 92 Tulln, Karner. Detail
14