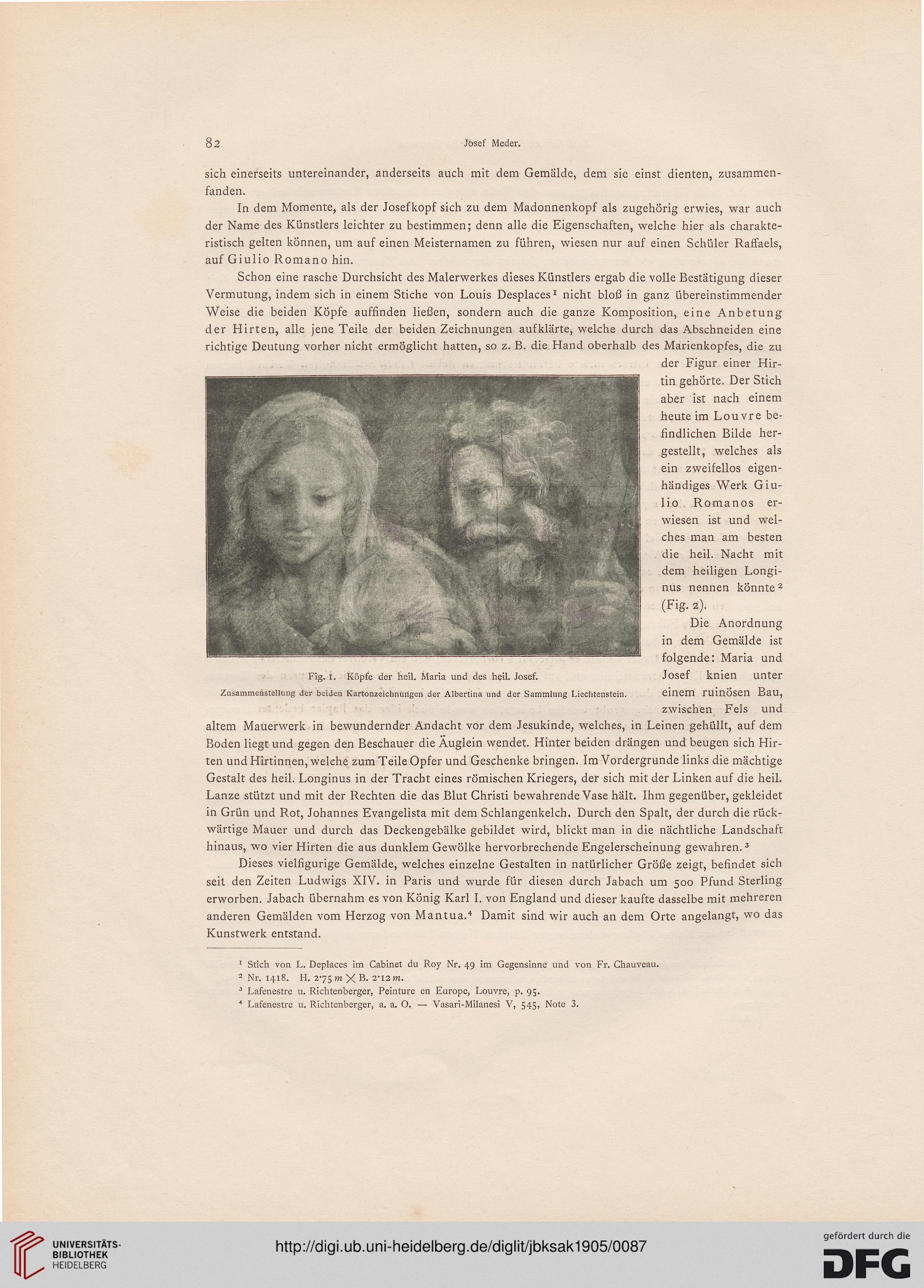82
JOsef Meder.
sich einerseits untereinander, anderseits auch mit dem Gemälde, dem sie einst dienten, zusammen-
fanden.
In dem Momente, als der Josef kopf sich zu dem Madonnenkopf als zugehörig erwies, war auch
der Name des Künstlers leichter zu bestimmen; denn alle die Eigenschaften, welche hier als charakte-
ristisch gelten können, um auf einen Meisternamen zu führen, wiesen nur auf einen Schüler Raffaels,
auf Giulio Romano hin.
Schon eine rasche Durchsicht des Malerwerkes dieses Künstlers ergab die volle Bestätigung dieser
Vermutung, indem sich in einem Stiche von Louis Desplaces1 nicht bloß in ganz übereinstimmender
Weise die beiden Kopfe auffinden ließen, sondern auch die ganze Komposition, eine Anbetung
der Hirten, alle jene Teile der beiden Zeichnungen aufklärte, welche durch das Abschneiden eine
richtige Deutung vorher nicht ermöglicht hatten, so z. B. die Hand oberhalb des Marienkopfes, die zu
der Figur einer Hir-
tin gehörte. Der Stich
aber ist nach einem
heute im Louvre be-
findlichen Bilde her-
gestellt, welches als
ein zweifellos eigen-
händiges Werk Giu-
lio Romanos er-
wiesen ist und wel-
ches man am besten
die heil. Nacht mit
dem heiligen Longi-
nus nennen könnte2
(Fig. 2).
Die Anordnung
in dem Gemälde ist
folgende: Maria und
Fig. 1. Kopfe der heil. Maria und des heil. Josef. Josef knien unter
Zusammenstellung der beiden Kartonzeichnungen der Albertina und der Sammlung Liechtenstein. einem ruinösen Bau,
zwischen Fels und
altem Mauerwerk in bewundernder Andacht vor dem Jesukinde; welches, in Leinen gehüllt, auf dem
Boden liegt und gegen den Beschauer die Äuglein wendet. Hinter beiden drängen und beugen sich Hir-
ten und Hirtinnen, welche zum Teile Opfer und Geschenke bringen. Im Vordergrunde links die mächtige
Gestalt des heil. Longinus in der Tracht eines römischen Kriegers, der sich mit der Linken auf die heil.
Lanze stützt und mit der Rechten die das Blut Christi bewahrende Vase hält. Ihm gegenüber, gekleidet
in Grün und Rot, Johannes Evangelista mit dem Schlangenkelch. Durch den Spalt, der durch die rück-
wärtige Mauer und durch das Deckengebälke gebildet wird, blickt man in die nächtliche Landschaft
hinaus, wo vier Hirten die aus dunklem Gewölke hervorbrechende Engelerscheinung gewahren.3
Dieses vielfigurige Gemälde, welches einzelne Gestalten in natürlicher Größe zeigt, befindet sich
seit den Zeiten Ludwigs XIV. in Paris und wurde für diesen durch Jabach um 500 Pfund Sterling
erworben. Jabach übernahm es von König Karl I. von England und dieser kaufte dasselbe mit mehreren
anderen Gemälden vom Herzog von Mantua.4 Damit sind wir auch an dem Orte angelangt, wo das
Kunstwerk entstand.
1 Stich von L. Deplaces im Cabinet du Roy Nr. 49 im Gegensinne und von Fr. Chauveau.
2 Nr. 1418. H. 275 m X B- 2-12 m-
3 Lafenestre u. Richtenberger, Peinture en Europe, Louvre, p. 95.
4 Lafenestre u. Richtenberger, a. a. O. — Vasari-Milanesi V, 545, Note 3.
JOsef Meder.
sich einerseits untereinander, anderseits auch mit dem Gemälde, dem sie einst dienten, zusammen-
fanden.
In dem Momente, als der Josef kopf sich zu dem Madonnenkopf als zugehörig erwies, war auch
der Name des Künstlers leichter zu bestimmen; denn alle die Eigenschaften, welche hier als charakte-
ristisch gelten können, um auf einen Meisternamen zu führen, wiesen nur auf einen Schüler Raffaels,
auf Giulio Romano hin.
Schon eine rasche Durchsicht des Malerwerkes dieses Künstlers ergab die volle Bestätigung dieser
Vermutung, indem sich in einem Stiche von Louis Desplaces1 nicht bloß in ganz übereinstimmender
Weise die beiden Kopfe auffinden ließen, sondern auch die ganze Komposition, eine Anbetung
der Hirten, alle jene Teile der beiden Zeichnungen aufklärte, welche durch das Abschneiden eine
richtige Deutung vorher nicht ermöglicht hatten, so z. B. die Hand oberhalb des Marienkopfes, die zu
der Figur einer Hir-
tin gehörte. Der Stich
aber ist nach einem
heute im Louvre be-
findlichen Bilde her-
gestellt, welches als
ein zweifellos eigen-
händiges Werk Giu-
lio Romanos er-
wiesen ist und wel-
ches man am besten
die heil. Nacht mit
dem heiligen Longi-
nus nennen könnte2
(Fig. 2).
Die Anordnung
in dem Gemälde ist
folgende: Maria und
Fig. 1. Kopfe der heil. Maria und des heil. Josef. Josef knien unter
Zusammenstellung der beiden Kartonzeichnungen der Albertina und der Sammlung Liechtenstein. einem ruinösen Bau,
zwischen Fels und
altem Mauerwerk in bewundernder Andacht vor dem Jesukinde; welches, in Leinen gehüllt, auf dem
Boden liegt und gegen den Beschauer die Äuglein wendet. Hinter beiden drängen und beugen sich Hir-
ten und Hirtinnen, welche zum Teile Opfer und Geschenke bringen. Im Vordergrunde links die mächtige
Gestalt des heil. Longinus in der Tracht eines römischen Kriegers, der sich mit der Linken auf die heil.
Lanze stützt und mit der Rechten die das Blut Christi bewahrende Vase hält. Ihm gegenüber, gekleidet
in Grün und Rot, Johannes Evangelista mit dem Schlangenkelch. Durch den Spalt, der durch die rück-
wärtige Mauer und durch das Deckengebälke gebildet wird, blickt man in die nächtliche Landschaft
hinaus, wo vier Hirten die aus dunklem Gewölke hervorbrechende Engelerscheinung gewahren.3
Dieses vielfigurige Gemälde, welches einzelne Gestalten in natürlicher Größe zeigt, befindet sich
seit den Zeiten Ludwigs XIV. in Paris und wurde für diesen durch Jabach um 500 Pfund Sterling
erworben. Jabach übernahm es von König Karl I. von England und dieser kaufte dasselbe mit mehreren
anderen Gemälden vom Herzog von Mantua.4 Damit sind wir auch an dem Orte angelangt, wo das
Kunstwerk entstand.
1 Stich von L. Deplaces im Cabinet du Roy Nr. 49 im Gegensinne und von Fr. Chauveau.
2 Nr. 1418. H. 275 m X B- 2-12 m-
3 Lafenestre u. Richtenberger, Peinture en Europe, Louvre, p. 95.
4 Lafenestre u. Richtenberger, a. a. O. — Vasari-Milanesi V, 545, Note 3.