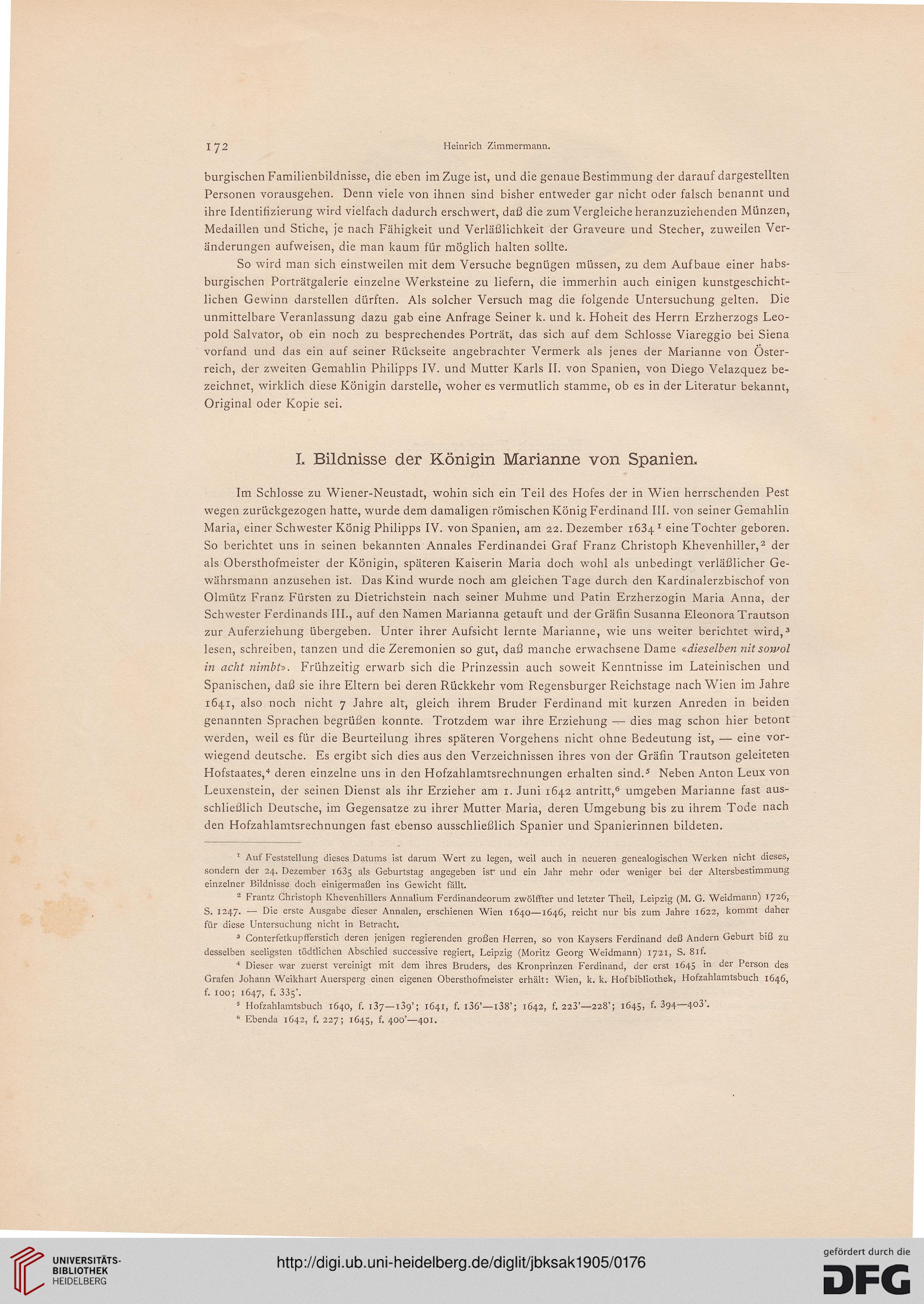172
Heinrich Zimmermann.
burgischen Familienbildnisse, die eben im Zuge ist, und die genaue Bestimmung der darauf dargestellten
Personen vorausgehen. Denn viele von ihnen sind bisher entweder gar nicht oder falsch benannt und
ihre Identifizierung wird vielfach dadurch erschwert, daß die zum Vergleiche heranzuziehenden Münzen,
Medaillen und Stiche, je nach Fähigkeit und Verläßlichkeit der Graveure und Stecher, zuweilen Ver-
änderungen aufweisen, die man kaum für möglich halten sollte.
So wird man sich einstweilen mit dem Versuche begnügen müssen, zu dem Aufbaue einer habs-
burgischen Porträtgalerie einzelne Werksteine zu liefern, die immerhin auch einigen kunstgeschicht-
lichen Gewinn darstellen dürften. Als solcher Versuch mag die folgende Untersuchung gelten. Die
unmittelbare Veranlassung dazu gab eine Anfrage Seiner k. und k. Hoheit des Herrn Erzherzogs Leo-
pold Salvator, ob ein noch zu besprechendes Porträt, das sich auf dem Schlosse Viareggio bei Siena
vorfand und das ein auf seiner Rückseite angebrachter Vermerk als jenes der Marianne von Oster-
reich, der zweiten Gemahlin Philipps IV. und Mutter Karls II. von Spanien, von Diego Velazquez be-
zeichnet, wirklich diese Königin darstelle, woher es vermutlich stamme, ob es in der Literatur bekannt,
Original oder Kopie sei.
I. Bildnisse der Königin Marianne von Spanien.
Im Schlosse zu Wiener-Neustadt, wohin sich ein Teil des Hofes der in Wien herrschenden Pest
wegen zurückgezogen hatte, wurde dem damaligen römischen König Ferdinand III. von seiner Gemahlin
Maria, einer Schwester König Philipps IV. von Spanien, am 22. Dezember 1634 1 eine Tochter geboren.
So berichtet uns in seinen bekannten Annales Ferdinandei Graf Franz Christoph Khevenhiller,2 der
als Obersthofmeister der Königin, späteren Kaiserin Maria doch wohl als unbedingt verläßlicher Ge-
währsmann anzusehen ist. Das Kind wurde noch am gleichen Tage durch den Kardinalerzbischof von
Olmütz Franz Fürsten zu Dietrichstein nach seiner Muhme und Patin Erzherzogin Maria Anna, der
Schwester Ferdinands III., auf den Namen Marianna getauft und der Gräfin Susanna Eleonora Trautson
zur Auferziehung übergeben. Unter ihrer Aufsicht lernte Marianne, wie uns weiter berichtet wird,3
lesen, schreiben, tanzen und die Zeremonien so gut, daß manche erwachsene Dame «dieselben nit sowol
in acht nimbU. Frühzeitig erwarb sich die Prinzessin auch soweit Kenntnisse im Lateinischen und
Spanischen, daß sie ihre Eltern bei deren Rückkehr vom Regensburger Reichstage nach Wien im Jahre
1641, also noch nicht 7 Jahre alt, gleich ihrem Bruder Ferdinand mit kurzen Anreden in beiden
genannten Sprachen begrüßen konnte. Trotzdem war ihre Erziehung — dies mag schon hier betont
werden, weil es für die Beurteilung ihres späteren Vorgehens nicht ohne Bedeutung ist, — eine vor-
wiegend deutsche. Es ergibt sich dies aus den Verzeichnissen ihres von der Gräfin Trautson geleiteten
Hofstaates,4 deren einzelne uns in den Hofzahlamtsrechnungen erhalten sind.5 Neben Anton Leux von
Leuxenstein, der seinen Dienst als ihr Erzieher am 1. Juni 1642 antritt,5 umgeben Marianne fast aus-
schließlich Deutsche, im Gegensatze zu ihrer Mutter Maria, deren Umgebung bis zu ihrem Tode nach
den Hofzahlamtsrechnungen fast ebenso ausschließlich Spanier und Spanierinnen bildeten.
1 Auf Feststellung dieses Datums ist darum Wert zu legen, weil auch in neueren genealogischen Werken nicht dieses,
sondern der 24. Dezember 1635 als Geburtstag angegeben isr und ein Jahr mehr oder weniger bei der Altersbestimmung
einzelner Bildnisse doch einigermaßen ins Gewicht fällt.
2 Frantz Christoph Khevenhillers Annalium Ferdinandeorum zwölffter und letzter Theil, Leipzig (M. G. Weidmann) 172G,
S. 1247. — Die erste Ausgabe dieser Annalen, erschienen Wien 1640—1646, reicht nur bis zum Jahre 1622, kommt daher
für diese Untersuchung nicht in Betracht.
3 Conterfetkupfferstich deren jenigen regierenden großen Herren, so von Kaysers Ferdinand deß Andern Geburt biß zu
desselben seeligsten tödtlichen Abschied successive regiert, Leipzig (Moritz Georg Weidmann) 1721, S. 8lf.
4 Dieser war zuerst vereinigt mit dem ihres Bruders, des Kronprinzen Ferdinand, der erst 1645 in der Person des
Grafen Johann Weikhart Auersperg einen eigenen Obersthofmeister erhält: Wien, k. k. Hofbibliothek, Hofzahlamtsbuch 1646,
f. 100; 1647, f. 335'.
5 Hofzahlamtsbuch 1640, f. 137—139'; 1641, f. i36'—138'; 1642, f. 223'—228'; 1645, f. 394—403'.
6 Ebenda 1642, f. 227; 1645, f. 400'—401.
Heinrich Zimmermann.
burgischen Familienbildnisse, die eben im Zuge ist, und die genaue Bestimmung der darauf dargestellten
Personen vorausgehen. Denn viele von ihnen sind bisher entweder gar nicht oder falsch benannt und
ihre Identifizierung wird vielfach dadurch erschwert, daß die zum Vergleiche heranzuziehenden Münzen,
Medaillen und Stiche, je nach Fähigkeit und Verläßlichkeit der Graveure und Stecher, zuweilen Ver-
änderungen aufweisen, die man kaum für möglich halten sollte.
So wird man sich einstweilen mit dem Versuche begnügen müssen, zu dem Aufbaue einer habs-
burgischen Porträtgalerie einzelne Werksteine zu liefern, die immerhin auch einigen kunstgeschicht-
lichen Gewinn darstellen dürften. Als solcher Versuch mag die folgende Untersuchung gelten. Die
unmittelbare Veranlassung dazu gab eine Anfrage Seiner k. und k. Hoheit des Herrn Erzherzogs Leo-
pold Salvator, ob ein noch zu besprechendes Porträt, das sich auf dem Schlosse Viareggio bei Siena
vorfand und das ein auf seiner Rückseite angebrachter Vermerk als jenes der Marianne von Oster-
reich, der zweiten Gemahlin Philipps IV. und Mutter Karls II. von Spanien, von Diego Velazquez be-
zeichnet, wirklich diese Königin darstelle, woher es vermutlich stamme, ob es in der Literatur bekannt,
Original oder Kopie sei.
I. Bildnisse der Königin Marianne von Spanien.
Im Schlosse zu Wiener-Neustadt, wohin sich ein Teil des Hofes der in Wien herrschenden Pest
wegen zurückgezogen hatte, wurde dem damaligen römischen König Ferdinand III. von seiner Gemahlin
Maria, einer Schwester König Philipps IV. von Spanien, am 22. Dezember 1634 1 eine Tochter geboren.
So berichtet uns in seinen bekannten Annales Ferdinandei Graf Franz Christoph Khevenhiller,2 der
als Obersthofmeister der Königin, späteren Kaiserin Maria doch wohl als unbedingt verläßlicher Ge-
währsmann anzusehen ist. Das Kind wurde noch am gleichen Tage durch den Kardinalerzbischof von
Olmütz Franz Fürsten zu Dietrichstein nach seiner Muhme und Patin Erzherzogin Maria Anna, der
Schwester Ferdinands III., auf den Namen Marianna getauft und der Gräfin Susanna Eleonora Trautson
zur Auferziehung übergeben. Unter ihrer Aufsicht lernte Marianne, wie uns weiter berichtet wird,3
lesen, schreiben, tanzen und die Zeremonien so gut, daß manche erwachsene Dame «dieselben nit sowol
in acht nimbU. Frühzeitig erwarb sich die Prinzessin auch soweit Kenntnisse im Lateinischen und
Spanischen, daß sie ihre Eltern bei deren Rückkehr vom Regensburger Reichstage nach Wien im Jahre
1641, also noch nicht 7 Jahre alt, gleich ihrem Bruder Ferdinand mit kurzen Anreden in beiden
genannten Sprachen begrüßen konnte. Trotzdem war ihre Erziehung — dies mag schon hier betont
werden, weil es für die Beurteilung ihres späteren Vorgehens nicht ohne Bedeutung ist, — eine vor-
wiegend deutsche. Es ergibt sich dies aus den Verzeichnissen ihres von der Gräfin Trautson geleiteten
Hofstaates,4 deren einzelne uns in den Hofzahlamtsrechnungen erhalten sind.5 Neben Anton Leux von
Leuxenstein, der seinen Dienst als ihr Erzieher am 1. Juni 1642 antritt,5 umgeben Marianne fast aus-
schließlich Deutsche, im Gegensatze zu ihrer Mutter Maria, deren Umgebung bis zu ihrem Tode nach
den Hofzahlamtsrechnungen fast ebenso ausschließlich Spanier und Spanierinnen bildeten.
1 Auf Feststellung dieses Datums ist darum Wert zu legen, weil auch in neueren genealogischen Werken nicht dieses,
sondern der 24. Dezember 1635 als Geburtstag angegeben isr und ein Jahr mehr oder weniger bei der Altersbestimmung
einzelner Bildnisse doch einigermaßen ins Gewicht fällt.
2 Frantz Christoph Khevenhillers Annalium Ferdinandeorum zwölffter und letzter Theil, Leipzig (M. G. Weidmann) 172G,
S. 1247. — Die erste Ausgabe dieser Annalen, erschienen Wien 1640—1646, reicht nur bis zum Jahre 1622, kommt daher
für diese Untersuchung nicht in Betracht.
3 Conterfetkupfferstich deren jenigen regierenden großen Herren, so von Kaysers Ferdinand deß Andern Geburt biß zu
desselben seeligsten tödtlichen Abschied successive regiert, Leipzig (Moritz Georg Weidmann) 1721, S. 8lf.
4 Dieser war zuerst vereinigt mit dem ihres Bruders, des Kronprinzen Ferdinand, der erst 1645 in der Person des
Grafen Johann Weikhart Auersperg einen eigenen Obersthofmeister erhält: Wien, k. k. Hofbibliothek, Hofzahlamtsbuch 1646,
f. 100; 1647, f. 335'.
5 Hofzahlamtsbuch 1640, f. 137—139'; 1641, f. i36'—138'; 1642, f. 223'—228'; 1645, f. 394—403'.
6 Ebenda 1642, f. 227; 1645, f. 400'—401.