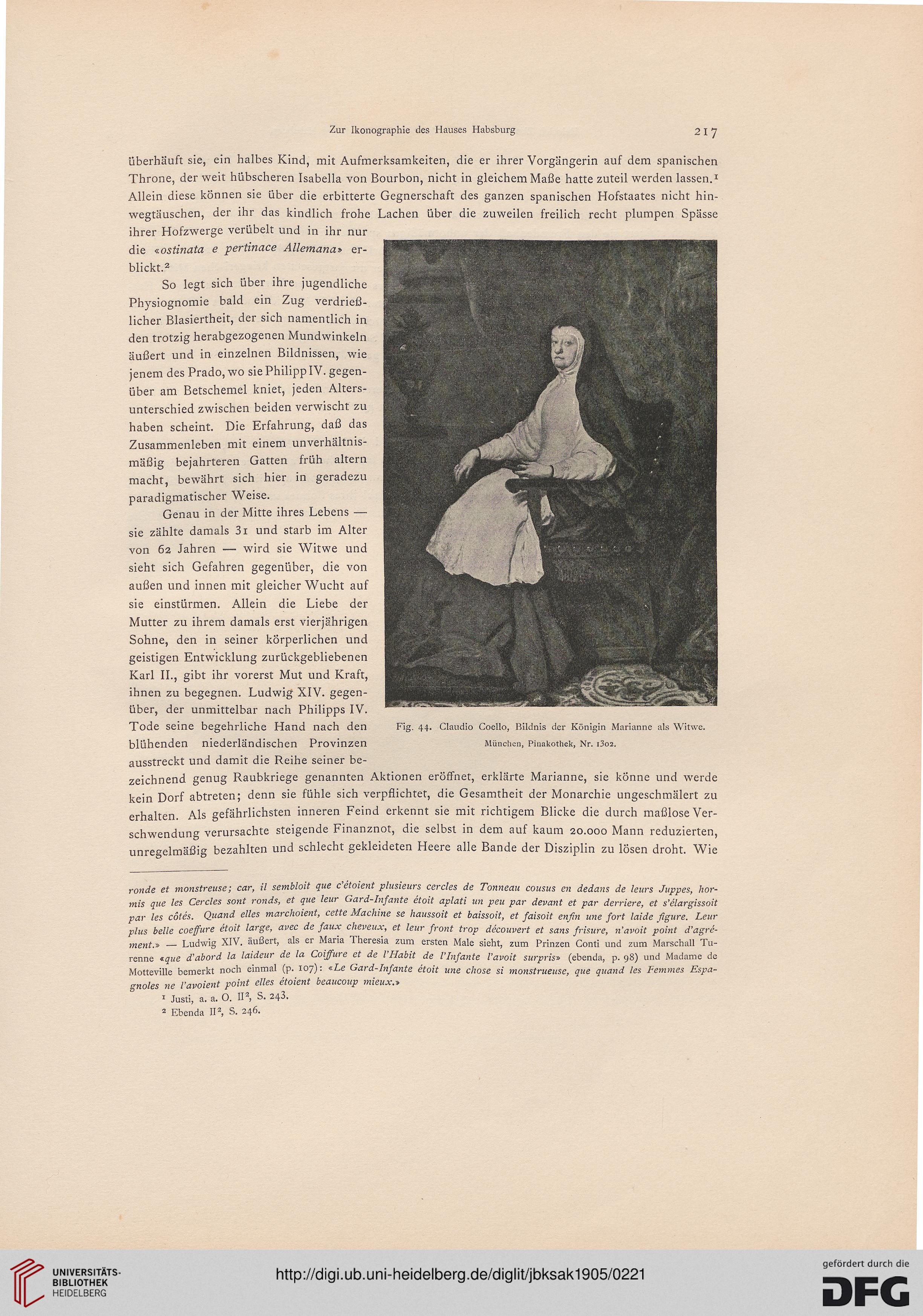Zur Ikonographie des Hauses Habsburg 2 I 7
überhäuft sie, ein halbes Kind, mit Aufmerksamkeiten, die er ihrer Vorgängerin auf dem spanischen
Throne, der weit hübscheren Isabella von Bourbon, nicht in gleichem Maße hatte zuteil werden lassen.1
Allein diese können sie über die erbitterte Gegnerschaft des ganzen spanischen Hofstaates nicht hin-
wegtäuschen, der ihr das kindlich frohe Lachen über die zuweilen freilich recht plumpen Spässe
ihrer Hofzwerge verübelt und in ihr nur
die «ostinata e pertinace Allemana» er-
blickt.2
So legt sich über ihre jugendliche
Physiognomie bald ein Zug verdrieß-
licher Blasiertheit, der sich namentlich in
den trotzig herabgezogenen Mundwinkeln
äußert und in einzelnen Bildnissen, wie
jenem des Prado, wo sie Philipp IV. gegen-
über am Betschemel kniet, jeden Alters-
unterschied zwischen beiden verwischt zu
haben scheint. Die Erfahrung, daß das
Zusammenleben mit einem unverhältnis-
mäßig bejahrteren Gatten früh altern
macht, bewährt sich hier in geradezu
paradigmatischer Weise.
Genau in der Mitte ihres Lebens —■
sie zählte damals 3i und starb im Alter
von 62 Jahren — wird sie Witwe und
sieht sich Gefahren gegenüber, die von
außen und innen mit gleicher Wucht auf
sie einstürmen. Allein die Liebe der
Mutter zu ihrem damals erst vierjährigen
Sohne, den in seiner körperlichen und
geistigen Entwicklung zurückgebliebenen
Karl IL, gibt ihr vorerst Mut und Kraft,
ihnen zu begegnen. Ludwig XIV. gegen-
über, der unmittelbar nach Philipps IV.
Tode seine begehrliche Hand nach den Fig. 44. Claudio Coello, Bildnis der Königin Marianne als Witwe,
blühenden niederländischen Provinzen München, Pinakothek, Nr. 1302.
ausstreckt und damit die Reihe seiner be-
zeichnend genug Raubkriege genannten Aktionen eröffnet, erklärte Marianne, sie könne und werde
kein Dorf abtreten; denn sie fühle sich verpflichtet, die Gesamtheit der Monarchie ungeschmälert zu
erhalten. Als gefährlichsten inneren Feind erkennt sie mit richtigem Blicke die durch maßlose Ver-
schwendung verursachte steigende Finanznot, die selbst in dem auf kaum 20.000 Mann reduzierten,
unregelmäßig bezahlten und schlecht gekleideten Heere alle Bande der Disziplin zu lösen droht. Wie
ronde et monstreuse; car, il sembloit que c'etoient plusieurs cercles de Tonneau cousus en dedans de leurs Juppes, hör-
mis que les Cercles sont ronds, et que leur Gard-Infante etoit aplati un peu par devant et par derriere, et s'elargissoit
par les cötes. Quand elles marchoient, cette Machine se haussoit et baissoit, et faisoit enfin une fort laide figure. Leur
plus belle coeffure etoit large, avec de faux cheveux, et leur front trop decouvert et sans frisure, n'avoit point d'agre-
ment.» — Ludwig XIV. äußert, als er Maria Theresia zum ersten Male sieht, zum Prinzen Conti und zum Marschall Tu-
renne €que d'abord la laideur de la Coiffure et de l'Habit de V Inf ante l'avoit surpris» (ebenda, p. 98) und Madame de
Motteville bemerkt noch einmal (p. 107): «Le Gard-Infante etoit une chose si monstrueusc, que quand les Femmes Espa-
gnoles ne Vavoient point elles etoient beaueoup mieux.t
1 Justi, a. a. O. II2, S. 243.
2 Ebenda II2, S. 246.
überhäuft sie, ein halbes Kind, mit Aufmerksamkeiten, die er ihrer Vorgängerin auf dem spanischen
Throne, der weit hübscheren Isabella von Bourbon, nicht in gleichem Maße hatte zuteil werden lassen.1
Allein diese können sie über die erbitterte Gegnerschaft des ganzen spanischen Hofstaates nicht hin-
wegtäuschen, der ihr das kindlich frohe Lachen über die zuweilen freilich recht plumpen Spässe
ihrer Hofzwerge verübelt und in ihr nur
die «ostinata e pertinace Allemana» er-
blickt.2
So legt sich über ihre jugendliche
Physiognomie bald ein Zug verdrieß-
licher Blasiertheit, der sich namentlich in
den trotzig herabgezogenen Mundwinkeln
äußert und in einzelnen Bildnissen, wie
jenem des Prado, wo sie Philipp IV. gegen-
über am Betschemel kniet, jeden Alters-
unterschied zwischen beiden verwischt zu
haben scheint. Die Erfahrung, daß das
Zusammenleben mit einem unverhältnis-
mäßig bejahrteren Gatten früh altern
macht, bewährt sich hier in geradezu
paradigmatischer Weise.
Genau in der Mitte ihres Lebens —■
sie zählte damals 3i und starb im Alter
von 62 Jahren — wird sie Witwe und
sieht sich Gefahren gegenüber, die von
außen und innen mit gleicher Wucht auf
sie einstürmen. Allein die Liebe der
Mutter zu ihrem damals erst vierjährigen
Sohne, den in seiner körperlichen und
geistigen Entwicklung zurückgebliebenen
Karl IL, gibt ihr vorerst Mut und Kraft,
ihnen zu begegnen. Ludwig XIV. gegen-
über, der unmittelbar nach Philipps IV.
Tode seine begehrliche Hand nach den Fig. 44. Claudio Coello, Bildnis der Königin Marianne als Witwe,
blühenden niederländischen Provinzen München, Pinakothek, Nr. 1302.
ausstreckt und damit die Reihe seiner be-
zeichnend genug Raubkriege genannten Aktionen eröffnet, erklärte Marianne, sie könne und werde
kein Dorf abtreten; denn sie fühle sich verpflichtet, die Gesamtheit der Monarchie ungeschmälert zu
erhalten. Als gefährlichsten inneren Feind erkennt sie mit richtigem Blicke die durch maßlose Ver-
schwendung verursachte steigende Finanznot, die selbst in dem auf kaum 20.000 Mann reduzierten,
unregelmäßig bezahlten und schlecht gekleideten Heere alle Bande der Disziplin zu lösen droht. Wie
ronde et monstreuse; car, il sembloit que c'etoient plusieurs cercles de Tonneau cousus en dedans de leurs Juppes, hör-
mis que les Cercles sont ronds, et que leur Gard-Infante etoit aplati un peu par devant et par derriere, et s'elargissoit
par les cötes. Quand elles marchoient, cette Machine se haussoit et baissoit, et faisoit enfin une fort laide figure. Leur
plus belle coeffure etoit large, avec de faux cheveux, et leur front trop decouvert et sans frisure, n'avoit point d'agre-
ment.» — Ludwig XIV. äußert, als er Maria Theresia zum ersten Male sieht, zum Prinzen Conti und zum Marschall Tu-
renne €que d'abord la laideur de la Coiffure et de l'Habit de V Inf ante l'avoit surpris» (ebenda, p. 98) und Madame de
Motteville bemerkt noch einmal (p. 107): «Le Gard-Infante etoit une chose si monstrueusc, que quand les Femmes Espa-
gnoles ne Vavoient point elles etoient beaueoup mieux.t
1 Justi, a. a. O. II2, S. 243.
2 Ebenda II2, S. 246.