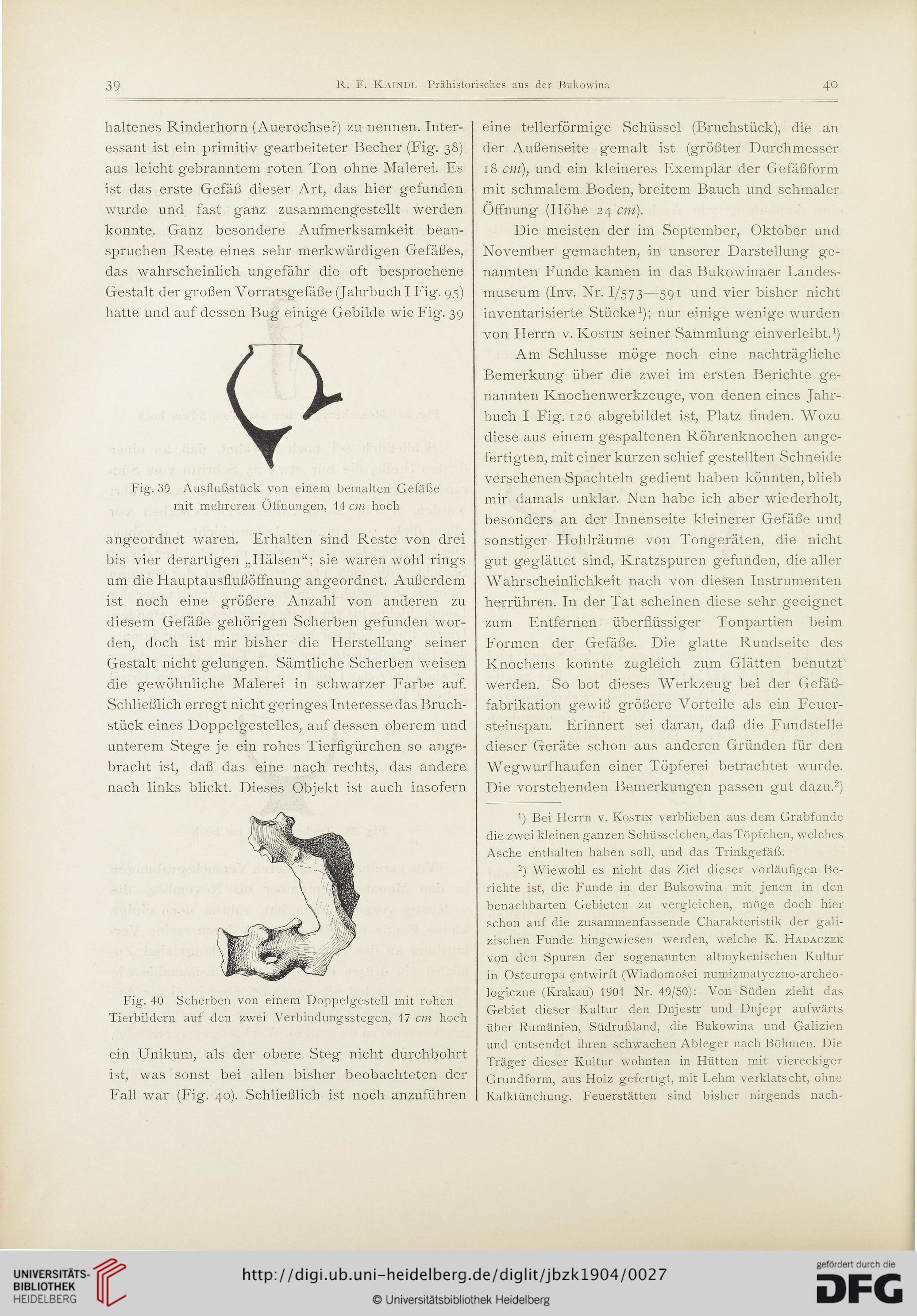39
R. F. KAINDJ, Prähistorisches aus der Bukowina
40
haltenes Rinderhorn (Auerochse?) zu nennen. Inter-
essant ist ein primitiv gearbeiteter Becher (Fig. 38)
aus leicht gebranntem roten Ton ohne Malerei. Es
ist das erste Gefäß dieser Art, das hier gefunden
wurde und fast ganz zusammengestellt werden
konnte. Ganz besondere Aufmerksamkeit bean-
spruchen Reste eines sehr merkwürdigen Gefäßes,
das wahrscheinlich ungefähr die oft besprochene
Gestalt der großen Vorratsgefäße (Jahrbuch I Fig. 95)
hatte und auf dessen Bug einige Gebilde wie Fig. 39
Fig. 39 Ausflußstück von einem bemalten Gefäße
mit mehreren Öffnungen, 14 cm hoch
ang'eordnet waren. Erhalten sind Reste von drei
bis vier derartigen „Hälsen“; sie waren wohl rings
um die Hauptausflußöffnung angeordnet. Außerdem
ist noch eine größere Anzahl von anderen zu
diesem Gefäße gehörigen Scherben gefunden wor-
den, doch ist mir bisher die Herstellung seiner
Gestalt nicht gelungen. Sämtliche Scherben weisen
die gewöhnliche Malerei in schwarzer Farbe auf.
Schließlich erregt nicht geringes Interesse das Bruch-
stück eines Doppelgestelles, auf dessen oberem und
unterem Stege je ein rohes Tierfigürchen so ang'e-
bracht ist, daß das eine nach rechts, das andere
nach links blickt. Dieses Objekt ist auch insofern
Fig. 40 Scherben von einem Doppelgestell mit rohen
Tierbildern auf den zwei Verbindungsstegen, 17 cm hoch
ein Unikum, als der obere Steg' nicht durchbohrt
ist, was sonst bei allen bisher beobachteten der
Fall war (Fig. 40). Schließlich ist noch anzuführen
eine tellerförmige Schüssel (Bruchstück), die an
der Außenseite gemalt ist (g'rößter Durchmesser
18 cm), und ein kleineres Exemplar der Gefäßform
mit schmalem Boden, breitem Bauch und schmaler
Öffnung (Höhe 24 cm).
Die meisten der im September, Oktober und
November gemachten, in unserer Darstellung* ge-
nannten Funde kamen in das Bukowinaer Landes-
museum (Inv. Nr. I/573—591 und vier bisher nicht
inventarisierte Stücke1); nur einige wenige wurden
von Herrn v. Kostin seiner Sammlung einverleibt.1)
Am Schlüsse möge noch eine nachträgliche
Bemerkung über die zwei im ersten Berichte ge-
nannten Knochenwerkzeug'e, von denen eines Jahr-
buch I Fig. 126 abgebildet ist, Platz finden. Wozu
diese aus einem gespaltenen Röhrenknochen ange-
fertigten, mit einer kurzen schief gestellten Schneide
versehenen Spachteln gedient haben könnten, blieb
mir damals unklar. Nun habe ich aber wiederholt,
besonders an der Innenseite kleinerer Gefäße und
sonstiger Hohlräume von Tongeräten, die nicht
g'ut geglättet sind, Kratzspuren gefunden, die aller
Wahrscheinlichkeit nach von diesen Instrumenten
herrühren. In der Tat scheinen diese sehr geeignet
zum Entfernen überflüssiger Tonpartien beim
Formen der Gefäße. Die glatte Rundseite des
Knochens konnte zugleich zum Glätten benutzt
werden. So bot dieses Werkzeug' bei der Gefäß-
fabrikation g'ewiß größere Vorteile als ein Feuer-
steinspan. Erinnert sei daran, daß die Fundstelle
dieser Geräte schon aus anderen Gründen für den
Wegwurfhäufen einer Töpferei betrachtet wurde.
Die vorstehenden Bemerkungen passen gut dazu.2)
b Bei Herrn v. Kostin verblieben aus dem Grabfunde
die zwei kleinen ganzen Schüsselchen, das Töpfchen, welches
Asche enthalten haben soll, und das Trinkgefäß.
2) Wiewohl es nicht das Ziel dieser vorläufigen Be-
richte ist, die Funde in der Bukowina mit jenen in den
benachbarten Gebieten zu vergleichen, möge doch hier
schon auf die zusammenfassende Charakteristik der gali-
zischen Funde hingewiesen werden, welche K. Hadaczek
von den Spuren der sogenannten altmykenischen Kultur
in Osteuropa entwirft (Wiadomosci numizmatyczno-archeo-
logiczne (Krakau) 1901 Nr. 49/50): Von Süden zieht das
Gebiet dieser Kultur den Dnjestr und Dnjepr aufwärts
über Rumänien, Südrußland, die Bukowina und Galizien
und entsendet ihren schwachen Ableger nach Böhmen. Die
Träger dieser Kultur wohnten in Hütten mit viereckiger
Grundform, aus Holz gefertigt, mit Lehm verklatscht, ohne
Kalktünchung. Feuerstätten sind bisher nirgends nach-
R. F. KAINDJ, Prähistorisches aus der Bukowina
40
haltenes Rinderhorn (Auerochse?) zu nennen. Inter-
essant ist ein primitiv gearbeiteter Becher (Fig. 38)
aus leicht gebranntem roten Ton ohne Malerei. Es
ist das erste Gefäß dieser Art, das hier gefunden
wurde und fast ganz zusammengestellt werden
konnte. Ganz besondere Aufmerksamkeit bean-
spruchen Reste eines sehr merkwürdigen Gefäßes,
das wahrscheinlich ungefähr die oft besprochene
Gestalt der großen Vorratsgefäße (Jahrbuch I Fig. 95)
hatte und auf dessen Bug einige Gebilde wie Fig. 39
Fig. 39 Ausflußstück von einem bemalten Gefäße
mit mehreren Öffnungen, 14 cm hoch
ang'eordnet waren. Erhalten sind Reste von drei
bis vier derartigen „Hälsen“; sie waren wohl rings
um die Hauptausflußöffnung angeordnet. Außerdem
ist noch eine größere Anzahl von anderen zu
diesem Gefäße gehörigen Scherben gefunden wor-
den, doch ist mir bisher die Herstellung seiner
Gestalt nicht gelungen. Sämtliche Scherben weisen
die gewöhnliche Malerei in schwarzer Farbe auf.
Schließlich erregt nicht geringes Interesse das Bruch-
stück eines Doppelgestelles, auf dessen oberem und
unterem Stege je ein rohes Tierfigürchen so ang'e-
bracht ist, daß das eine nach rechts, das andere
nach links blickt. Dieses Objekt ist auch insofern
Fig. 40 Scherben von einem Doppelgestell mit rohen
Tierbildern auf den zwei Verbindungsstegen, 17 cm hoch
ein Unikum, als der obere Steg' nicht durchbohrt
ist, was sonst bei allen bisher beobachteten der
Fall war (Fig. 40). Schließlich ist noch anzuführen
eine tellerförmige Schüssel (Bruchstück), die an
der Außenseite gemalt ist (g'rößter Durchmesser
18 cm), und ein kleineres Exemplar der Gefäßform
mit schmalem Boden, breitem Bauch und schmaler
Öffnung (Höhe 24 cm).
Die meisten der im September, Oktober und
November gemachten, in unserer Darstellung* ge-
nannten Funde kamen in das Bukowinaer Landes-
museum (Inv. Nr. I/573—591 und vier bisher nicht
inventarisierte Stücke1); nur einige wenige wurden
von Herrn v. Kostin seiner Sammlung einverleibt.1)
Am Schlüsse möge noch eine nachträgliche
Bemerkung über die zwei im ersten Berichte ge-
nannten Knochenwerkzeug'e, von denen eines Jahr-
buch I Fig. 126 abgebildet ist, Platz finden. Wozu
diese aus einem gespaltenen Röhrenknochen ange-
fertigten, mit einer kurzen schief gestellten Schneide
versehenen Spachteln gedient haben könnten, blieb
mir damals unklar. Nun habe ich aber wiederholt,
besonders an der Innenseite kleinerer Gefäße und
sonstiger Hohlräume von Tongeräten, die nicht
g'ut geglättet sind, Kratzspuren gefunden, die aller
Wahrscheinlichkeit nach von diesen Instrumenten
herrühren. In der Tat scheinen diese sehr geeignet
zum Entfernen überflüssiger Tonpartien beim
Formen der Gefäße. Die glatte Rundseite des
Knochens konnte zugleich zum Glätten benutzt
werden. So bot dieses Werkzeug' bei der Gefäß-
fabrikation g'ewiß größere Vorteile als ein Feuer-
steinspan. Erinnert sei daran, daß die Fundstelle
dieser Geräte schon aus anderen Gründen für den
Wegwurfhäufen einer Töpferei betrachtet wurde.
Die vorstehenden Bemerkungen passen gut dazu.2)
b Bei Herrn v. Kostin verblieben aus dem Grabfunde
die zwei kleinen ganzen Schüsselchen, das Töpfchen, welches
Asche enthalten haben soll, und das Trinkgefäß.
2) Wiewohl es nicht das Ziel dieser vorläufigen Be-
richte ist, die Funde in der Bukowina mit jenen in den
benachbarten Gebieten zu vergleichen, möge doch hier
schon auf die zusammenfassende Charakteristik der gali-
zischen Funde hingewiesen werden, welche K. Hadaczek
von den Spuren der sogenannten altmykenischen Kultur
in Osteuropa entwirft (Wiadomosci numizmatyczno-archeo-
logiczne (Krakau) 1901 Nr. 49/50): Von Süden zieht das
Gebiet dieser Kultur den Dnjestr und Dnjepr aufwärts
über Rumänien, Südrußland, die Bukowina und Galizien
und entsendet ihren schwachen Ableger nach Böhmen. Die
Träger dieser Kultur wohnten in Hütten mit viereckiger
Grundform, aus Holz gefertigt, mit Lehm verklatscht, ohne
Kalktünchung. Feuerstätten sind bisher nirgends nach-