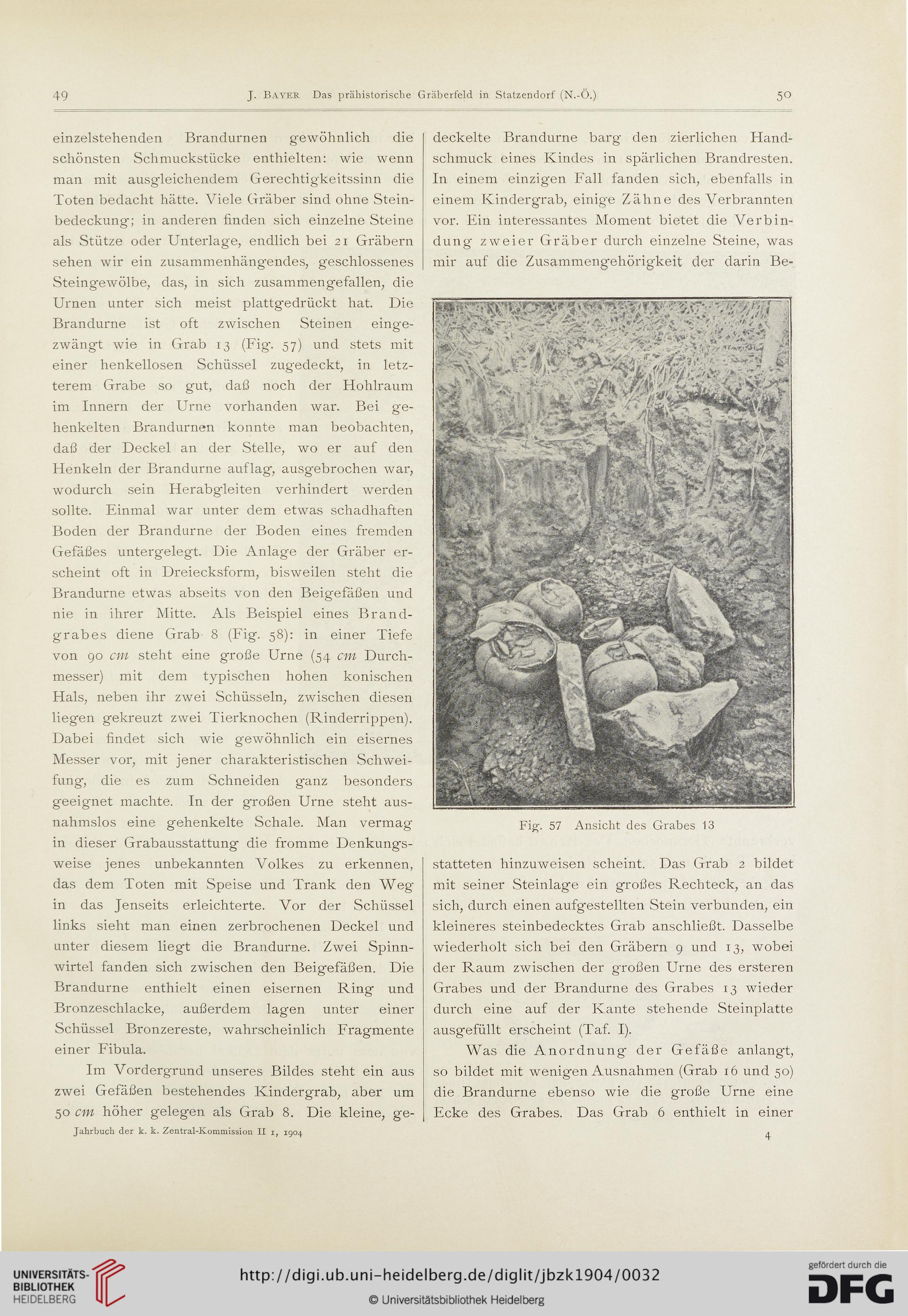49
J. Bayer Das prähistorische Gräberfeld in Statzendorf (N.-Ö.)
50
einzelstehenden Brandurnen gewöhnlich die
schönsten Schmuckstücke enthielten: wie wenn
man mit ausgleichendem Gerechtigkeitssinn die
Toten bedacht hätte. Viele Gräber sind ohne Stein-
bedeckung-; in anderen finden sich einzelne Steine
als Stütze oder Unterlage, endlich bei 21 Gräbern
sehen wir ein zusammenhängendes, geschlossenes
Steingewölbe, das, in sich zusammengefallen, die
Urnen unter sich meist plattgedrückt hat. Die
Brandurne ist oft zwischen Steinen einge-
zwängt wie in Grab 13 (Fig. 57) und stets mit
einer henkellosen Schüssel zugedeckt, in letz-
terem Grabe so gut, daß noch der Hohlraum
im Innern der Urne vorhanden war. Bei ge-
henkelten Brandurnen konnte man beobachten,
daß der Deckel an der Stelle, wo er auf den
Henkeln der Brandurne auflag, ausgebrochen war,
wodurch sein Herabgleiten verhindert werden
sollte. Einmal war unter dem etwas schadhaften
Boden der Brandurne der Boden eines fremden
Gefäßes untergelegt. Die Anlage der Gräber er-
scheint oft in Dreiecksform, bisweilen steht die
Brandurne etwas abseits von den Beigefäßen und
nie in ihrer Mitte. Als Beispiel eines Brand-
grabes diene Grab 8 (Fig. 58): in einer Tiefe
von 90 cm steht eine große Urne (54 cm Durch-
messer) mit dem typischen hohen konischen
Hals, neben ihr zwei Schüsseln, zwischen diesen
liegen gekreuzt zwei Tierknochen (Rinderrippen).
Dabei findet sich wie gewöhnlich ein eisernes
Messer vor, mit jener charakteristischen Schwei-
fung, die es zum Schneiden ganz besonders
geeignet machte. In der großen Urne steht aus-
nahmslos eine gehenkelte Schale. Man vermag
in dieser Grabausstattung die fromme Denkungs-
weise jenes unbekannten Volkes zu erkennen,
das dem Toten mit Speise und Trank den Weg
in das Jenseits erleichterte. Vor der Schüssel
links sieht man einen zerbrochenen Deckel und
unter diesem liegt die Brandurne. Zwei Spinn-
wirtel fanden sich zwischen den Beigefäßen. Die
Brandurne enthielt einen eisernen Ring und
Bronzeschlacke, außerdem lagen unter einer
Schüssel Bronzereste, wahrscheinlich Fragmente
einer Fibula.
Im Vordergrund unseres Bildes steht ein aus
zwei Gefäßen bestehendes Rindergrab, aber um
50 cm höher gelegen als Grab 8. Die kleine, ge-
Jabrbuch der k. k. Zentral-Kommission II i, 1904
deckelte Brandurne barg den zierlichen Hand-
schmuck eines Kindes in spärlichen Brandresten.
In einem einzigen Fall fanden sich, ebenfalls in
einem Kindergrab, einig-e Zähne des Verbrannten
vor. Ein interessantes Moment bietet die Verbin-
dung zweier Gräber durch einzelne Steine, was
mir auf die Zusammengehörigkeit der darin Be-
Fig. 57 Ansicht des Grabes 13
statteten hinzuweisen scheint. Das Grab 2 bildet
mit seiner Steinlage ein großes Rechteck, an das
sich, durch einen aufgestellten Stein verbunden, ein
kleineres steinbedecktes Grab anschließt. Dasselbe
wiederholt sich bei den Gräbern 9 und 13, wobei
der Raum zwischen der großen Urne des ersteren
Grabes und der Brandurne des Grabes 13 wieder
durch eine auf der Kante stehende Steinplatte
ausgefüllt erscheint (Taf. I).
Was die Anordnung der Gefäße anlangt,
so bildet mit wenigen Ausnahmen (Grab 16 und 50)
die Brandurne ebenso wie die große Urne eine
Ecke des Grabes. Das Grab 6 enthielt in einer
4
J. Bayer Das prähistorische Gräberfeld in Statzendorf (N.-Ö.)
50
einzelstehenden Brandurnen gewöhnlich die
schönsten Schmuckstücke enthielten: wie wenn
man mit ausgleichendem Gerechtigkeitssinn die
Toten bedacht hätte. Viele Gräber sind ohne Stein-
bedeckung-; in anderen finden sich einzelne Steine
als Stütze oder Unterlage, endlich bei 21 Gräbern
sehen wir ein zusammenhängendes, geschlossenes
Steingewölbe, das, in sich zusammengefallen, die
Urnen unter sich meist plattgedrückt hat. Die
Brandurne ist oft zwischen Steinen einge-
zwängt wie in Grab 13 (Fig. 57) und stets mit
einer henkellosen Schüssel zugedeckt, in letz-
terem Grabe so gut, daß noch der Hohlraum
im Innern der Urne vorhanden war. Bei ge-
henkelten Brandurnen konnte man beobachten,
daß der Deckel an der Stelle, wo er auf den
Henkeln der Brandurne auflag, ausgebrochen war,
wodurch sein Herabgleiten verhindert werden
sollte. Einmal war unter dem etwas schadhaften
Boden der Brandurne der Boden eines fremden
Gefäßes untergelegt. Die Anlage der Gräber er-
scheint oft in Dreiecksform, bisweilen steht die
Brandurne etwas abseits von den Beigefäßen und
nie in ihrer Mitte. Als Beispiel eines Brand-
grabes diene Grab 8 (Fig. 58): in einer Tiefe
von 90 cm steht eine große Urne (54 cm Durch-
messer) mit dem typischen hohen konischen
Hals, neben ihr zwei Schüsseln, zwischen diesen
liegen gekreuzt zwei Tierknochen (Rinderrippen).
Dabei findet sich wie gewöhnlich ein eisernes
Messer vor, mit jener charakteristischen Schwei-
fung, die es zum Schneiden ganz besonders
geeignet machte. In der großen Urne steht aus-
nahmslos eine gehenkelte Schale. Man vermag
in dieser Grabausstattung die fromme Denkungs-
weise jenes unbekannten Volkes zu erkennen,
das dem Toten mit Speise und Trank den Weg
in das Jenseits erleichterte. Vor der Schüssel
links sieht man einen zerbrochenen Deckel und
unter diesem liegt die Brandurne. Zwei Spinn-
wirtel fanden sich zwischen den Beigefäßen. Die
Brandurne enthielt einen eisernen Ring und
Bronzeschlacke, außerdem lagen unter einer
Schüssel Bronzereste, wahrscheinlich Fragmente
einer Fibula.
Im Vordergrund unseres Bildes steht ein aus
zwei Gefäßen bestehendes Rindergrab, aber um
50 cm höher gelegen als Grab 8. Die kleine, ge-
Jabrbuch der k. k. Zentral-Kommission II i, 1904
deckelte Brandurne barg den zierlichen Hand-
schmuck eines Kindes in spärlichen Brandresten.
In einem einzigen Fall fanden sich, ebenfalls in
einem Kindergrab, einig-e Zähne des Verbrannten
vor. Ein interessantes Moment bietet die Verbin-
dung zweier Gräber durch einzelne Steine, was
mir auf die Zusammengehörigkeit der darin Be-
Fig. 57 Ansicht des Grabes 13
statteten hinzuweisen scheint. Das Grab 2 bildet
mit seiner Steinlage ein großes Rechteck, an das
sich, durch einen aufgestellten Stein verbunden, ein
kleineres steinbedecktes Grab anschließt. Dasselbe
wiederholt sich bei den Gräbern 9 und 13, wobei
der Raum zwischen der großen Urne des ersteren
Grabes und der Brandurne des Grabes 13 wieder
durch eine auf der Kante stehende Steinplatte
ausgefüllt erscheint (Taf. I).
Was die Anordnung der Gefäße anlangt,
so bildet mit wenigen Ausnahmen (Grab 16 und 50)
die Brandurne ebenso wie die große Urne eine
Ecke des Grabes. Das Grab 6 enthielt in einer
4