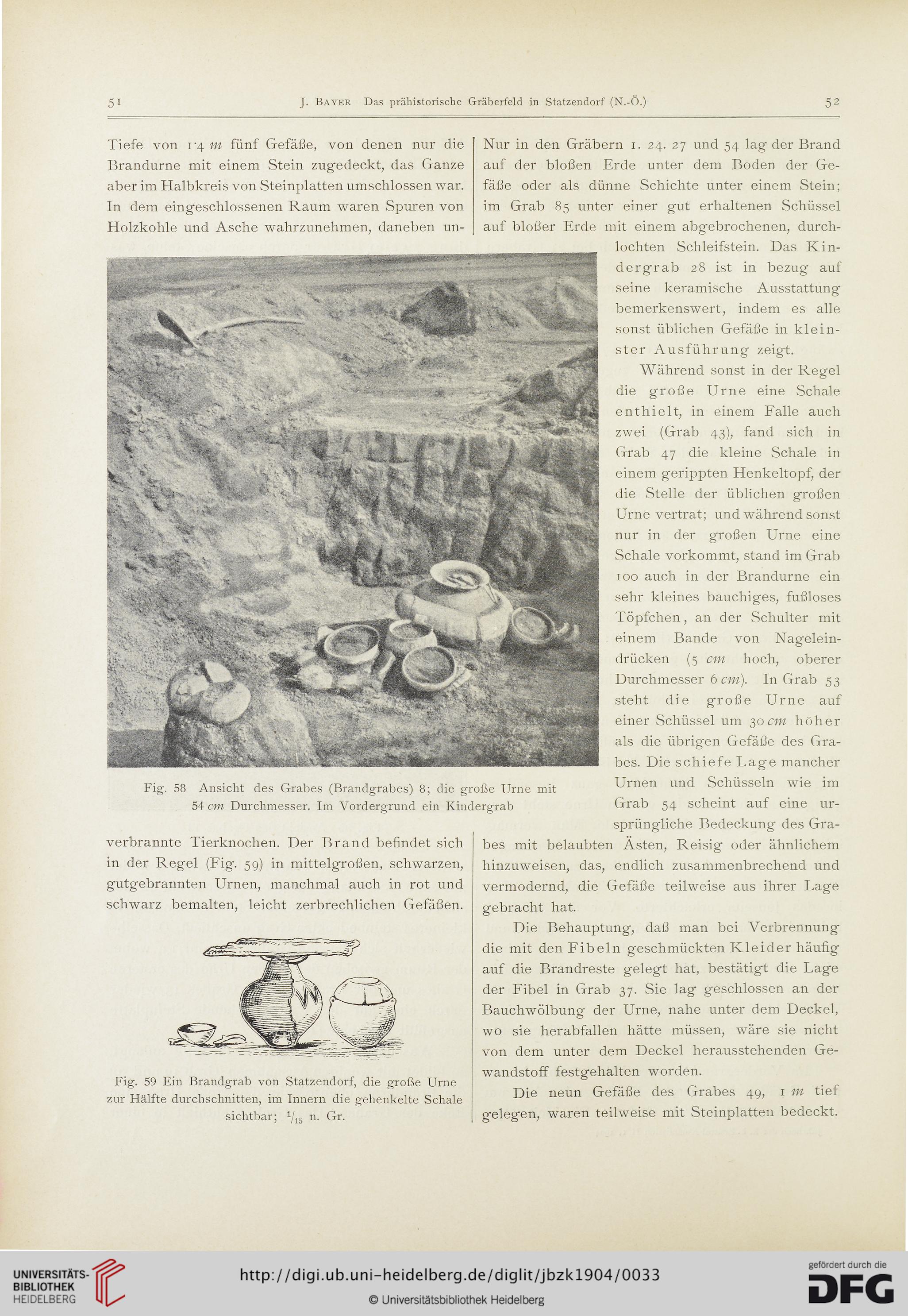5i
J. Bayer Das prähistorische Gräberfeld in Statzendorf (N.-Ö.)
52
Tiefe von 1-4 m fünf Gefäße, von denen nur die
Brandurne mit einem Stein zugedeckt, das Ganze
aber im Halbkreis von Steinplatten umschlossen war.
In dem eingeschlossenen Raum waren Spuren von
Holzkohle und Asche wahrzunehmen, daneben un-
Fig. 58 Ansicht des Grabes (Brandgrabes) 8; die große Urne mit
54 cm Durchmesser. Im Vordergrund ein Kindergrab
verbrannte Tierknochen. Der Brand befindet sich
in der Regel (Fig. 59) in mittelgroßen, schwarzen,
gutgebrannten Urnen, manchmal auch in rot und
schwarz bemalten, leicht zerbrechlichen Gefäßen.
Fig. 59 Ein Brandgrab von Statzendorf, die große Urne
zur Hälfte durchschnitten, im Innern die gehenkelte Schale
sichtbar; *•/ 15 n. Gr.
Nur in den Gräbern 1. 24. 27 und 54 lag der Brand
auf der bloßen Erde unter dem Boden der Ge-
fäße oder als dünne Schichte unter einem Stein;
im Grab 85 unter einer gut erhaltenen Schüssel
auf bloßer Erde mit einem abgebrochenen, durch-
lochten Schleifstein. Das Kin-
dergrab 28 ist in bezug auf
seine keramische Ausstattung
bemerkenswert, indem es alle
sonst üblichen Gefäße in klein-
ster Ausführung zeigt.
Während sonst in der Regel
die große Urne eine Schale
enthielt, in einem Falle auch
zwei (Grab 43), fand sich in
Grab 47 die kleine Schale in
einem gerippten Henkeltopf, der
die Stelle der üblichen großen
Urne vertrat; und während sonst
nur in der großen Urne eine
Schale vorkommt, stand im Grab
100 auch in der Brandurne ein
sehr kleines bauchiges, fußloses
Töpfchen, an der Schulter mit
einem Bande von Nagelein-
drücken (5 cm hoch, oberer
Durchmesser 6 ein). In Grab 53
steht die große Urne auf
einer Schüssel um 30 cm höher
als die übrigen Gefäße des Gra-
bes. Die schiefe Lage mancher
Urnen und Schüsseln wie im
Grab 54 scheint auf eine ur-
sprüngliche Bedeckung des Gra-
bes mit belaubten Asten, Reisig oder ähnlichem
hinzuweisen, das, endlich zusammenbrechend und
vermodernd, die Gefäße teilweise aus ihrer Lage
gebracht hat.
Die Behauptung, daß man bei Verbrennung
die mit den Fibeln geschmückten Kleider häufig
auf die Brandreste gelegt hat, bestätigt die Lage
der Fibel in Grab 37. Sie lag geschlossen an der
Bauchwölbung der Urne, nahe unter dem Deckel,
wo sie herabfallen hätte müssen, wäre sie nicht
von dem unter dem Deckel herausstehenden Ge-
wandstoff festgehalten worden.
Die neun Gefäße des Grabes 49, 1 m tief
gelegen, waren teilweise mit Steinplatten bedeckt.
J. Bayer Das prähistorische Gräberfeld in Statzendorf (N.-Ö.)
52
Tiefe von 1-4 m fünf Gefäße, von denen nur die
Brandurne mit einem Stein zugedeckt, das Ganze
aber im Halbkreis von Steinplatten umschlossen war.
In dem eingeschlossenen Raum waren Spuren von
Holzkohle und Asche wahrzunehmen, daneben un-
Fig. 58 Ansicht des Grabes (Brandgrabes) 8; die große Urne mit
54 cm Durchmesser. Im Vordergrund ein Kindergrab
verbrannte Tierknochen. Der Brand befindet sich
in der Regel (Fig. 59) in mittelgroßen, schwarzen,
gutgebrannten Urnen, manchmal auch in rot und
schwarz bemalten, leicht zerbrechlichen Gefäßen.
Fig. 59 Ein Brandgrab von Statzendorf, die große Urne
zur Hälfte durchschnitten, im Innern die gehenkelte Schale
sichtbar; *•/ 15 n. Gr.
Nur in den Gräbern 1. 24. 27 und 54 lag der Brand
auf der bloßen Erde unter dem Boden der Ge-
fäße oder als dünne Schichte unter einem Stein;
im Grab 85 unter einer gut erhaltenen Schüssel
auf bloßer Erde mit einem abgebrochenen, durch-
lochten Schleifstein. Das Kin-
dergrab 28 ist in bezug auf
seine keramische Ausstattung
bemerkenswert, indem es alle
sonst üblichen Gefäße in klein-
ster Ausführung zeigt.
Während sonst in der Regel
die große Urne eine Schale
enthielt, in einem Falle auch
zwei (Grab 43), fand sich in
Grab 47 die kleine Schale in
einem gerippten Henkeltopf, der
die Stelle der üblichen großen
Urne vertrat; und während sonst
nur in der großen Urne eine
Schale vorkommt, stand im Grab
100 auch in der Brandurne ein
sehr kleines bauchiges, fußloses
Töpfchen, an der Schulter mit
einem Bande von Nagelein-
drücken (5 cm hoch, oberer
Durchmesser 6 ein). In Grab 53
steht die große Urne auf
einer Schüssel um 30 cm höher
als die übrigen Gefäße des Gra-
bes. Die schiefe Lage mancher
Urnen und Schüsseln wie im
Grab 54 scheint auf eine ur-
sprüngliche Bedeckung des Gra-
bes mit belaubten Asten, Reisig oder ähnlichem
hinzuweisen, das, endlich zusammenbrechend und
vermodernd, die Gefäße teilweise aus ihrer Lage
gebracht hat.
Die Behauptung, daß man bei Verbrennung
die mit den Fibeln geschmückten Kleider häufig
auf die Brandreste gelegt hat, bestätigt die Lage
der Fibel in Grab 37. Sie lag geschlossen an der
Bauchwölbung der Urne, nahe unter dem Deckel,
wo sie herabfallen hätte müssen, wäre sie nicht
von dem unter dem Deckel herausstehenden Ge-
wandstoff festgehalten worden.
Die neun Gefäße des Grabes 49, 1 m tief
gelegen, waren teilweise mit Steinplatten bedeckt.