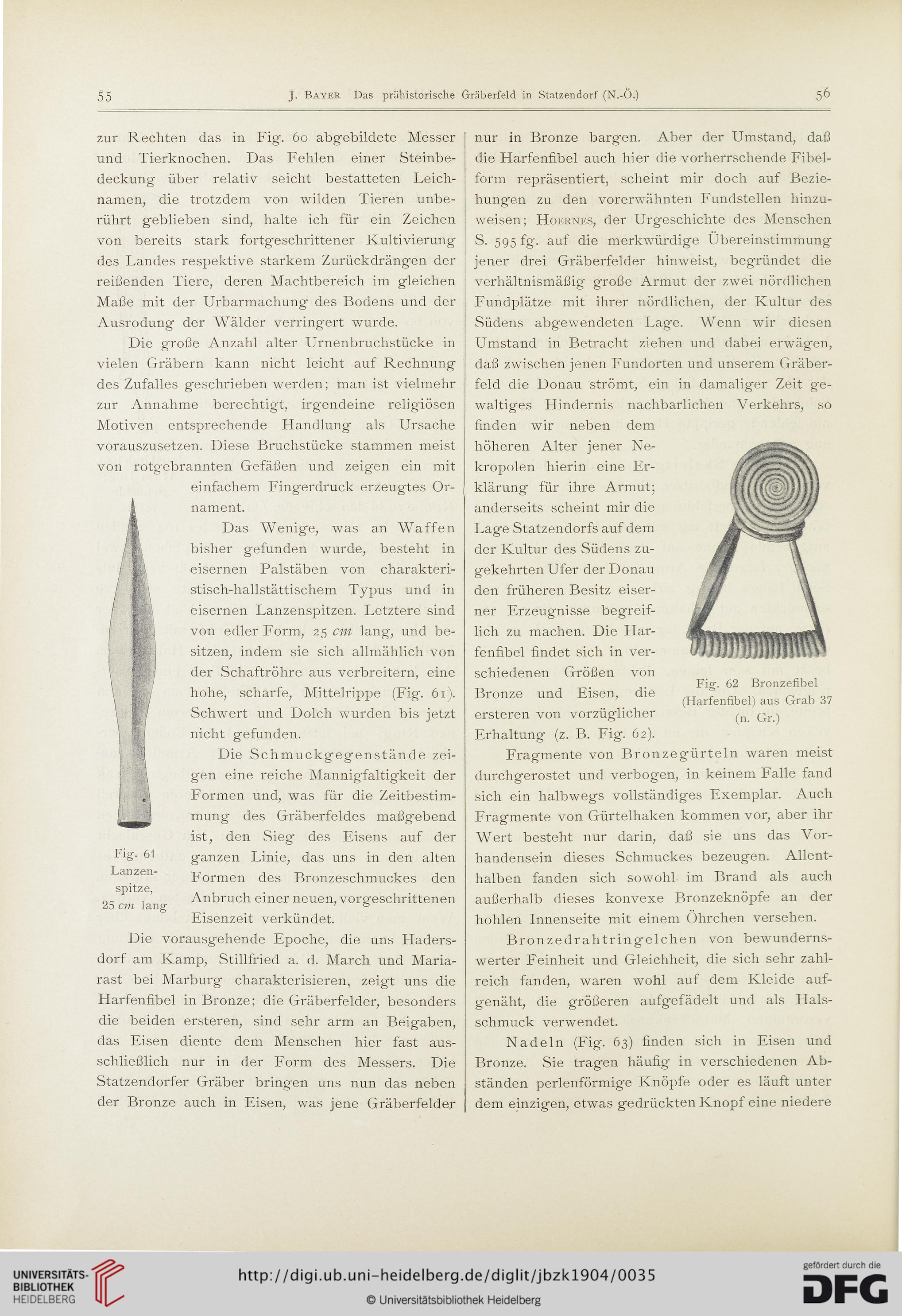55
J. Bayer Das prähistorische Gräberfeld in Statzendorf (N.-Ö.)
56
zur Rechten das in Fig. 60 abgebildete Messer
und Tierknochen. Das Fehlen einer Steinbe-
deckung über relativ seicht bestatteten Leich-
name^ die trotzdem von wilden Tieren unbe-
rührt geblieben sind, halte ich für ein Zeichen
von bereits stark fortgeschrittener Kultivierung
des Landes respektive starkem Zurückdrängen der
reißenden Tiere, deren Machtbereich im gleichen
Maße mit der Urbarmachung des Bodens und der
Ausrodung der Wälder verringert wurde.
Die große Anzahl alter Urnenbruchstücke in
vielen Gräbern kann nicht leicht auf Rechnung
des Zufalles geschrieben werden; man ist vielmehr
zur Annahme berechtigt, irgendeine religiösen
Motiven entsprechende Handlung als Ursache
vorauszusetzen. Diese Bruchstücke stammen meist
von rotg'ebrannten Gefäßen und zeigen ein mit
einfachem Fingerdruck erzeugtes Or- |
nament.
Das Wenige, was an Waffen
bisher gefunden wurde, besteht in
eisernen Palstäben von charakteri-
stisch-hallstättischem Typus und in
eisernen Lanzenspitzen. Letztere sind
von edler Form, 25 cm lang, und be-
sitzen, indem sie sich allmählich von
der Schaftröhre aus verbreitern, eine
hohe, scharfe, Mittelrippe (Fig. 61).
Schwert und Dolch wurden bis jetzt
nicht gefunden.
Die Schmuckgegenstände zei-
gen eine reiche Mannigfaltigkeit der
Formen und, was für die Zeitbestim-
mung des Gräberfeldes maßgebend
ist, den Sieg des Eisens auf der
ganzen Linie, das uns in den alten
Formen des Bronzeschmuckes den
Anbruch einer neuen, vorgeschrittenen
Eisenzeit verkündet.
Die vorausg'ehende Epoche, die uns Haders-
dorf am Kamp, Stillfried a. d. March und Maria-
rast bei Marburg charakterisieren, zeigt uns die
Harfenfibel in Bronze; die Gräberfelder, besonders
die beiden ersteren, sind sehr arm an Beigaben,
das Eisen diente dem Menschen hier fast aus-
schließlich nur in der Form des Messers. Die
Statzendorfer Gräber bringen uns nun das neben
der Bronze auch in Eisen, was jene Gräberfelder
nur in Bronze bargen. Aber der Umstand, daß
die Harfenfibel auch hier die vorherrschende Fibel-
form repräsentiert, scheint mir doch auf Bezie-
hungen zu den vorerwähnten Fundstellen hinzu-
weisen; Hoernes, der Urgeschichte des Menschen
S. 595 fg. auf die merkwürdige Übereinstimmung
jener drei Gräberfelder hinweist, begründet die
verhältnismäßig große Armut der zwei nördlichen
Fundplätze mit ihrer nördlichen, der Kultur des
Südens abgewendeten Lage. Wenn wir diesen
Umstand in Betracht ziehen und dabei erwägen,
daß zwischen jenen Fundorten und unserem Gräber-
feld die Donau strömt, ein in damaliger Zeit ge-
waltiges Hindernis nachbarlichen Verkehrs, so
finden wir neben dem
höheren Alter jener Ne-
kropolen hierin eine Er-
klärung für ihre Armut;
anderseits scheint mir die
Lag'e Statzendorfs auf dem
der Kultur des Südens zu-
gekehrten Ufer der Donau
den früheren Besitz eiser-
ner Erzeugnisse begreif-
lich zu machen. Die Har-
fenfibel findet sich in ver-
schiedenen Größen von
Bronze und Eisen, die
ersteren von vorzüglicher
Erhaltung (z. B. Fig. 62).
Fragmente von Bronzegürteln waren meist
durchgerostet und verbogen, in keinem Falle fand
sich ein halbwegs vollständiges Exemplar. Auch
Fragmente von Gürtelhaken kommen vor, aber ihr
Wert besteht nur darin, daß sie uns das Vor-
handensein dieses Schmuckes bezeugen. Allent-
halben fanden sich sowohl im Brand als auch
außerhalb dieses konvexe Bronzeknöpfe an der
hohlen Innenseite mit einem Öhrchen versehen.
Bronzedrahtringelchen von bewunderns-
werter Feinheit und Gleichheit, die sich sehr zahl-
reich fanden, waren wohl auf dem Kleide auf-
genäht, die größeren aufgefädelt und als Hals-
schmuck verwendet.
Nadeln (Fig. 63) finden sich in Eisen und
Bronze. Sie tragen häufig in verschiedenen Ab-
ständen perlenförmig'e Knöpfe oder es läuft unter
dem einzigen, etwas gedrückten Knopf eine niedere
Fig. 61
Lanzen-
spitze,
25 cm lang
Fig. 62 Bronzefibel
(Harfenfibel) aus Grab 37
(n. Gr.)
J. Bayer Das prähistorische Gräberfeld in Statzendorf (N.-Ö.)
56
zur Rechten das in Fig. 60 abgebildete Messer
und Tierknochen. Das Fehlen einer Steinbe-
deckung über relativ seicht bestatteten Leich-
name^ die trotzdem von wilden Tieren unbe-
rührt geblieben sind, halte ich für ein Zeichen
von bereits stark fortgeschrittener Kultivierung
des Landes respektive starkem Zurückdrängen der
reißenden Tiere, deren Machtbereich im gleichen
Maße mit der Urbarmachung des Bodens und der
Ausrodung der Wälder verringert wurde.
Die große Anzahl alter Urnenbruchstücke in
vielen Gräbern kann nicht leicht auf Rechnung
des Zufalles geschrieben werden; man ist vielmehr
zur Annahme berechtigt, irgendeine religiösen
Motiven entsprechende Handlung als Ursache
vorauszusetzen. Diese Bruchstücke stammen meist
von rotg'ebrannten Gefäßen und zeigen ein mit
einfachem Fingerdruck erzeugtes Or- |
nament.
Das Wenige, was an Waffen
bisher gefunden wurde, besteht in
eisernen Palstäben von charakteri-
stisch-hallstättischem Typus und in
eisernen Lanzenspitzen. Letztere sind
von edler Form, 25 cm lang, und be-
sitzen, indem sie sich allmählich von
der Schaftröhre aus verbreitern, eine
hohe, scharfe, Mittelrippe (Fig. 61).
Schwert und Dolch wurden bis jetzt
nicht gefunden.
Die Schmuckgegenstände zei-
gen eine reiche Mannigfaltigkeit der
Formen und, was für die Zeitbestim-
mung des Gräberfeldes maßgebend
ist, den Sieg des Eisens auf der
ganzen Linie, das uns in den alten
Formen des Bronzeschmuckes den
Anbruch einer neuen, vorgeschrittenen
Eisenzeit verkündet.
Die vorausg'ehende Epoche, die uns Haders-
dorf am Kamp, Stillfried a. d. March und Maria-
rast bei Marburg charakterisieren, zeigt uns die
Harfenfibel in Bronze; die Gräberfelder, besonders
die beiden ersteren, sind sehr arm an Beigaben,
das Eisen diente dem Menschen hier fast aus-
schließlich nur in der Form des Messers. Die
Statzendorfer Gräber bringen uns nun das neben
der Bronze auch in Eisen, was jene Gräberfelder
nur in Bronze bargen. Aber der Umstand, daß
die Harfenfibel auch hier die vorherrschende Fibel-
form repräsentiert, scheint mir doch auf Bezie-
hungen zu den vorerwähnten Fundstellen hinzu-
weisen; Hoernes, der Urgeschichte des Menschen
S. 595 fg. auf die merkwürdige Übereinstimmung
jener drei Gräberfelder hinweist, begründet die
verhältnismäßig große Armut der zwei nördlichen
Fundplätze mit ihrer nördlichen, der Kultur des
Südens abgewendeten Lage. Wenn wir diesen
Umstand in Betracht ziehen und dabei erwägen,
daß zwischen jenen Fundorten und unserem Gräber-
feld die Donau strömt, ein in damaliger Zeit ge-
waltiges Hindernis nachbarlichen Verkehrs, so
finden wir neben dem
höheren Alter jener Ne-
kropolen hierin eine Er-
klärung für ihre Armut;
anderseits scheint mir die
Lag'e Statzendorfs auf dem
der Kultur des Südens zu-
gekehrten Ufer der Donau
den früheren Besitz eiser-
ner Erzeugnisse begreif-
lich zu machen. Die Har-
fenfibel findet sich in ver-
schiedenen Größen von
Bronze und Eisen, die
ersteren von vorzüglicher
Erhaltung (z. B. Fig. 62).
Fragmente von Bronzegürteln waren meist
durchgerostet und verbogen, in keinem Falle fand
sich ein halbwegs vollständiges Exemplar. Auch
Fragmente von Gürtelhaken kommen vor, aber ihr
Wert besteht nur darin, daß sie uns das Vor-
handensein dieses Schmuckes bezeugen. Allent-
halben fanden sich sowohl im Brand als auch
außerhalb dieses konvexe Bronzeknöpfe an der
hohlen Innenseite mit einem Öhrchen versehen.
Bronzedrahtringelchen von bewunderns-
werter Feinheit und Gleichheit, die sich sehr zahl-
reich fanden, waren wohl auf dem Kleide auf-
genäht, die größeren aufgefädelt und als Hals-
schmuck verwendet.
Nadeln (Fig. 63) finden sich in Eisen und
Bronze. Sie tragen häufig in verschiedenen Ab-
ständen perlenförmig'e Knöpfe oder es läuft unter
dem einzigen, etwas gedrückten Knopf eine niedere
Fig. 61
Lanzen-
spitze,
25 cm lang
Fig. 62 Bronzefibel
(Harfenfibel) aus Grab 37
(n. Gr.)