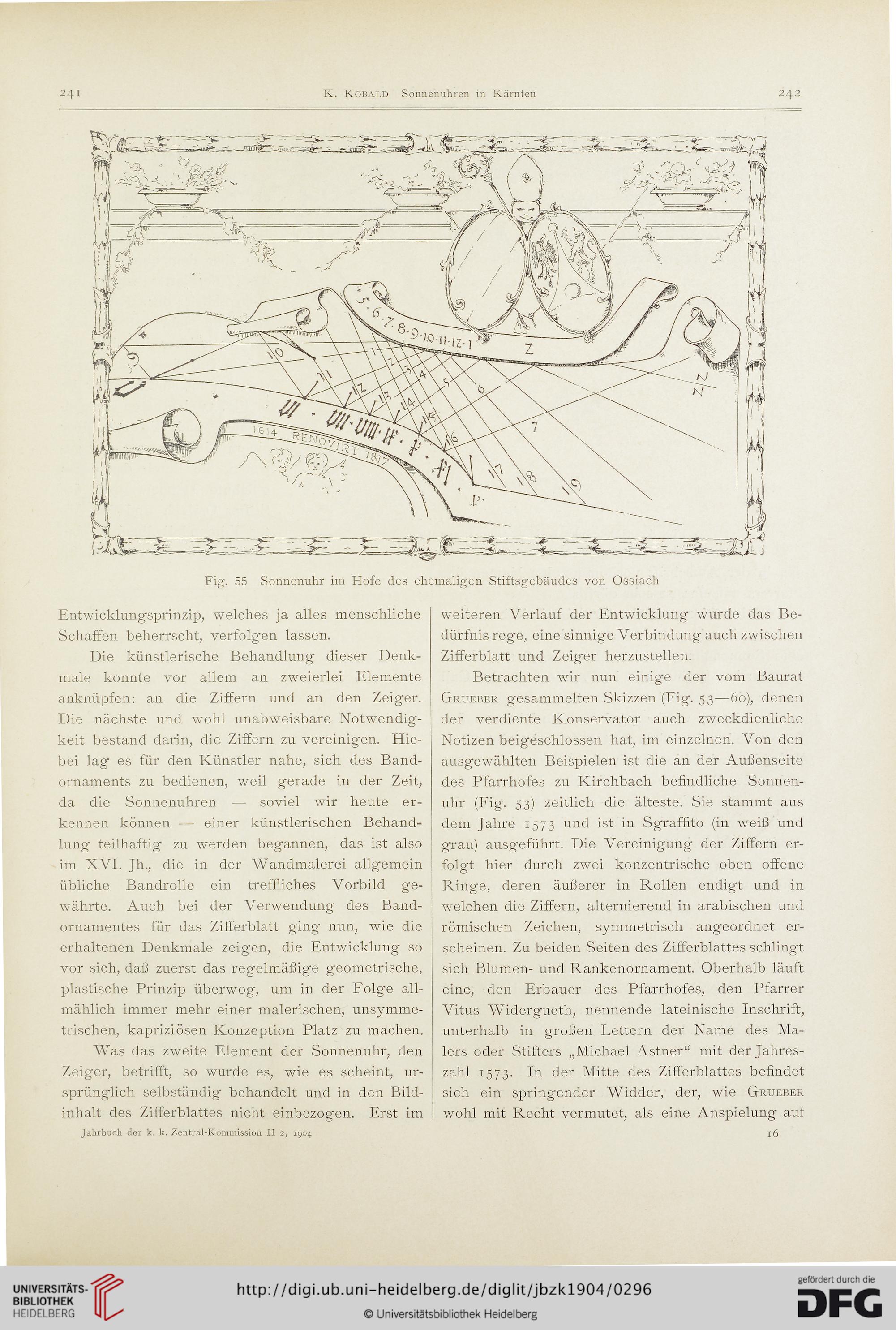241
K. Ko bald Sonnenuhren in Kärnten
242
Entwicklungsprinzip, welches ja alles menschliche
Schaffen beherrscht, verfolgen lassen.
Die künstlerische Behandlung dieser Denk-
male konnte vor allem an zweierlei Elemente
anknüpfen: an die Ziffern und an den Zeiger.
Die nächste und wohl unabweisbare Notwendig-
keit bestand darin, die Ziffern zu vereinigen. Hie-
bei lag es für den Künstler nahe, sich des Band-
ornaments zu bedienen, weil gerade in der Zeit,
da die Sonnenuhren •—■ soviel wir heute er-
kennen können — einer künstlerischen Behand-
lung teilhaftig zu werden begannen, das ist also
im XVI. Jh., die in der Wandmalerei allgemein
übliche Bandrolle ein treffliches Vorbild ge-
währte. Auch bei der Verwendung des Band-
ornamentes für das Zifferblatt ging nun, wie die
erhaltenen Denkmale zeigen, die Entwicklung so
vor sich, daß zuerst das regelmäßige geometrische,
plastische Prinzip überwog, um in der Folge all-
mählich immer mehr einer malerischen, unsymme-
trischen, kapriziösen Konzeption Platz zu machen.
Was das zweite Element der Sonnenuhr, den
Zeiger, betrifft, so wurde es, wie es scheint, ur-
sprünglich selbständig behandelt und in den Bild-
inhalt des Zifferblattes nicht einbezogen. Erst im
Jahrbuch der k. k. Zentral-Kommission II 2, 1904
weiteren Verlauf der Entwicklung wurde das Be-
dürfnis reg'e, eine sinnige Verbindung auch zwischen
Zifferblatt und Zeiger herzustellen.
Betrachten wir nun einige der vom Baurat
Grueber gesammelten Skizzen (Fig. 53—60), denen
der verdiente Konservator auch zweckdienliche
Notizen beigeschlossen hat, im einzelnen. Von den
ausgewählten Beispielen ist die an der Außenseite
des Pfarrhofes zu Kirchbach befindliche Sonnen-
uhr (Fig. 53) zeitlich die älteste. Sie stammt aus
dem Jahre 1573 und ist in Sgraffito (in weiß und
grau) ausgeführt. Die Vereinigung der Ziffern er-
folgt hier durch zwei konzentrische oben offene
Ringe, deren äußerer in Rollen endigt und in
welchen die Ziffern, alternierend in arabischen und
römischen Zeichen, symmetrisch angeordnet er-
scheinen. Zu beiden Seiten des Zifferblattes schlingt
sich Blumen- und Rankenornament. Oberhalb läuft
eine, den Erbauer des Pfarrhofes, den Pfarrer
Vitus Widergueth, nennende lateinische Inschrift,
unterhalb in großen Lettern der Name des Ma-
lers oder Stifters „Michael Astner“ mit der Jahres-
zahl 1573. In der Mitte des Zifferblattes befindet
sich ein springender Widder, der, wie Grueber
wohl mit Recht vermutet, als eine Anspielung" auf
16
K. Ko bald Sonnenuhren in Kärnten
242
Entwicklungsprinzip, welches ja alles menschliche
Schaffen beherrscht, verfolgen lassen.
Die künstlerische Behandlung dieser Denk-
male konnte vor allem an zweierlei Elemente
anknüpfen: an die Ziffern und an den Zeiger.
Die nächste und wohl unabweisbare Notwendig-
keit bestand darin, die Ziffern zu vereinigen. Hie-
bei lag es für den Künstler nahe, sich des Band-
ornaments zu bedienen, weil gerade in der Zeit,
da die Sonnenuhren •—■ soviel wir heute er-
kennen können — einer künstlerischen Behand-
lung teilhaftig zu werden begannen, das ist also
im XVI. Jh., die in der Wandmalerei allgemein
übliche Bandrolle ein treffliches Vorbild ge-
währte. Auch bei der Verwendung des Band-
ornamentes für das Zifferblatt ging nun, wie die
erhaltenen Denkmale zeigen, die Entwicklung so
vor sich, daß zuerst das regelmäßige geometrische,
plastische Prinzip überwog, um in der Folge all-
mählich immer mehr einer malerischen, unsymme-
trischen, kapriziösen Konzeption Platz zu machen.
Was das zweite Element der Sonnenuhr, den
Zeiger, betrifft, so wurde es, wie es scheint, ur-
sprünglich selbständig behandelt und in den Bild-
inhalt des Zifferblattes nicht einbezogen. Erst im
Jahrbuch der k. k. Zentral-Kommission II 2, 1904
weiteren Verlauf der Entwicklung wurde das Be-
dürfnis reg'e, eine sinnige Verbindung auch zwischen
Zifferblatt und Zeiger herzustellen.
Betrachten wir nun einige der vom Baurat
Grueber gesammelten Skizzen (Fig. 53—60), denen
der verdiente Konservator auch zweckdienliche
Notizen beigeschlossen hat, im einzelnen. Von den
ausgewählten Beispielen ist die an der Außenseite
des Pfarrhofes zu Kirchbach befindliche Sonnen-
uhr (Fig. 53) zeitlich die älteste. Sie stammt aus
dem Jahre 1573 und ist in Sgraffito (in weiß und
grau) ausgeführt. Die Vereinigung der Ziffern er-
folgt hier durch zwei konzentrische oben offene
Ringe, deren äußerer in Rollen endigt und in
welchen die Ziffern, alternierend in arabischen und
römischen Zeichen, symmetrisch angeordnet er-
scheinen. Zu beiden Seiten des Zifferblattes schlingt
sich Blumen- und Rankenornament. Oberhalb läuft
eine, den Erbauer des Pfarrhofes, den Pfarrer
Vitus Widergueth, nennende lateinische Inschrift,
unterhalb in großen Lettern der Name des Ma-
lers oder Stifters „Michael Astner“ mit der Jahres-
zahl 1573. In der Mitte des Zifferblattes befindet
sich ein springender Widder, der, wie Grueber
wohl mit Recht vermutet, als eine Anspielung" auf
16